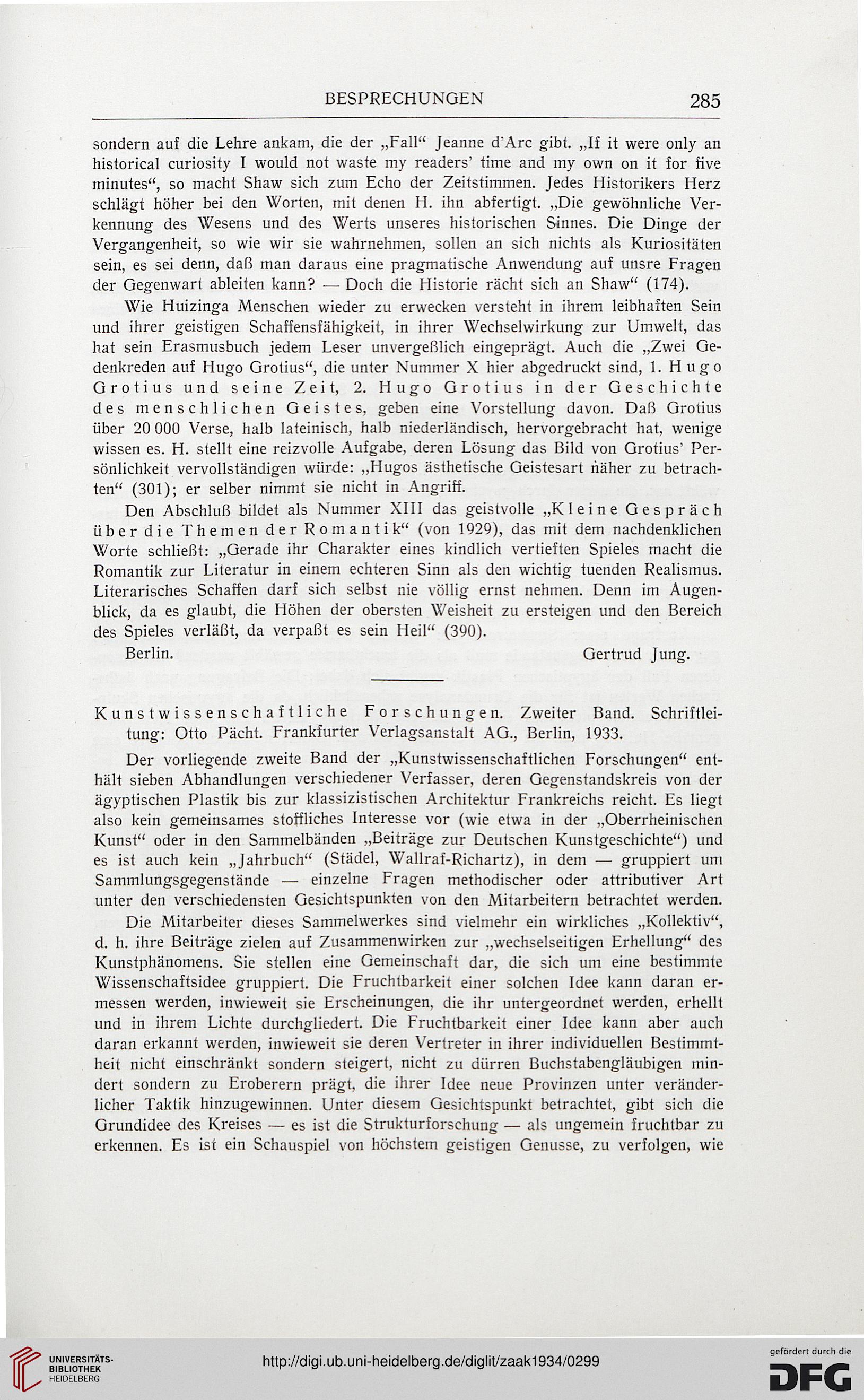BESPRECHUNGEN
285
sondern auf die Lehre ankam, die der „Fall" Jeanne d'Arc gibt. „If it were only an
historical curiosity I would not waste my readers' time and my own on it for five
minutes", so macht Shaw sich zum Echo der Zeitstimmen. Jedes Historikers Herz
schlägt höher bei den Worten, mit denen H. ihn abfertigt. „Die gewöhnliche Ver-
kennung des Wesens und des Werts unseres historischen Sinnes. Die Dinge der
Vergangenheit, so wie wir sie wahrnehmen, sollen an sich nichts als Kuriositäten
sein, es sei denn, daß man daraus eine pragmatische Anwendung auf unsre Fragen
der Gegenwart ableiten kann? — Doch die Historie rächt sich an Shaw" (174).
Wie Huizinga Menschen wieder zu erwecken versteht in ihrem leibhaften Sein
und ihrer geistigen Schaffensfähigkeit, in ihrer Wechselwirkung zur Umwelt, das
hat sein Erasmusbuch jedem Leser unvergeßlich eingeprägt. Auch die „Zwei Ge-
denkreden auf Hugo Grotius", die unter Nummer X hier abgedruckt sind, 1. Hugo
Grotius und seine Zeit, 2. Hugo Grotius in der Geschichte
des menschlichen Geistes, geben eine Vorstellung davon. Daß Grotius
über 20 000 Verse, halb lateinisch, halb niederländisch, hervorgebracht hat, wenige
wissen es. H. stellt eine reizvolle Aufgabe, deren Lösung das Bild von Grotius' Per-
sönlichkeit vervollständigen würde: „Hugos ästhetische Geistesart näher zu betrach-
ten" (301); er selber nimmt sie nicht in Angriff.
Den Abschluß bildet als Nummer XIII das geistvolle „Kleine Gespräch
über die Themen der Romantik" (von 1929), das mit dem nachdenklichen
Worte schließt: „Gerade ihr Charakter eines kindlich vertieften Spieles macht die
Romantik zur Literatur in einem echteren Sinn als den wichtig tuenden Realismus.
Literarisches Scharfen darf sich selbst nie völlig ernst nehmen. Denn im Augen-
blick, da es glaubt, die Höhen der obersten Weisheit zu ersteigen und den Bereich
des Spieles verläßt, da verpaßt es sein Heil" (390).
Berlin. Gertrud Jung.
Kunstwissenschaftliche Forschungen. Zweiter Band. Schriftlei-
tung: Otto Pacht. Frankfurter Verlagsanstalt AG., Berlin, 1933.
Der vorliegende zweite Band der „Kunstwissenschaftlichen Forschungen" ent-
hält sieben Abhandlungen verschiedener Verfasser, deren Gegenstandskreis von der
ägyptischen Plastik bis zur klassizistischen Architektur Frankreichs reicht. Es liegt
also kein gemeinsames stoffliches Interesse vor (wie etwa in der „Oberrheinischen
Kunst" oder in den Sammelbänden „Beiträge zur Deutschen Kunstgeschichte") und
es ist auch kein „Jahrbuch" (Städel, Wallraf-Richartz), in dem — gruppiert um
Sammlungsgegenstände — einzelne Fragen methodischer oder attributiver Art
unter den verschiedensten Gesichtspunkten von den Mitarbeitern betrachtet werden.
Die Mitarbeiter dieses Sammelwerkes sind vielmehr ein wirkliches „Kollektiv",
d. h. ihre Beiträge zielen auf Zusammenwirken zur „wechselseitigen Erhellung" des
Kunstphänomens. Sie stellen eine Gemeinschaft dar, die sich um eine bestimmte
Wissenschaftsidee gruppiert. Die Fruchtbarkeit einer solchen Idee kann daran er-
messen werden, inwieweit sie Erscheinungen, die ihr untergeordnet werden, erhellt
und in ihrem Lichte durchgliedert. Die Fruchtbarkeit einer Idee kann aber auch
daran erkannt werden, inwieweit sie deren Vertreter in ihrer individuellen Bestimmt-
heit nicht einschränkt sondern steigert, nicht zu dürren Buchstabengläubigen min-
dert sondern zu Eroberern prägt, die ihrer Idee neue Provinzen unter veränder-
licher Taktik hinzugewinnen. Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, gibt sich die
Grundidee des Kreises — es ist die Strukturforschung — als ungemein fruchtbar zu
erkennen. Es ist ein Schauspiel von höchstem geistigen Genüsse, zu verfolgen, wie
285
sondern auf die Lehre ankam, die der „Fall" Jeanne d'Arc gibt. „If it were only an
historical curiosity I would not waste my readers' time and my own on it for five
minutes", so macht Shaw sich zum Echo der Zeitstimmen. Jedes Historikers Herz
schlägt höher bei den Worten, mit denen H. ihn abfertigt. „Die gewöhnliche Ver-
kennung des Wesens und des Werts unseres historischen Sinnes. Die Dinge der
Vergangenheit, so wie wir sie wahrnehmen, sollen an sich nichts als Kuriositäten
sein, es sei denn, daß man daraus eine pragmatische Anwendung auf unsre Fragen
der Gegenwart ableiten kann? — Doch die Historie rächt sich an Shaw" (174).
Wie Huizinga Menschen wieder zu erwecken versteht in ihrem leibhaften Sein
und ihrer geistigen Schaffensfähigkeit, in ihrer Wechselwirkung zur Umwelt, das
hat sein Erasmusbuch jedem Leser unvergeßlich eingeprägt. Auch die „Zwei Ge-
denkreden auf Hugo Grotius", die unter Nummer X hier abgedruckt sind, 1. Hugo
Grotius und seine Zeit, 2. Hugo Grotius in der Geschichte
des menschlichen Geistes, geben eine Vorstellung davon. Daß Grotius
über 20 000 Verse, halb lateinisch, halb niederländisch, hervorgebracht hat, wenige
wissen es. H. stellt eine reizvolle Aufgabe, deren Lösung das Bild von Grotius' Per-
sönlichkeit vervollständigen würde: „Hugos ästhetische Geistesart näher zu betrach-
ten" (301); er selber nimmt sie nicht in Angriff.
Den Abschluß bildet als Nummer XIII das geistvolle „Kleine Gespräch
über die Themen der Romantik" (von 1929), das mit dem nachdenklichen
Worte schließt: „Gerade ihr Charakter eines kindlich vertieften Spieles macht die
Romantik zur Literatur in einem echteren Sinn als den wichtig tuenden Realismus.
Literarisches Scharfen darf sich selbst nie völlig ernst nehmen. Denn im Augen-
blick, da es glaubt, die Höhen der obersten Weisheit zu ersteigen und den Bereich
des Spieles verläßt, da verpaßt es sein Heil" (390).
Berlin. Gertrud Jung.
Kunstwissenschaftliche Forschungen. Zweiter Band. Schriftlei-
tung: Otto Pacht. Frankfurter Verlagsanstalt AG., Berlin, 1933.
Der vorliegende zweite Band der „Kunstwissenschaftlichen Forschungen" ent-
hält sieben Abhandlungen verschiedener Verfasser, deren Gegenstandskreis von der
ägyptischen Plastik bis zur klassizistischen Architektur Frankreichs reicht. Es liegt
also kein gemeinsames stoffliches Interesse vor (wie etwa in der „Oberrheinischen
Kunst" oder in den Sammelbänden „Beiträge zur Deutschen Kunstgeschichte") und
es ist auch kein „Jahrbuch" (Städel, Wallraf-Richartz), in dem — gruppiert um
Sammlungsgegenstände — einzelne Fragen methodischer oder attributiver Art
unter den verschiedensten Gesichtspunkten von den Mitarbeitern betrachtet werden.
Die Mitarbeiter dieses Sammelwerkes sind vielmehr ein wirkliches „Kollektiv",
d. h. ihre Beiträge zielen auf Zusammenwirken zur „wechselseitigen Erhellung" des
Kunstphänomens. Sie stellen eine Gemeinschaft dar, die sich um eine bestimmte
Wissenschaftsidee gruppiert. Die Fruchtbarkeit einer solchen Idee kann daran er-
messen werden, inwieweit sie Erscheinungen, die ihr untergeordnet werden, erhellt
und in ihrem Lichte durchgliedert. Die Fruchtbarkeit einer Idee kann aber auch
daran erkannt werden, inwieweit sie deren Vertreter in ihrer individuellen Bestimmt-
heit nicht einschränkt sondern steigert, nicht zu dürren Buchstabengläubigen min-
dert sondern zu Eroberern prägt, die ihrer Idee neue Provinzen unter veränder-
licher Taktik hinzugewinnen. Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, gibt sich die
Grundidee des Kreises — es ist die Strukturforschung — als ungemein fruchtbar zu
erkennen. Es ist ein Schauspiel von höchstem geistigen Genüsse, zu verfolgen, wie