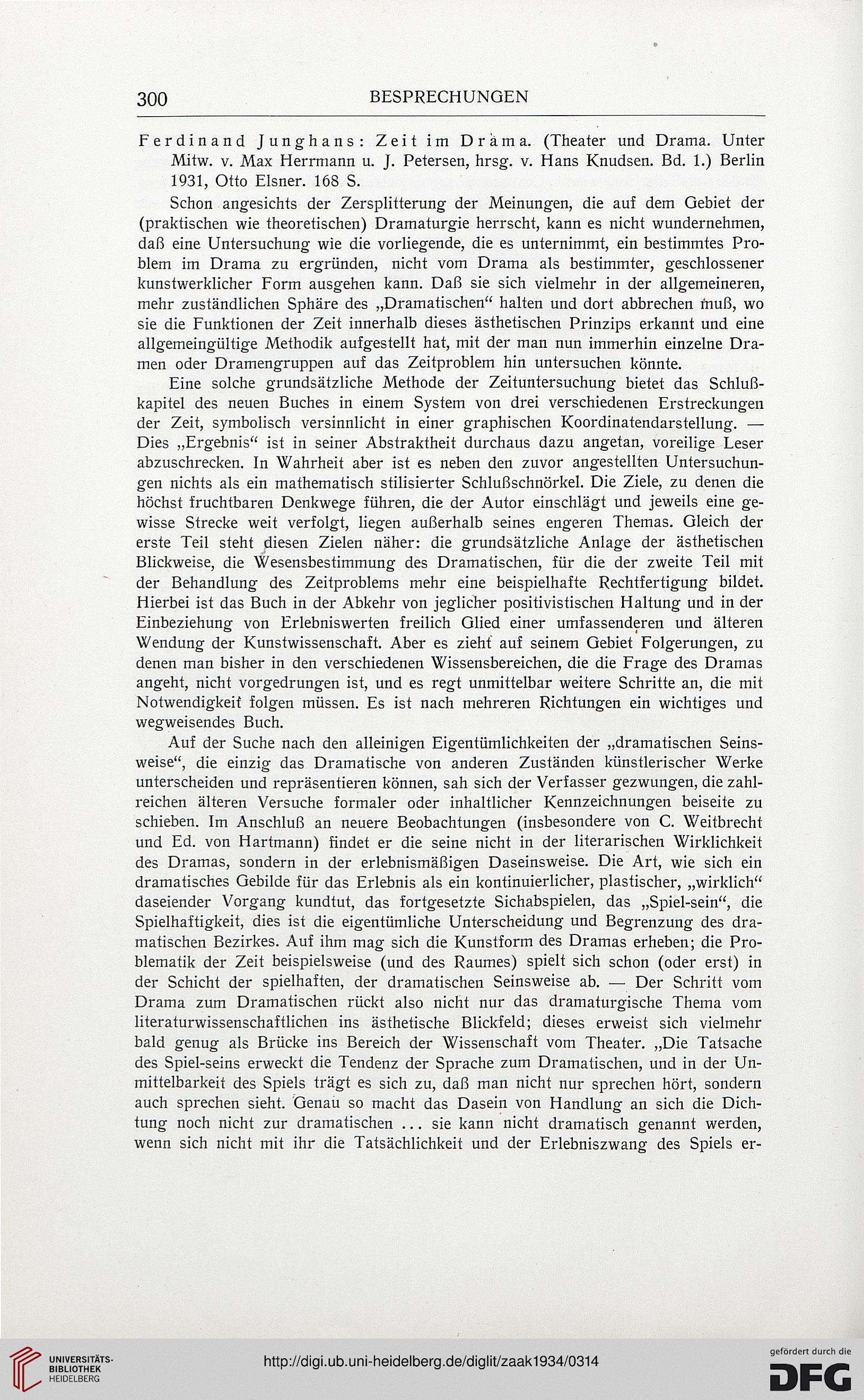300
BESPRECHUNGEN
Ferdinand Junghans: Zeit im Drama. (Theater und Drama. Unter
Mitw. v. Max Herrmann u. J. Petersen, hrsg. v. Hans Knudsen. Bd. 1.) Berlin
1931, Otto Eisner. 168 S.
Schon angesichts der Zersplitterung der Meinungen, die auf dem Gebiet der
(praktischen wie theoretischen) Dramaturgie herrscht, kann es nicht wundernehmen,
daß eine Untersuchung wie die vorliegende, die es unternimmt, ein bestimmtes Pro-
blem im Drama zu ergründen, nicht vom Drama als bestimmter, geschlossener
kunstwerklicher Form ausgehen kann. Daß sie sich vielmehr in der allgemeineren,
mehr zuständlichen Sphäre des „Dramatischen" halten und dort abbrechen muß, wo
sie die Funktionen der Zeit innerhalb dieses ästhetischen Prinzips erkannt und eine
allgemeingültige Methodik aufgestellt hat, mit der man nun immerhin einzelne Dra-
men oder Dramengruppen auf das Zeitproblem hin untersuchen könnte.
Eine solche grundsätzliche Methode der Zeituntersuchung bietet das Schluß-
kapitel des neuen Buches in einem System von drei verschiedenen Erstreckungen
der Zeit, symbolisch versinnlicht in einer graphischen Koordinatendarstellung. —
Dies „Ergebnis" ist in seiner Abstraktheit durchaus dazu angetan, voreilige Leser
abzuschrecken. In Wahrheit aber ist es neben den zuvor angestellten Untersuchun-
gen nichts als ein mathematisch stilisierter Schlußschnörkel. Die Ziele, zu denen die
höchst fruchtbaren Denkwege führen, die der Autor einschlägt und jeweils eine ge-
wisse Strecke weit verfolgt, liegen außerhalb seines engeren Themas. Gleich der
erste Teil steht diesen Zielen näher: die grundsätzliche Anlage der ästhetischen
Blickweise, die Wesensbestimmung des Dramatischen, für die der zweite Teil mit
der Behandlung des Zeitproblems mehr eine beispielhafte Rechtfertigung bildet.
Hierbei ist das Buch in der Abkehr von jeglicher positivistischen Haltung und in der
Einbeziehung von Erlebniswerten freilich Glied einer umfassenderen und älteren
Wendung der Kunstwissenschaft. Aber es zieht auf seinem Gebiet Folgerungen, zu
denen man bisher in den verschiedenen Wissensbereichen, die die Frage des Dramas
angeht, nicht vorgedrungen ist, und es regt unmittelbar weitere Schritte an, die mit
Notwendigkeit folgen müssen. Es ist nach mehreren Richtungen ein wichtiges und
wegweisendes Buch.
Auf der Suche nach den alleinigen Eigentümlichkeiten der „dramatischen Seins-
weise", die einzig das Dramatische von anderen Zuständen künstlerischer Werke
unterscheiden und repräsentieren können, sah sich der Verfasser gezwungen, die zahl-
reichen älteren Versuche formaler oder inhaltlicher Kennzeichnungen beiseite zu
schieben. Im Anschluß an neuere Beobachtungen (insbesondere von C. Weitbrecht
und Ed. von Hartmann) findet er die seine nicht in der literarischen Wirklichkeit
des Dramas, sondern in der erlebnismäßigen Daseinsweise. Die Art, wie sich ein
dramatisches Gebilde für das Erlebnis als ein kontinuierlicher, plastischer, „wirklich"
daseiender Vorgang kundtut, das fortgesetzte Sichabspielen, das „Spiel-sein", die
Spielhaftigkeit, dies ist die eigentümliche Unterscheidung und Begrenzung des dra-
matischen Bezirkes. Auf ihm mag sich die Kunstform des Dramas erheben; die Pro-
blematik der Zeit beispielsweise (und des Raumes) spielt sich schon (oder erst) in
der Schicht der spielhaften, der dramatischen Seinsweise ab. — Der Schritt vom
Drama zum Dramatischen rückt also nicht nur das dramaturgische Thema vom
literaturwissenschaftlichen ins ästhetische Blickfeld; dieses erweist sich vielmehr
bald genug als Brücke ins Bereich der Wissenschaft vom Theater. „Die Tatsache
des Spiel-seins erweckt die Tendenz der Sprache zum Dramatischen, und in der Un-
mittelbarkeit des Spiels trägt es sich zu, daß man nicht nur sprechen hört, sondern
auch sprechen sieht. Genau so macht das Dasein von Handlung an sich die Dich-
tung noch nicht zur dramatischen ... sie kann nicht dramatisch genannt werden,
wenn sich nicht mit ihr die Tatsächlichkeit und der Erlebniszwang des Spiels er-
BESPRECHUNGEN
Ferdinand Junghans: Zeit im Drama. (Theater und Drama. Unter
Mitw. v. Max Herrmann u. J. Petersen, hrsg. v. Hans Knudsen. Bd. 1.) Berlin
1931, Otto Eisner. 168 S.
Schon angesichts der Zersplitterung der Meinungen, die auf dem Gebiet der
(praktischen wie theoretischen) Dramaturgie herrscht, kann es nicht wundernehmen,
daß eine Untersuchung wie die vorliegende, die es unternimmt, ein bestimmtes Pro-
blem im Drama zu ergründen, nicht vom Drama als bestimmter, geschlossener
kunstwerklicher Form ausgehen kann. Daß sie sich vielmehr in der allgemeineren,
mehr zuständlichen Sphäre des „Dramatischen" halten und dort abbrechen muß, wo
sie die Funktionen der Zeit innerhalb dieses ästhetischen Prinzips erkannt und eine
allgemeingültige Methodik aufgestellt hat, mit der man nun immerhin einzelne Dra-
men oder Dramengruppen auf das Zeitproblem hin untersuchen könnte.
Eine solche grundsätzliche Methode der Zeituntersuchung bietet das Schluß-
kapitel des neuen Buches in einem System von drei verschiedenen Erstreckungen
der Zeit, symbolisch versinnlicht in einer graphischen Koordinatendarstellung. —
Dies „Ergebnis" ist in seiner Abstraktheit durchaus dazu angetan, voreilige Leser
abzuschrecken. In Wahrheit aber ist es neben den zuvor angestellten Untersuchun-
gen nichts als ein mathematisch stilisierter Schlußschnörkel. Die Ziele, zu denen die
höchst fruchtbaren Denkwege führen, die der Autor einschlägt und jeweils eine ge-
wisse Strecke weit verfolgt, liegen außerhalb seines engeren Themas. Gleich der
erste Teil steht diesen Zielen näher: die grundsätzliche Anlage der ästhetischen
Blickweise, die Wesensbestimmung des Dramatischen, für die der zweite Teil mit
der Behandlung des Zeitproblems mehr eine beispielhafte Rechtfertigung bildet.
Hierbei ist das Buch in der Abkehr von jeglicher positivistischen Haltung und in der
Einbeziehung von Erlebniswerten freilich Glied einer umfassenderen und älteren
Wendung der Kunstwissenschaft. Aber es zieht auf seinem Gebiet Folgerungen, zu
denen man bisher in den verschiedenen Wissensbereichen, die die Frage des Dramas
angeht, nicht vorgedrungen ist, und es regt unmittelbar weitere Schritte an, die mit
Notwendigkeit folgen müssen. Es ist nach mehreren Richtungen ein wichtiges und
wegweisendes Buch.
Auf der Suche nach den alleinigen Eigentümlichkeiten der „dramatischen Seins-
weise", die einzig das Dramatische von anderen Zuständen künstlerischer Werke
unterscheiden und repräsentieren können, sah sich der Verfasser gezwungen, die zahl-
reichen älteren Versuche formaler oder inhaltlicher Kennzeichnungen beiseite zu
schieben. Im Anschluß an neuere Beobachtungen (insbesondere von C. Weitbrecht
und Ed. von Hartmann) findet er die seine nicht in der literarischen Wirklichkeit
des Dramas, sondern in der erlebnismäßigen Daseinsweise. Die Art, wie sich ein
dramatisches Gebilde für das Erlebnis als ein kontinuierlicher, plastischer, „wirklich"
daseiender Vorgang kundtut, das fortgesetzte Sichabspielen, das „Spiel-sein", die
Spielhaftigkeit, dies ist die eigentümliche Unterscheidung und Begrenzung des dra-
matischen Bezirkes. Auf ihm mag sich die Kunstform des Dramas erheben; die Pro-
blematik der Zeit beispielsweise (und des Raumes) spielt sich schon (oder erst) in
der Schicht der spielhaften, der dramatischen Seinsweise ab. — Der Schritt vom
Drama zum Dramatischen rückt also nicht nur das dramaturgische Thema vom
literaturwissenschaftlichen ins ästhetische Blickfeld; dieses erweist sich vielmehr
bald genug als Brücke ins Bereich der Wissenschaft vom Theater. „Die Tatsache
des Spiel-seins erweckt die Tendenz der Sprache zum Dramatischen, und in der Un-
mittelbarkeit des Spiels trägt es sich zu, daß man nicht nur sprechen hört, sondern
auch sprechen sieht. Genau so macht das Dasein von Handlung an sich die Dich-
tung noch nicht zur dramatischen ... sie kann nicht dramatisch genannt werden,
wenn sich nicht mit ihr die Tatsächlichkeit und der Erlebniszwang des Spiels er-