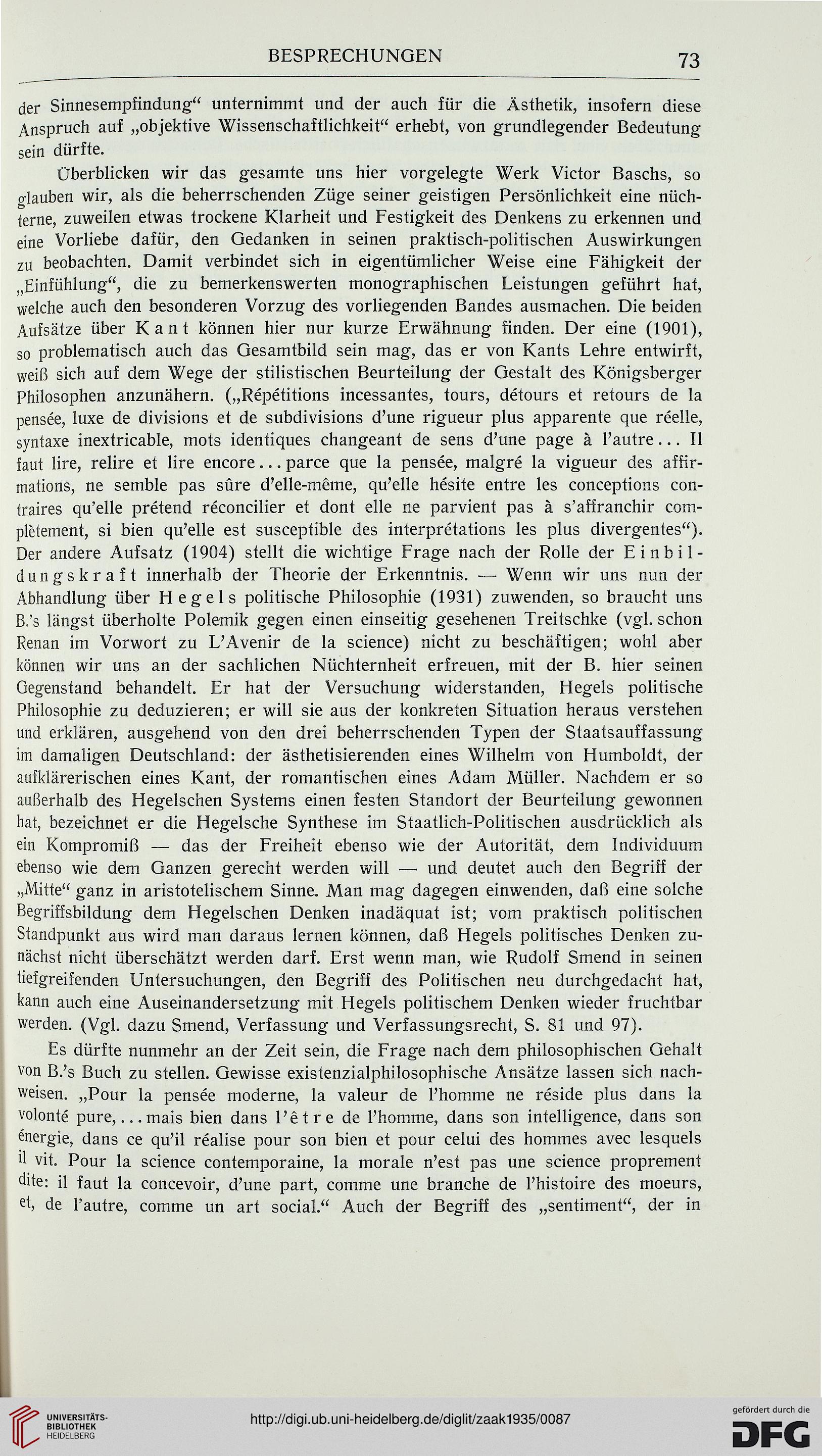BESPRECHUNGEN
73
der Sinnesempfindung" unternimmt und der auch für die Ästhetik, insofern diese
Anspruch auf „objektive Wissenschaftlichkeit" erhebt, von grundlegender Bedeutung
sein dürfte.
Überblicken wir das gesamte uns hier vorgelegte Werk Victor Bäschs, so
glauben wir, als die beherrschenden Züge seiner geistigen Persönlichkeit eine nüch-
terne, zuweilen etwas trockene Klarheit und Festigkeit des Denkens zu erkennen und
eine Vorliebe dafür, den Gedanken in seinen praktisch-politischen Auswirkungen
zu beobachten. Damit verbindet sich in eigentümlicher Weise eine Fähigkeit der
„Einfühlung", die zu bemerkenswerten monographischen Leistungen geführt hat,
welche auch den besonderen Vorzug des vorliegenden Bandes ausmachen. Die beiden
Aufsätze über Kant können hier nur kurze Erwähnung finden. Der eine (1901),
so problematisch auch das Gesamtbild sein mag, das er von Kants Lehre entwirft,
weiß sich auf dem Wege der stilistischen Beurteilung der Gestalt des Königsberger
Philosophen anzunähern. („Repetitions incessantes, tours, detours et retours de la
pensee, luxe de divisions et de subdivisions d'une rigueur plus apparente que reelle,
syntaxe inextricable, mots identiques changeant de sens d'une page ä l'autre... II
faut lire, relire et lire encore... parce que la pensee, malgre la vigueur des affir-
mations, ne semble pas süre d'elle-meme, qu'elle hesite entre les conceptions con-
traires qu'elle pretend reconcilier et dont eile ne parvient pas ä s'affranchir com-
pletement, si bien qu'elle est susceptible des interpretations les plus divergentes").
Der andere Aufsatz (1904) stellt die wichtige Frage nach der Rolle der Einbil-
dungskraft innerhalb der Theorie der Erkenntnis. — Wenn wir uns nun der
Abhandlung über Hegels politische Philosophie (1931) zuwenden, so braucht uns
B.'s längst überholte Polemik gegen einen einseitig gesehenen Treitschke (vgl. schon
Renan im Vorwort zu L'Avenir de la science) nicht zu beschäftigen; wohl aber
können wir uns an der sachlichen Nüchternheit erfreuen, mit der B. hier seinen
Gegenstand behandelt. Er hat der Versuchung widerstanden, Hegels politische
Philosophie zu deduzieren; er will sie aus der konkreten Situation heraus verstehen
und erklären, ausgehend von den drei beherrschenden Typen der Staatsauffassung
im damaligen Deutschland: der ästhetisierenden eines Wilhelm von Humboldt, der
aufklärerischen eines Kant, der romantischen eines Adam Müller. Nachdem er so
außerhalb des Hegeischen Systems einen festen Standort der Beurteilung gewonnen
hat, bezeichnet er die Hegeische Synthese im Staatlich-Politischen ausdrücklich als
ein Kompromiß — das der Freiheit ebenso wie der Autorität, dem Individuum
ebenso wie dem Ganzen gerecht werden will — und deutet auch den Begriff der
„Mitte" ganz in aristotelischem Sinne. Man mag dagegen einwenden, daß eine solche
Begriffsbildung dem Hegeischen Denken inadäquat ist; vom praktisch politischen
Standpunkt aus wird man daraus lernen können, daß Hegels politisches Denken zu-
nächst nicht überschätzt werden darf. Erst wenn man, wie Rudolf Smend in seinen
tiefgreifenden Untersuchungen, den Begriff des Politischen neu durchgedacht hat,
kann auch eine Auseinandersetzung mit Hegels politischem Denken wieder fruchtbar
werden. (Vgl. dazu Smend, Verfassung und Verfassungsrecht, S. 81 und 97).
Es dürfte nunmehr an der Zeit sein, die Frage nach dem philosophischen Gehalt
von B.'s Buch zu stellen. Gewisse existenzialphilosophische Ansätze lassen sich nach-
weisen. „Pour la pensee moderne, la valeur de l'homme ne reside plus dans la
volonte pure, ...mais bien dans l'etre de l'homme, dans son intelligence, dans son
energie, dans ce qu'il realise pour son bien et pour celui des hommes avec lesquels
Jl vit. Pour la science contemporaine, la morale n'est pas une science proprement
dite: il faut la concevoir, d'une part, comme une branche de l'histoire des moeurs,
e*> de l'autre, comme un art social." Auch der Begriff des „sentiment", der in
73
der Sinnesempfindung" unternimmt und der auch für die Ästhetik, insofern diese
Anspruch auf „objektive Wissenschaftlichkeit" erhebt, von grundlegender Bedeutung
sein dürfte.
Überblicken wir das gesamte uns hier vorgelegte Werk Victor Bäschs, so
glauben wir, als die beherrschenden Züge seiner geistigen Persönlichkeit eine nüch-
terne, zuweilen etwas trockene Klarheit und Festigkeit des Denkens zu erkennen und
eine Vorliebe dafür, den Gedanken in seinen praktisch-politischen Auswirkungen
zu beobachten. Damit verbindet sich in eigentümlicher Weise eine Fähigkeit der
„Einfühlung", die zu bemerkenswerten monographischen Leistungen geführt hat,
welche auch den besonderen Vorzug des vorliegenden Bandes ausmachen. Die beiden
Aufsätze über Kant können hier nur kurze Erwähnung finden. Der eine (1901),
so problematisch auch das Gesamtbild sein mag, das er von Kants Lehre entwirft,
weiß sich auf dem Wege der stilistischen Beurteilung der Gestalt des Königsberger
Philosophen anzunähern. („Repetitions incessantes, tours, detours et retours de la
pensee, luxe de divisions et de subdivisions d'une rigueur plus apparente que reelle,
syntaxe inextricable, mots identiques changeant de sens d'une page ä l'autre... II
faut lire, relire et lire encore... parce que la pensee, malgre la vigueur des affir-
mations, ne semble pas süre d'elle-meme, qu'elle hesite entre les conceptions con-
traires qu'elle pretend reconcilier et dont eile ne parvient pas ä s'affranchir com-
pletement, si bien qu'elle est susceptible des interpretations les plus divergentes").
Der andere Aufsatz (1904) stellt die wichtige Frage nach der Rolle der Einbil-
dungskraft innerhalb der Theorie der Erkenntnis. — Wenn wir uns nun der
Abhandlung über Hegels politische Philosophie (1931) zuwenden, so braucht uns
B.'s längst überholte Polemik gegen einen einseitig gesehenen Treitschke (vgl. schon
Renan im Vorwort zu L'Avenir de la science) nicht zu beschäftigen; wohl aber
können wir uns an der sachlichen Nüchternheit erfreuen, mit der B. hier seinen
Gegenstand behandelt. Er hat der Versuchung widerstanden, Hegels politische
Philosophie zu deduzieren; er will sie aus der konkreten Situation heraus verstehen
und erklären, ausgehend von den drei beherrschenden Typen der Staatsauffassung
im damaligen Deutschland: der ästhetisierenden eines Wilhelm von Humboldt, der
aufklärerischen eines Kant, der romantischen eines Adam Müller. Nachdem er so
außerhalb des Hegeischen Systems einen festen Standort der Beurteilung gewonnen
hat, bezeichnet er die Hegeische Synthese im Staatlich-Politischen ausdrücklich als
ein Kompromiß — das der Freiheit ebenso wie der Autorität, dem Individuum
ebenso wie dem Ganzen gerecht werden will — und deutet auch den Begriff der
„Mitte" ganz in aristotelischem Sinne. Man mag dagegen einwenden, daß eine solche
Begriffsbildung dem Hegeischen Denken inadäquat ist; vom praktisch politischen
Standpunkt aus wird man daraus lernen können, daß Hegels politisches Denken zu-
nächst nicht überschätzt werden darf. Erst wenn man, wie Rudolf Smend in seinen
tiefgreifenden Untersuchungen, den Begriff des Politischen neu durchgedacht hat,
kann auch eine Auseinandersetzung mit Hegels politischem Denken wieder fruchtbar
werden. (Vgl. dazu Smend, Verfassung und Verfassungsrecht, S. 81 und 97).
Es dürfte nunmehr an der Zeit sein, die Frage nach dem philosophischen Gehalt
von B.'s Buch zu stellen. Gewisse existenzialphilosophische Ansätze lassen sich nach-
weisen. „Pour la pensee moderne, la valeur de l'homme ne reside plus dans la
volonte pure, ...mais bien dans l'etre de l'homme, dans son intelligence, dans son
energie, dans ce qu'il realise pour son bien et pour celui des hommes avec lesquels
Jl vit. Pour la science contemporaine, la morale n'est pas une science proprement
dite: il faut la concevoir, d'une part, comme une branche de l'histoire des moeurs,
e*> de l'autre, comme un art social." Auch der Begriff des „sentiment", der in