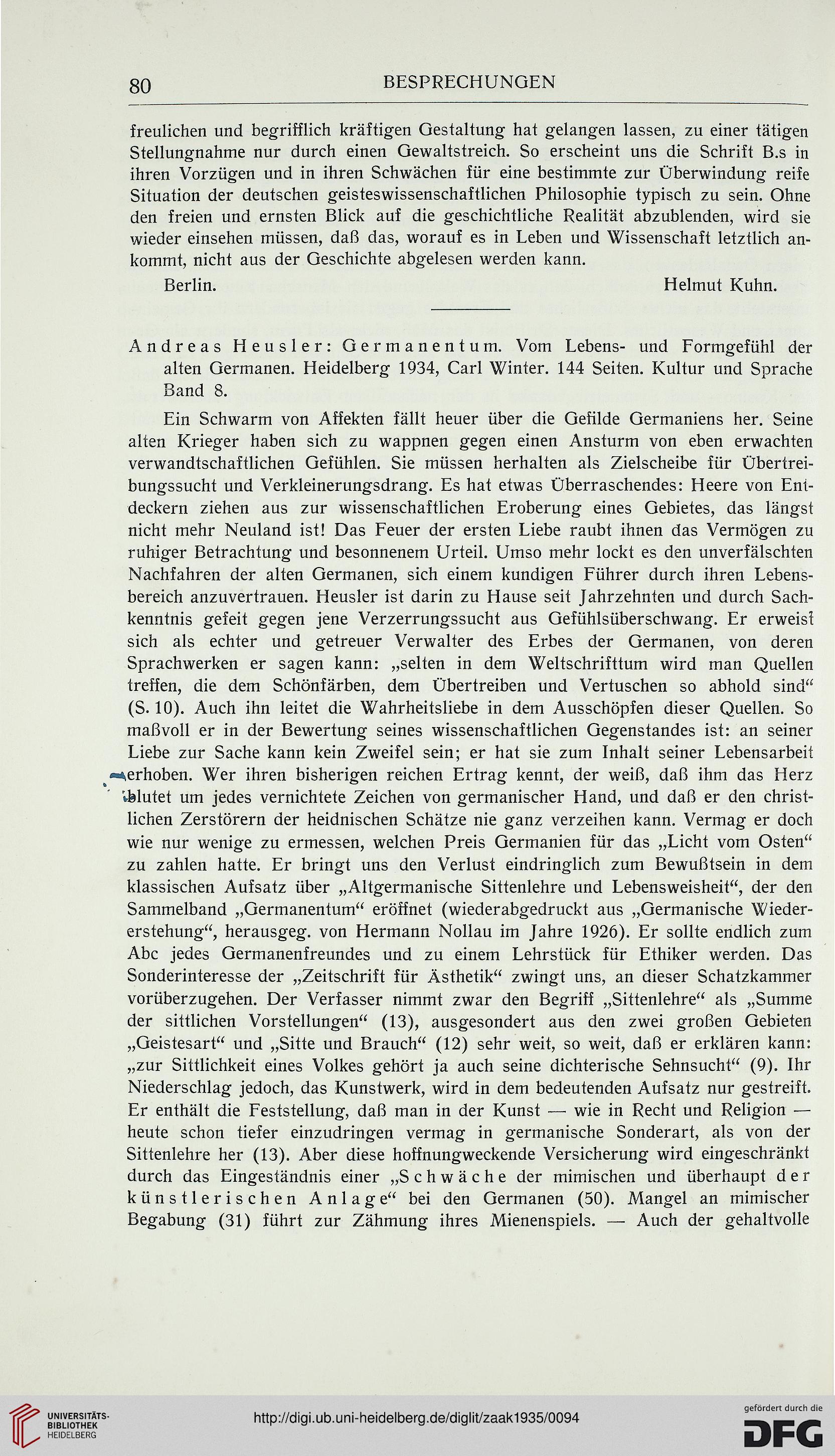80
BESPRECHUNGEN
freulichen und begrifflich kräftigen Gestaltung hat gelangen lassen, zu einer tätigen
Stellungnahme nur durch einen Gewaltstreich. So erscheint uns die Schrift B.s in
ihren Vorzügen und in ihren Schwächen für eine bestimmte zur Überwindung reife
Situation der deutschen geisteswissenschaftlichen Philosophie typisch zu sein. Ohne
den freien und ernsten Blick auf die geschichtliche Realität abzublenden, wird sie
wieder einsehen müssen, daß das, worauf es in Leben und Wissenschaft letztlich an-
kommt, nicht aus der Geschichte abgelesen werden kann.
Berlin. Helmut Kuhn.
Andreas Heusler: Germanentum. Vom Lebens- und Formgefühl der
alten Germanen. Heidelberg 1934, Carl Winter. 144 Seiten. Kultur und Sprache
Band 8.
Ein Schwärm von Affekten fällt heuer über die Gefilde Germaniens her. Seine
alten Krieger haben sich zu wappnen gegen einen Ansturm von eben erwachten
verwandtschaftlichen Gefühlen. Sie müssen herhalten als Zielscheibe für Übertrei-
bungssucht und Verkleinerungsdrang. Es hat etwas Überraschendes: Heere von Ent-
deckern ziehen aus zur wissenschaftlichen Eroberung eines Gebietes, das längst
nicht mehr Neuland ist! Das Feuer der ersten Liebe raubt ihnen das Vermögen zu
ruhiger Betrachtung und besonnenem Urteil. Umso mehr lockt es den unverfälschten
Nachfahren der alten Germanen, sich einem kundigen Führer durch ihren Lebens-
bereich anzuvertrauen. Heusler ist darin zu Hause seit Jahrzehnten und durch Sach-
kenntnis gefeit gegen jene Verzerrungssucht aus Gefühlsüberschwang. Er erweist
sich als echter und getreuer Verwalter des Erbes der Germanen, von deren
Sprachwerken er sagen kann: „selten in dem Weltschrifttum wird man Quellen
treffen, die dem Schönfärben, dem Übertreiben und Vertuschen so abhold sind"
(S. 10). Auch ihn leitet die Wahrheitsliebe in dem Ausschöpfen dieser Quellen. So
maßvoll er in der Bewertung seines wissenschaftlichen Gegenstandes ist: an seiner
Liebe zur Sache kann kein Zweifel sein; er hat sie zum Inhalt seiner Lebensarbeit
^erhoben. Wer ihren bisherigen reichen Ertrag kennt, der weiß, daß ihm das Herz
Vblutet um jedes vernichtete Zeichen von germanischer Hand, und daß er den christ-
lichen Zerstörern der heidnischen Schätze nie ganz verzeihen kann. Vermag er doch
wie nur wenige zu ermessen, welchen Preis Germanien für das „Licht vom Osten"
zu zahlen hatte. Er bringt uns den Verlust eindringlich zum Bewußtsein in dem
klassischen Aufsatz über „Altgermanische Sittenlehre und Lebensweisheit", der den
Sammelband „Germanentum" eröffnet (wiederabgedruckt aus „Germanische Wieder-
erstehung", herausgeg. von Hermann Nollau im Jahre 1926). Er sollte endlich zum
Abc jedes Germanenfreundes und zu einem Lehrstück für Ethiker werden. Das
Sonderinteresse der „Zeitschrift für Ästhetik" zwingt uns, an dieser Schatzkammer
vorüberzugehen. Der Verfasser nimmt zwar den Begriff „Sittenlehre" als „Summe
der sittlichen Vorstellungen" (13), ausgesondert aus den zwei großen Gebieten
„Geistesart" und „Sitte und Brauch" (12) sehr weit, so weit, daß er erklären kann:
„zur Sittlichkeit eines Volkes gehört ja auch seine dichterische Sehnsucht" (9). Ihr
Niederschlag jedoch, das Kunstwerk, wird in dem bedeutenden Aufsatz nur gestreift.
Er enthält die Feststellung, daß man in der Kunst — wie in Recht und Religion —
heute schon tiefer einzudringen vermag in germanische Sonderart, als von der
Sittenlehre her (13). Aber diese hoffnungweckende Versicherung wird eingeschränkt
durch das Eingeständnis einer „S c h w ä c h e der mimischen und überhaupt der
künstlerischen Anlage" bei den Germanen (50). Mangel an mimischer
Begabung (31) führt zur Zähmung ihres Mienenspiels. — Auch der gehaltvolle
BESPRECHUNGEN
freulichen und begrifflich kräftigen Gestaltung hat gelangen lassen, zu einer tätigen
Stellungnahme nur durch einen Gewaltstreich. So erscheint uns die Schrift B.s in
ihren Vorzügen und in ihren Schwächen für eine bestimmte zur Überwindung reife
Situation der deutschen geisteswissenschaftlichen Philosophie typisch zu sein. Ohne
den freien und ernsten Blick auf die geschichtliche Realität abzublenden, wird sie
wieder einsehen müssen, daß das, worauf es in Leben und Wissenschaft letztlich an-
kommt, nicht aus der Geschichte abgelesen werden kann.
Berlin. Helmut Kuhn.
Andreas Heusler: Germanentum. Vom Lebens- und Formgefühl der
alten Germanen. Heidelberg 1934, Carl Winter. 144 Seiten. Kultur und Sprache
Band 8.
Ein Schwärm von Affekten fällt heuer über die Gefilde Germaniens her. Seine
alten Krieger haben sich zu wappnen gegen einen Ansturm von eben erwachten
verwandtschaftlichen Gefühlen. Sie müssen herhalten als Zielscheibe für Übertrei-
bungssucht und Verkleinerungsdrang. Es hat etwas Überraschendes: Heere von Ent-
deckern ziehen aus zur wissenschaftlichen Eroberung eines Gebietes, das längst
nicht mehr Neuland ist! Das Feuer der ersten Liebe raubt ihnen das Vermögen zu
ruhiger Betrachtung und besonnenem Urteil. Umso mehr lockt es den unverfälschten
Nachfahren der alten Germanen, sich einem kundigen Führer durch ihren Lebens-
bereich anzuvertrauen. Heusler ist darin zu Hause seit Jahrzehnten und durch Sach-
kenntnis gefeit gegen jene Verzerrungssucht aus Gefühlsüberschwang. Er erweist
sich als echter und getreuer Verwalter des Erbes der Germanen, von deren
Sprachwerken er sagen kann: „selten in dem Weltschrifttum wird man Quellen
treffen, die dem Schönfärben, dem Übertreiben und Vertuschen so abhold sind"
(S. 10). Auch ihn leitet die Wahrheitsliebe in dem Ausschöpfen dieser Quellen. So
maßvoll er in der Bewertung seines wissenschaftlichen Gegenstandes ist: an seiner
Liebe zur Sache kann kein Zweifel sein; er hat sie zum Inhalt seiner Lebensarbeit
^erhoben. Wer ihren bisherigen reichen Ertrag kennt, der weiß, daß ihm das Herz
Vblutet um jedes vernichtete Zeichen von germanischer Hand, und daß er den christ-
lichen Zerstörern der heidnischen Schätze nie ganz verzeihen kann. Vermag er doch
wie nur wenige zu ermessen, welchen Preis Germanien für das „Licht vom Osten"
zu zahlen hatte. Er bringt uns den Verlust eindringlich zum Bewußtsein in dem
klassischen Aufsatz über „Altgermanische Sittenlehre und Lebensweisheit", der den
Sammelband „Germanentum" eröffnet (wiederabgedruckt aus „Germanische Wieder-
erstehung", herausgeg. von Hermann Nollau im Jahre 1926). Er sollte endlich zum
Abc jedes Germanenfreundes und zu einem Lehrstück für Ethiker werden. Das
Sonderinteresse der „Zeitschrift für Ästhetik" zwingt uns, an dieser Schatzkammer
vorüberzugehen. Der Verfasser nimmt zwar den Begriff „Sittenlehre" als „Summe
der sittlichen Vorstellungen" (13), ausgesondert aus den zwei großen Gebieten
„Geistesart" und „Sitte und Brauch" (12) sehr weit, so weit, daß er erklären kann:
„zur Sittlichkeit eines Volkes gehört ja auch seine dichterische Sehnsucht" (9). Ihr
Niederschlag jedoch, das Kunstwerk, wird in dem bedeutenden Aufsatz nur gestreift.
Er enthält die Feststellung, daß man in der Kunst — wie in Recht und Religion —
heute schon tiefer einzudringen vermag in germanische Sonderart, als von der
Sittenlehre her (13). Aber diese hoffnungweckende Versicherung wird eingeschränkt
durch das Eingeständnis einer „S c h w ä c h e der mimischen und überhaupt der
künstlerischen Anlage" bei den Germanen (50). Mangel an mimischer
Begabung (31) führt zur Zähmung ihres Mienenspiels. — Auch der gehaltvolle