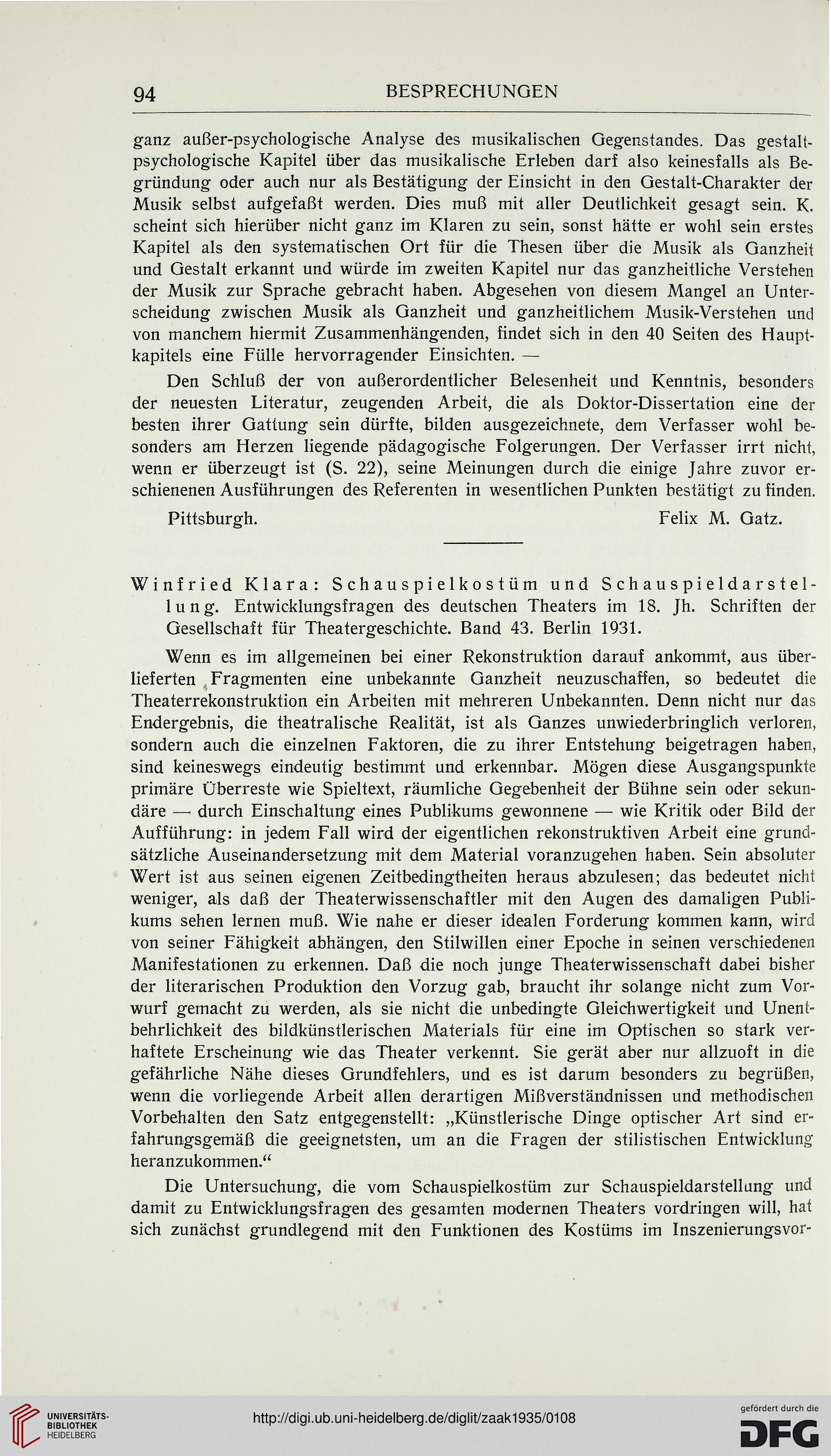94
BESPRECHUNGEN
ganz außer-psychologische Analyse des musikalischen Gegenstandes. Das gestalt-
psychologische Kapitel über das musikalische Erleben darf also keinesfalls als Be-
gründung oder auch nur als Bestätigung der Einsicht in den Gestalt-Charakter der
Musik selbst aufgefaßt werden. Dies muß mit aller Deutlichkeit gesagt sein. K.
scheint sich hierüber nicht ganz im Klaren zu sein, sonst hätte er wohl sein erstes
Kapitel als den systematischen Ort für die Thesen über die Musik als Ganzheit
und Gestalt erkannt und würde im zweiten Kapitel nur das ganzheitliche Verstehen
der Musik zur Sprache gebracht haben. Abgesehen von diesem Mangel an Unter-
scheidung zwischen Musik als Ganzheit und ganzheitlichem Musik-Verstehen und
von manchem hiermit Zusammenhängenden, findet sich in den 40 Seiten des Haupt-
kapitels eine Fülle hervorragender Einsichten. —
Den Schluß der von außerordentlicher Belesenheit und Kenntnis, besonders
der neuesten Literatur, zeugenden Arbeit, die als Doktor-Dissertation eine der
besten ihrer Gattung sein dürfte, bilden ausgezeichnete, dem Verfasser wohl be-
sonders am Herzen liegende pädagogische Folgerungen. Der Verfasser irrt nicht,
wenn er überzeugt ist (S. 22), seine Meinungen durch die einige Jahre zuvor er-
schienenen Ausführungen des Referenten in wesentlichen Punkten bestätigt zu finden.
Pittsburgh. Felix M. Gatz.
Winfried Klara: S c h a u s p i e 1 k o s t ü m und S c h a u s p i e 1 d a r s t e 1-
lung. Entwicklungsfragen des deutschen Theaters im 18. Jh. Schriften der
Gesellschaft für Theatergeschichte. Band 43. Berlin 1931.
Wenn es im allgemeinen bei einer Rekonstruktion darauf ankommt, aus über-
lieferten , Fragmenten eine unbekannte Ganzheit neuzuschaffen, so bedeutet die
Theaterrekonstruktion ein Arbeiten mit mehreren Unbekannten. Denn nicht nur das
Endergebnis, die theatralische Realität, ist als Ganzes unwiederbringlich verloren,
sondern auch die einzelnen Faktoren, die zu ihrer Entstehung beigetragen haben,
sind keineswegs eindeutig bestimmt und erkennbar. Mögen diese Ausgangspunkte
primäre Überreste wie Spieltext, räumliche Gegebenheit der Bühne sein oder sekun-
däre — durch Einschaltung eines Publikums gewonnene —■ wie Kritik oder Bild der
Aufführung: in jedem Fall wird der eigentlichen rekonstruktiven Arbeit eine grund-
sätzliche Auseinandersetzung mit dem Material voranzugehen haben. Sein absoluter
Wert ist aus seinen eigenen Zeitbedingtheiten heraus abzulesen; das bedeutet nicht
weniger, als daß der Theaterwissenschaftler mit den Augen des damaligen Publi-
kums sehen lernen muß. Wie nahe er dieser idealen Forderung kommen kann, wird
von seiner Fähigkeit abhängen, den Stilwillen einer Epoche in seinen verschiedenen
Manifestationen zu erkennen. Daß die noch junge Theaterwissenschaft dabei bisher
der literarischen Produktion den Vorzug gab, braucht ihr solange nicht zum Vor-
wurf gemacht zu werden, als sie nicht die unbedingte Gleichwertigkeit und Unent-
behrlichkeit des bildkünstlerischen Materials für eine im Optischen so stark ver-
haftete Erscheinung wie das Theater verkennt. Sie gerät aber nur allzuoft in die
gefährliche Nähe dieses Grundfehlers, und es ist darum besonders zu begrüßen,
wenn die vorliegende Arbeit allen derartigen Mißverständnissen und methodischen
Vorbehalten den Satz entgegenstellt: „Künstlerische Dinge optischer Art sind er-
fahrungsgemäß die geeignetsten, um an die Fragen der stilistischen Entwicklung
heranzukommen."
Die Untersuchung, die vom Schauspielkostüm zur Schauspieldarstellung und
damit zu Entwicklungsfragen des gesamten modernen Theaters vordringen will, hat
sich zunächst grundlegend mit den Funktionen des Kostüms im Inszenierungsvor-
BESPRECHUNGEN
ganz außer-psychologische Analyse des musikalischen Gegenstandes. Das gestalt-
psychologische Kapitel über das musikalische Erleben darf also keinesfalls als Be-
gründung oder auch nur als Bestätigung der Einsicht in den Gestalt-Charakter der
Musik selbst aufgefaßt werden. Dies muß mit aller Deutlichkeit gesagt sein. K.
scheint sich hierüber nicht ganz im Klaren zu sein, sonst hätte er wohl sein erstes
Kapitel als den systematischen Ort für die Thesen über die Musik als Ganzheit
und Gestalt erkannt und würde im zweiten Kapitel nur das ganzheitliche Verstehen
der Musik zur Sprache gebracht haben. Abgesehen von diesem Mangel an Unter-
scheidung zwischen Musik als Ganzheit und ganzheitlichem Musik-Verstehen und
von manchem hiermit Zusammenhängenden, findet sich in den 40 Seiten des Haupt-
kapitels eine Fülle hervorragender Einsichten. —
Den Schluß der von außerordentlicher Belesenheit und Kenntnis, besonders
der neuesten Literatur, zeugenden Arbeit, die als Doktor-Dissertation eine der
besten ihrer Gattung sein dürfte, bilden ausgezeichnete, dem Verfasser wohl be-
sonders am Herzen liegende pädagogische Folgerungen. Der Verfasser irrt nicht,
wenn er überzeugt ist (S. 22), seine Meinungen durch die einige Jahre zuvor er-
schienenen Ausführungen des Referenten in wesentlichen Punkten bestätigt zu finden.
Pittsburgh. Felix M. Gatz.
Winfried Klara: S c h a u s p i e 1 k o s t ü m und S c h a u s p i e 1 d a r s t e 1-
lung. Entwicklungsfragen des deutschen Theaters im 18. Jh. Schriften der
Gesellschaft für Theatergeschichte. Band 43. Berlin 1931.
Wenn es im allgemeinen bei einer Rekonstruktion darauf ankommt, aus über-
lieferten , Fragmenten eine unbekannte Ganzheit neuzuschaffen, so bedeutet die
Theaterrekonstruktion ein Arbeiten mit mehreren Unbekannten. Denn nicht nur das
Endergebnis, die theatralische Realität, ist als Ganzes unwiederbringlich verloren,
sondern auch die einzelnen Faktoren, die zu ihrer Entstehung beigetragen haben,
sind keineswegs eindeutig bestimmt und erkennbar. Mögen diese Ausgangspunkte
primäre Überreste wie Spieltext, räumliche Gegebenheit der Bühne sein oder sekun-
däre — durch Einschaltung eines Publikums gewonnene —■ wie Kritik oder Bild der
Aufführung: in jedem Fall wird der eigentlichen rekonstruktiven Arbeit eine grund-
sätzliche Auseinandersetzung mit dem Material voranzugehen haben. Sein absoluter
Wert ist aus seinen eigenen Zeitbedingtheiten heraus abzulesen; das bedeutet nicht
weniger, als daß der Theaterwissenschaftler mit den Augen des damaligen Publi-
kums sehen lernen muß. Wie nahe er dieser idealen Forderung kommen kann, wird
von seiner Fähigkeit abhängen, den Stilwillen einer Epoche in seinen verschiedenen
Manifestationen zu erkennen. Daß die noch junge Theaterwissenschaft dabei bisher
der literarischen Produktion den Vorzug gab, braucht ihr solange nicht zum Vor-
wurf gemacht zu werden, als sie nicht die unbedingte Gleichwertigkeit und Unent-
behrlichkeit des bildkünstlerischen Materials für eine im Optischen so stark ver-
haftete Erscheinung wie das Theater verkennt. Sie gerät aber nur allzuoft in die
gefährliche Nähe dieses Grundfehlers, und es ist darum besonders zu begrüßen,
wenn die vorliegende Arbeit allen derartigen Mißverständnissen und methodischen
Vorbehalten den Satz entgegenstellt: „Künstlerische Dinge optischer Art sind er-
fahrungsgemäß die geeignetsten, um an die Fragen der stilistischen Entwicklung
heranzukommen."
Die Untersuchung, die vom Schauspielkostüm zur Schauspieldarstellung und
damit zu Entwicklungsfragen des gesamten modernen Theaters vordringen will, hat
sich zunächst grundlegend mit den Funktionen des Kostüms im Inszenierungsvor-