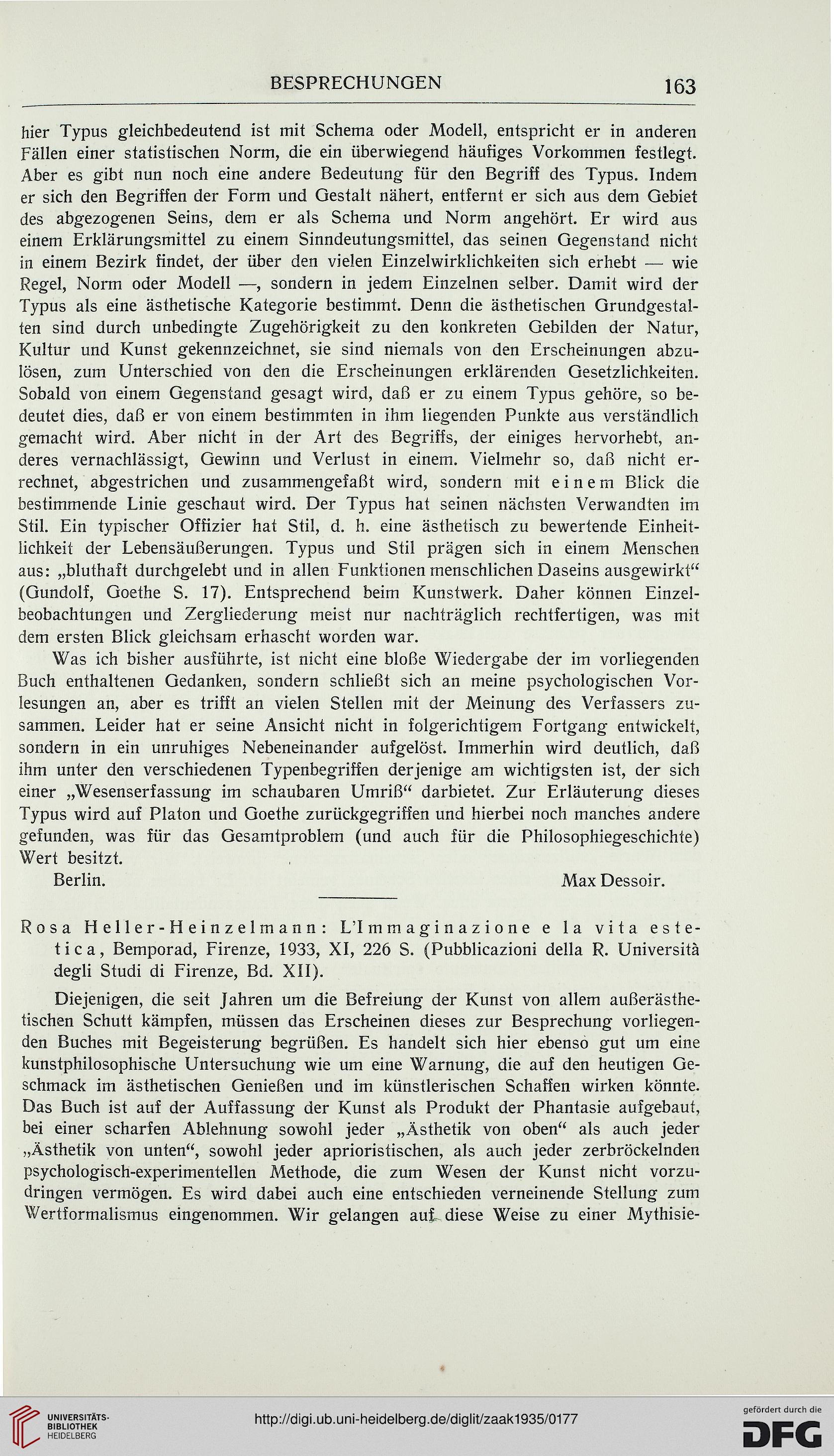BESPRECHUNGEN
163
hier Typus gleichbedeutend ist mit Schema oder Modell, entspricht er in anderen
Fällen einer statistischen Norm, die ein überwiegend häufiges Vorkommen festlegt.
Aber es gibt nun noch eine andere Bedeutung für den Begriff des Typus. Indem
er sich den Begriffen der Form und Gestalt nähert, entfernt er sich aus dem Gebiet
des abgezogenen Seins, dem er als Schema und Norm angehört. Er wird aus
einem Erklärungsmittel zu einem Sinndeutungsmittel, das seinen Gegenstand nicht
in einem Bezirk findet, der über den vielen Einzelwirklichkeiten sich erhebt — wie
Regel, Nonn oder Modell —, sondern in jedem Einzelnen selber. Damit wird der
Typus als eine ästhetische Kategorie bestimmt. Denn die ästhetischen Grundgestal-
ten sind durch unbedingte Zugehörigkeit zu den konkreten Gebilden der Natur,
Kultur und Kunst gekennzeichnet, sie sind niemals von den Erscheinungen abzu-
lösen, zum Unterschied von den die Erscheinungen erklärenden Gesetzlichkeiten.
Sobald von einem Gegenstand gesagt wird, daß er zu einem Typus gehöre, so be-
deutet dies, daß er von einem bestimmten in ihm liegenden Punkte aus verständlich
gemacht wird. Aber nicht in der Art des Begriffs, der einiges hervorhebt, an-
deres vernachlässigt, Gewinn und Verlust in einem. Vielmehr so, daß nicht er-
rechnet, abgestrichen und zusammengefaßt wird, sondern mit einem Blick die
bestimmende Linie geschaut wird. Der Typus hat seinen nächsten Verwandten im
Stil. Ein typischer Offizier hat Stil, d. h. eine ästhetisch zu bewertende Einheit-
lichkeit der Lebensäußerungen. Typus und Stil prägen sich in einem Menschen
aus: „bluthaft durchgelebt und in allen Funktionen menschlichen Daseins ausgewirkt"
(Gundolf, Goethe S. 17). Entsprechend beim Kunstwerk. Daher können Einzel-
beobachtungen und Zergliederung meist nur nachträglich rechtfertigen, was mit
dem ersten Blick gleichsam erhascht worden war.
Was ich bisher ausführte, ist nicht eine bloße Wiedergabe der im vorliegenden
Buch enthaltenen Gedanken, sondern schließt sich an meine psychologischen Vor-
lesungen an, aber es trifft an vielen Stellen mit der Meinung des Verfassers zu-
sammen. Leider hat er seine Ansicht nicht in folgerichtigem Fortgang entwickelt,
sondern in ein unruhiges Nebeneinander aufgelöst. Immerhin wird deutlich, daß
ihm unter den verschiedenen Typenbegriffen derjenige am wichtigsten ist, der sich
einer „Wesenserfassung im schaubaren Umriß" darbietet. Zur Erläuterung dieses
Typus wird auf Piaton und Goethe zurückgegriffen und hierbei noch manches andere
gefunden, was für das Gesamtproblem (und auch für die Philosophiegeschichte)
Wert besitzt.
Berlin. Max Dessoir.
Rosa Heller-Heinzelmann: LTmmaginazione e la vita este-
tica, Bemporad, Firenze, 1933, XI, 226 S. (Pubblicazioni della R. Universitä
degli Studi di Firenze, Bd. XII).
Diejenigen, die seit Jahren um die Befreiung der Kunst von allem außerästhe-
tischen Schutt kämpfen, müssen das Erscheinen dieses zur Besprechung vorliegen-
den Buches mit Begeisterung begrüßen. Es handelt sich hier ebenso gut um eine
kunstphilosophische Untersuchung wie um eine Warnung, die auf den heutigen Ge-
schmack im ästhetischen Genießen und im künstlerischen Schaffen wirken könnte.
Das Buch ist auf der Auffassung der Kunst als Produkt der Phantasie aufgebaut,
bei einer scharfen Ablehnung sowohl jeder „Ästhetik von oben" als auch jeder
„Ästhetik von unten", sowohl jeder aprioristischen, als auch jeder zerbröckelnden
psychologisch-experimentellen Methode, die zum Wesen der Kunst nicht vorzu-
dringen vermögen. Es wird dabei auch eine entschieden verneinende Stellung zum
Wertformalismus eingenommen. Wir gelangen auf diese Weise zu einer Mythisie-
163
hier Typus gleichbedeutend ist mit Schema oder Modell, entspricht er in anderen
Fällen einer statistischen Norm, die ein überwiegend häufiges Vorkommen festlegt.
Aber es gibt nun noch eine andere Bedeutung für den Begriff des Typus. Indem
er sich den Begriffen der Form und Gestalt nähert, entfernt er sich aus dem Gebiet
des abgezogenen Seins, dem er als Schema und Norm angehört. Er wird aus
einem Erklärungsmittel zu einem Sinndeutungsmittel, das seinen Gegenstand nicht
in einem Bezirk findet, der über den vielen Einzelwirklichkeiten sich erhebt — wie
Regel, Nonn oder Modell —, sondern in jedem Einzelnen selber. Damit wird der
Typus als eine ästhetische Kategorie bestimmt. Denn die ästhetischen Grundgestal-
ten sind durch unbedingte Zugehörigkeit zu den konkreten Gebilden der Natur,
Kultur und Kunst gekennzeichnet, sie sind niemals von den Erscheinungen abzu-
lösen, zum Unterschied von den die Erscheinungen erklärenden Gesetzlichkeiten.
Sobald von einem Gegenstand gesagt wird, daß er zu einem Typus gehöre, so be-
deutet dies, daß er von einem bestimmten in ihm liegenden Punkte aus verständlich
gemacht wird. Aber nicht in der Art des Begriffs, der einiges hervorhebt, an-
deres vernachlässigt, Gewinn und Verlust in einem. Vielmehr so, daß nicht er-
rechnet, abgestrichen und zusammengefaßt wird, sondern mit einem Blick die
bestimmende Linie geschaut wird. Der Typus hat seinen nächsten Verwandten im
Stil. Ein typischer Offizier hat Stil, d. h. eine ästhetisch zu bewertende Einheit-
lichkeit der Lebensäußerungen. Typus und Stil prägen sich in einem Menschen
aus: „bluthaft durchgelebt und in allen Funktionen menschlichen Daseins ausgewirkt"
(Gundolf, Goethe S. 17). Entsprechend beim Kunstwerk. Daher können Einzel-
beobachtungen und Zergliederung meist nur nachträglich rechtfertigen, was mit
dem ersten Blick gleichsam erhascht worden war.
Was ich bisher ausführte, ist nicht eine bloße Wiedergabe der im vorliegenden
Buch enthaltenen Gedanken, sondern schließt sich an meine psychologischen Vor-
lesungen an, aber es trifft an vielen Stellen mit der Meinung des Verfassers zu-
sammen. Leider hat er seine Ansicht nicht in folgerichtigem Fortgang entwickelt,
sondern in ein unruhiges Nebeneinander aufgelöst. Immerhin wird deutlich, daß
ihm unter den verschiedenen Typenbegriffen derjenige am wichtigsten ist, der sich
einer „Wesenserfassung im schaubaren Umriß" darbietet. Zur Erläuterung dieses
Typus wird auf Piaton und Goethe zurückgegriffen und hierbei noch manches andere
gefunden, was für das Gesamtproblem (und auch für die Philosophiegeschichte)
Wert besitzt.
Berlin. Max Dessoir.
Rosa Heller-Heinzelmann: LTmmaginazione e la vita este-
tica, Bemporad, Firenze, 1933, XI, 226 S. (Pubblicazioni della R. Universitä
degli Studi di Firenze, Bd. XII).
Diejenigen, die seit Jahren um die Befreiung der Kunst von allem außerästhe-
tischen Schutt kämpfen, müssen das Erscheinen dieses zur Besprechung vorliegen-
den Buches mit Begeisterung begrüßen. Es handelt sich hier ebenso gut um eine
kunstphilosophische Untersuchung wie um eine Warnung, die auf den heutigen Ge-
schmack im ästhetischen Genießen und im künstlerischen Schaffen wirken könnte.
Das Buch ist auf der Auffassung der Kunst als Produkt der Phantasie aufgebaut,
bei einer scharfen Ablehnung sowohl jeder „Ästhetik von oben" als auch jeder
„Ästhetik von unten", sowohl jeder aprioristischen, als auch jeder zerbröckelnden
psychologisch-experimentellen Methode, die zum Wesen der Kunst nicht vorzu-
dringen vermögen. Es wird dabei auch eine entschieden verneinende Stellung zum
Wertformalismus eingenommen. Wir gelangen auf diese Weise zu einer Mythisie-