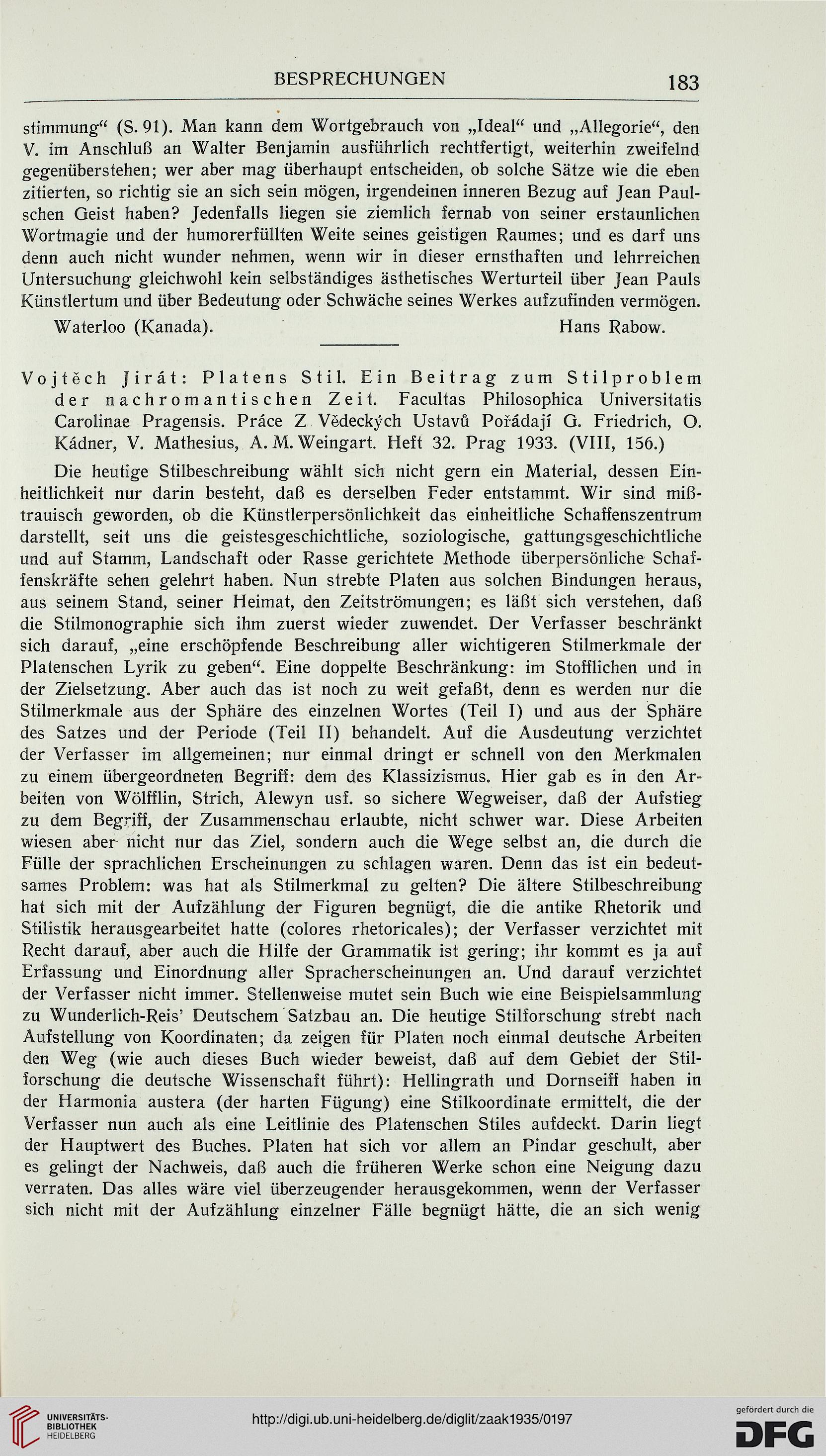BESPRECHUNGEN
183
Stimmung" (S. 91). Man kann dem Wortgebrauch von „Ideal" und „Allegorie", den
V. im Anschluß an Walter Benjamin ausführlich rechtfertigt, weiterhin zweifelnd
gegenüberstehen; wer aber mag überhaupt entscheiden, ob solche Sätze wie die eben
zitierten, so richtig sie an sich sein mögen, irgendeinen inneren Bezug auf Jean Paul-
schen Geist haben? Jedenfalls liegen sie ziemlich fernab von seiner erstaunlichen
Wortmagie und der humorerfüllten Weite seines geistigen Raumes; und es darf uns
denn auch nicht wunder nehmen, wenn wir in dieser ernsthaften und lehrreichen
Untersuchung gleichwohl kein selbständiges ästhetisches Werturteil über Jean Pauls
Künstlertum und über Bedeutung oder Schwäche seines Werkes aufzufinden vermögen.
Waterloo (Kanada). Hans Rabow.
Vojtech Jirät: Platens Stil. Ein Beitrag zum Stilproblem
der nachromantischen Zeit. Facultas Philosophica Universitatis
Carolinae Pragensis. Präce Z Vedeckych Ustavü Porädaji G. Friedrich, O.
Kädner, V. Mathesius, A. M. Weingart. Heft 32. Prag 1933. (VIII, 156.)
Die heutige Stilbeschreibung wählt sich nicht gern ein Material, dessen Ein-
heitlichkeit nur darin besteht, daß es derselben Feder entstammt. Wir sind miß-
trauisch geworden, ob die Künstlerpersönlichkeit das einheitliche Schaffenszentrum
darstellt, seit uns die geistesgeschichtliche, soziologische, gattungsgeschichtliche
und auf Stamm, Landschaft oder Rasse gerichtete Methode überpersönliche Schaf-
fenskräfte sehen gelehrt haben. Nun strebte Platen aus solchen Bindungen heraus,
aus seinem Stand, seiner Heimat, den Zeitströmungen; es läßt sich verstehen, daß
die Stilmonographie sich ihm zuerst wieder zuwendet. Der Verfasser beschränkt
sich darauf, „eine erschöpfende Beschreibung aller wichtigeren Stilmerkmale der
Platenschen Lyrik zu geben". Eine doppelte Beschränkung: im Stofflichen und in
der Zielsetzung. Aber auch das ist noch zu weit gefaßt, denn es werden nur die
Stilmerkmale aus der Sphäre des einzelnen Wortes (Teil I) und aus der Sphäre
des Satzes und der Periode (Teil II) behandelt. Auf die Ausdeutung verzichtet
der Verfasser im allgemeinen; nur einmal dringt er schnell von den Merkmalen
zu einem übergeordneten Begriff: dem des Klassizismus. Hier gab es in den Ar-
beiten von Wölfflin, Strich, Alewyn usf. so sichere Wegweiser, daß der Aufstieg
zu dem Begriff, der Zusammenschau erlaubte, nicht schwer war. Diese Arbeiten
wiesen aber nicht nur das Ziel, sondern auch die Wege selbst an, die durch die
Fülle der sprachlichen Erscheinungen zu schlagen waren. Denn das ist ein bedeut-
sames Problem: was hat als Stilmerkmal zu gelten? Die ältere Stilbeschreibung
hat sich mit der Aufzählung der Figuren begnügt, die die antike Rhetorik und
Stilistik herausgearbeitet hatte (colores rhetoricales); der Verfasser verzichtet mit
Recht darauf, aber auch die Hilfe der Grammatik ist gering; ihr kommt es ja auf
Erfassung und Einordnung aller Spracherscheinungen an. Und darauf verzichtet
der Verfasser nicht immer. Stellenweise mutet sein Buch wie eine Beispielsammlung
zu Wunderlich-Reis' Deutschem Satzbau an. Die heutige Stilforschung strebt nach
Aufstellung von Koordinaten; da zeigen für Platen noch einmal deutsche Arbeiten
den Weg (wie auch dieses Buch wieder beweist, daß auf dem Gebiet der Stil-
forschung die deutsche Wissenschaft führt): Hellingrath und Dornseiff haben in
der Harmonia austera (der harten Fügung) eine Stilkoordinate ermittelt, die der
Verfasser nun auch als eine Leitlinie des Platenschen Stiles aufdeckt. Darin liegt
der Hauptwert des Buches. Platen hat sich vor allem an Pindar geschult, aber
es gelingt der Nachweis, daß auch die früheren Werke schon eine Neigung dazu
verraten. Das alles wäre viel überzeugender herausgekommen, wenn der Verfasser
sich nicht mit der Aufzählung einzelner Fälle begnügt hätte, die an sich wenig
183
Stimmung" (S. 91). Man kann dem Wortgebrauch von „Ideal" und „Allegorie", den
V. im Anschluß an Walter Benjamin ausführlich rechtfertigt, weiterhin zweifelnd
gegenüberstehen; wer aber mag überhaupt entscheiden, ob solche Sätze wie die eben
zitierten, so richtig sie an sich sein mögen, irgendeinen inneren Bezug auf Jean Paul-
schen Geist haben? Jedenfalls liegen sie ziemlich fernab von seiner erstaunlichen
Wortmagie und der humorerfüllten Weite seines geistigen Raumes; und es darf uns
denn auch nicht wunder nehmen, wenn wir in dieser ernsthaften und lehrreichen
Untersuchung gleichwohl kein selbständiges ästhetisches Werturteil über Jean Pauls
Künstlertum und über Bedeutung oder Schwäche seines Werkes aufzufinden vermögen.
Waterloo (Kanada). Hans Rabow.
Vojtech Jirät: Platens Stil. Ein Beitrag zum Stilproblem
der nachromantischen Zeit. Facultas Philosophica Universitatis
Carolinae Pragensis. Präce Z Vedeckych Ustavü Porädaji G. Friedrich, O.
Kädner, V. Mathesius, A. M. Weingart. Heft 32. Prag 1933. (VIII, 156.)
Die heutige Stilbeschreibung wählt sich nicht gern ein Material, dessen Ein-
heitlichkeit nur darin besteht, daß es derselben Feder entstammt. Wir sind miß-
trauisch geworden, ob die Künstlerpersönlichkeit das einheitliche Schaffenszentrum
darstellt, seit uns die geistesgeschichtliche, soziologische, gattungsgeschichtliche
und auf Stamm, Landschaft oder Rasse gerichtete Methode überpersönliche Schaf-
fenskräfte sehen gelehrt haben. Nun strebte Platen aus solchen Bindungen heraus,
aus seinem Stand, seiner Heimat, den Zeitströmungen; es läßt sich verstehen, daß
die Stilmonographie sich ihm zuerst wieder zuwendet. Der Verfasser beschränkt
sich darauf, „eine erschöpfende Beschreibung aller wichtigeren Stilmerkmale der
Platenschen Lyrik zu geben". Eine doppelte Beschränkung: im Stofflichen und in
der Zielsetzung. Aber auch das ist noch zu weit gefaßt, denn es werden nur die
Stilmerkmale aus der Sphäre des einzelnen Wortes (Teil I) und aus der Sphäre
des Satzes und der Periode (Teil II) behandelt. Auf die Ausdeutung verzichtet
der Verfasser im allgemeinen; nur einmal dringt er schnell von den Merkmalen
zu einem übergeordneten Begriff: dem des Klassizismus. Hier gab es in den Ar-
beiten von Wölfflin, Strich, Alewyn usf. so sichere Wegweiser, daß der Aufstieg
zu dem Begriff, der Zusammenschau erlaubte, nicht schwer war. Diese Arbeiten
wiesen aber nicht nur das Ziel, sondern auch die Wege selbst an, die durch die
Fülle der sprachlichen Erscheinungen zu schlagen waren. Denn das ist ein bedeut-
sames Problem: was hat als Stilmerkmal zu gelten? Die ältere Stilbeschreibung
hat sich mit der Aufzählung der Figuren begnügt, die die antike Rhetorik und
Stilistik herausgearbeitet hatte (colores rhetoricales); der Verfasser verzichtet mit
Recht darauf, aber auch die Hilfe der Grammatik ist gering; ihr kommt es ja auf
Erfassung und Einordnung aller Spracherscheinungen an. Und darauf verzichtet
der Verfasser nicht immer. Stellenweise mutet sein Buch wie eine Beispielsammlung
zu Wunderlich-Reis' Deutschem Satzbau an. Die heutige Stilforschung strebt nach
Aufstellung von Koordinaten; da zeigen für Platen noch einmal deutsche Arbeiten
den Weg (wie auch dieses Buch wieder beweist, daß auf dem Gebiet der Stil-
forschung die deutsche Wissenschaft führt): Hellingrath und Dornseiff haben in
der Harmonia austera (der harten Fügung) eine Stilkoordinate ermittelt, die der
Verfasser nun auch als eine Leitlinie des Platenschen Stiles aufdeckt. Darin liegt
der Hauptwert des Buches. Platen hat sich vor allem an Pindar geschult, aber
es gelingt der Nachweis, daß auch die früheren Werke schon eine Neigung dazu
verraten. Das alles wäre viel überzeugender herausgekommen, wenn der Verfasser
sich nicht mit der Aufzählung einzelner Fälle begnügt hätte, die an sich wenig