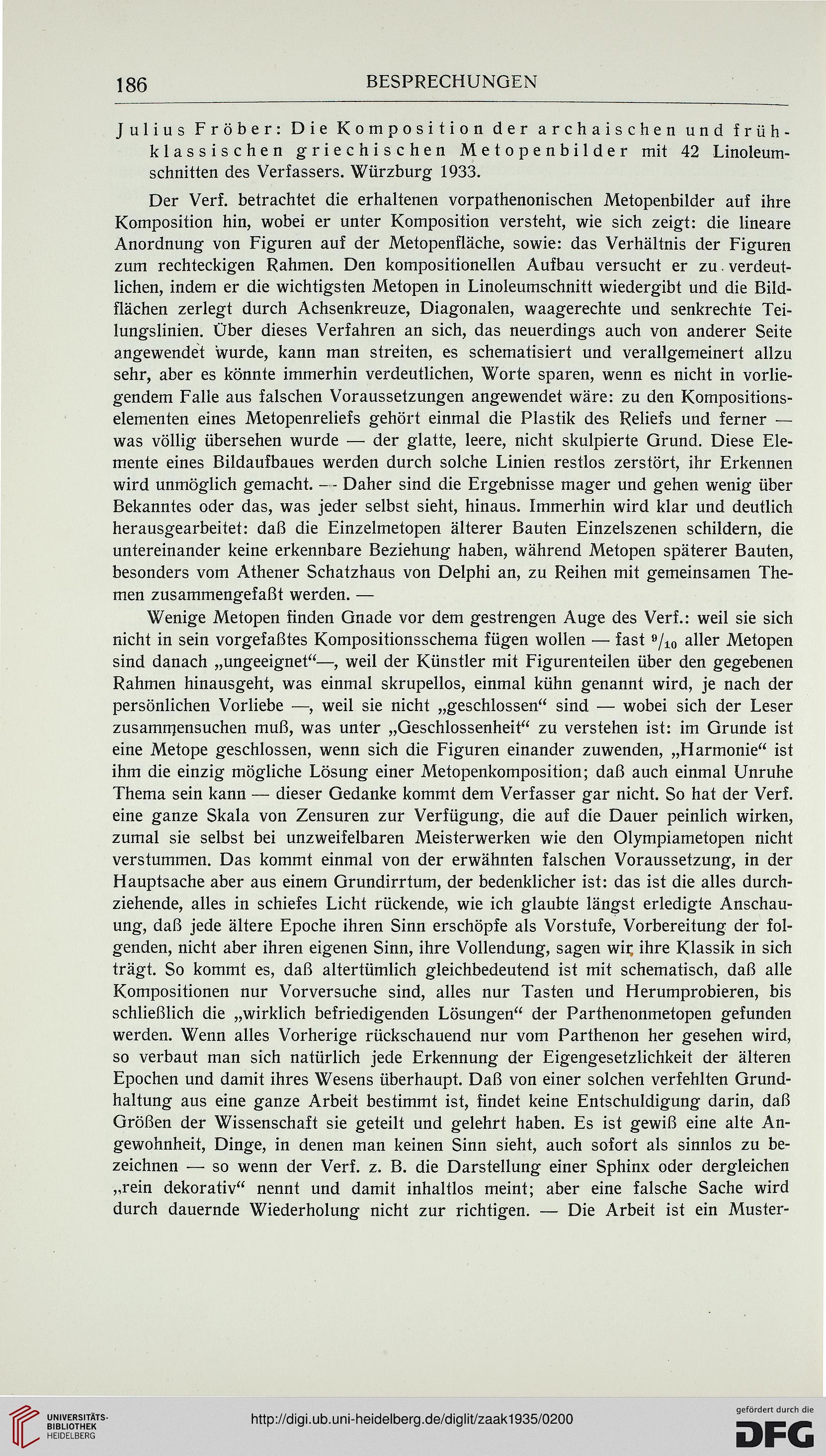186
BESPRECHUNGEN
Julius Fröber: Die Komposition der archaischen und früh-
klassischen griechischen Metopenbilder mit 42 Linoleum-
schnitten des Verfassers. Würzburg 1933.
Der Verf. betrachtet die erhaltenen vorpathenonischen Metopenbilder auf ihre
Komposition hin, wobei er unter Komposition versteht, wie sich zeigt: die lineare
Anordnung von Figuren auf der Metopenfläche, sowie: das Verhältnis der Figuren
zum rechteckigen Rahmen. Den kompositionellen Aufbau versucht er zu. verdeut-
lichen, indem er die wichtigsten Metopen in Linoleumschnitt wiedergibt und die Bild-
flächen zerlegt durch Achsenkreuze, Diagonalen, waagerechte und senkrechte Tei-
lungslinien. Über dieses Verfahren an sich, das neuerdings auch von anderer Seite
angewendet wurde, kann man streiten, es schematisiert und verallgemeinert allzu
sehr, aber es könnte immerhin verdeutlichen, Worte sparen, wenn es nicht in vorlie-
gendem Falle aus falschen Voraussetzungen angewendet wäre: zu den Kompositions-
elementen eines Metopenreliefs gehört einmal die Plastik des Reliefs und ferner —
was völlig übersehen wurde — der glatte, leere, nicht skulpierte Grund. Diese Ele-
mente eines Bildaufbaues werden durch solche Linien restlos zerstört, ihr Erkennen
wird unmöglich gemacht. - - Daher sind die Ergebnisse mager und gehen wenig über
Bekanntes oder das, was jeder selbst sieht, hinaus. Immerhin wird klar und deutlich
herausgearbeitet: daß die Einzelmetopen älterer Bauten Einzelszenen schildern, die
untereinander keine erkennbare Beziehung haben, während Metopen späterer Bauten,
besonders vom Athener Schatzhaus von Delphi an, zu Reihen mit gemeinsamen The-
men zusammengefaßt werden. —
Wenige Metopen finden Gnade vor dem gestrengen Auge des Verf.: weil sie sich
nicht in sein vorgefaßtes Kompositionsschema fügen wollen — fast 9/10 aller Metopen
sind danach „ungeeignet"—, weil der Künstler mit Figurenteilen über den gegebenen
Rahmen hinausgeht, was einmal skrupellos, einmal kühn genannt wird, je nach der
persönlichen Vorliebe —, weil sie nicht „geschlossen" sind — wobei sich der Leser
zusammensuchen muß, was unter „Geschlossenheit" zu verstehen ist: im Grunde ist
eine Metope geschlossen, wenn sich die Figuren einander zuwenden, „Harmonie" ist
ihm die einzig mögliche Lösung einer Metopenkomposition; daß auch einmal Unruhe
Thema sein kann — dieser Gedanke kommt dem Verfasser gar nicht. So hat der Verf.
eine ganze Skala von Zensuren zur Verfügung, die auf die Dauer peinlich wirken,
zumal sie selbst bei unzweifelbaren Meisterwerken wie den Olympiametopen nicht
verstummen. Das kommt einmal von der erwähnten falschen Voraussetzung, in der
Hauptsache aber aus einem Grundirrtum, der bedenklicher ist: das ist die alles durch-
ziehende, alles in schiefes Licht rückende, wie ich glaubte längst erledigte Anschau-
ung, daß jede ältere Epoche ihren Sinn erschöpfe als Vorstufe, Vorbereitung der fol-
genden, nicht aber ihren eigenen Sinn, ihre Vollendung, sagen wir ihre Klassik in sich
trägt. So kommt es, daß altertümlich gleichbedeutend ist mit schematisch, daß alle
Kompositionen nur Vorversuche sind, alles nur Tasten und Herumprobieren, bis
schließlich die „wirklich befriedigenden Lösungen" der Parthenonmetopen gefunden
werden. Wenn alles Vorherige rückschauend nur vom Parthenon her gesehen wird,
so verbaut man sich natürlich jede Erkennung der Eigengesetzlichkeit der älteren
Epochen und damit ihres Wesens überhaupt. Daß von einer solchen verfehlten Grund-
haltung aus eine ganze Arbeit bestimmt ist, findet keine Entschuldigung darin, daß
Größen der Wissenschaft sie geteilt und gelehrt haben. Es ist gewiß eine alte An-
gewohnheit, Dinge, in denen man keinen Sinn sieht, auch sofort als sinnlos zu be-
zeichnen — so wenn der Verf. z. B. die Darstellung einer Sphinx oder dergleichen
„rein dekorativ" nennt und damit inhaltlos meint; aber eine falsche Sache wird
durch dauernde Wiederholung nicht zur richtigen. — Die Arbeit ist ein Muster-
BESPRECHUNGEN
Julius Fröber: Die Komposition der archaischen und früh-
klassischen griechischen Metopenbilder mit 42 Linoleum-
schnitten des Verfassers. Würzburg 1933.
Der Verf. betrachtet die erhaltenen vorpathenonischen Metopenbilder auf ihre
Komposition hin, wobei er unter Komposition versteht, wie sich zeigt: die lineare
Anordnung von Figuren auf der Metopenfläche, sowie: das Verhältnis der Figuren
zum rechteckigen Rahmen. Den kompositionellen Aufbau versucht er zu. verdeut-
lichen, indem er die wichtigsten Metopen in Linoleumschnitt wiedergibt und die Bild-
flächen zerlegt durch Achsenkreuze, Diagonalen, waagerechte und senkrechte Tei-
lungslinien. Über dieses Verfahren an sich, das neuerdings auch von anderer Seite
angewendet wurde, kann man streiten, es schematisiert und verallgemeinert allzu
sehr, aber es könnte immerhin verdeutlichen, Worte sparen, wenn es nicht in vorlie-
gendem Falle aus falschen Voraussetzungen angewendet wäre: zu den Kompositions-
elementen eines Metopenreliefs gehört einmal die Plastik des Reliefs und ferner —
was völlig übersehen wurde — der glatte, leere, nicht skulpierte Grund. Diese Ele-
mente eines Bildaufbaues werden durch solche Linien restlos zerstört, ihr Erkennen
wird unmöglich gemacht. - - Daher sind die Ergebnisse mager und gehen wenig über
Bekanntes oder das, was jeder selbst sieht, hinaus. Immerhin wird klar und deutlich
herausgearbeitet: daß die Einzelmetopen älterer Bauten Einzelszenen schildern, die
untereinander keine erkennbare Beziehung haben, während Metopen späterer Bauten,
besonders vom Athener Schatzhaus von Delphi an, zu Reihen mit gemeinsamen The-
men zusammengefaßt werden. —
Wenige Metopen finden Gnade vor dem gestrengen Auge des Verf.: weil sie sich
nicht in sein vorgefaßtes Kompositionsschema fügen wollen — fast 9/10 aller Metopen
sind danach „ungeeignet"—, weil der Künstler mit Figurenteilen über den gegebenen
Rahmen hinausgeht, was einmal skrupellos, einmal kühn genannt wird, je nach der
persönlichen Vorliebe —, weil sie nicht „geschlossen" sind — wobei sich der Leser
zusammensuchen muß, was unter „Geschlossenheit" zu verstehen ist: im Grunde ist
eine Metope geschlossen, wenn sich die Figuren einander zuwenden, „Harmonie" ist
ihm die einzig mögliche Lösung einer Metopenkomposition; daß auch einmal Unruhe
Thema sein kann — dieser Gedanke kommt dem Verfasser gar nicht. So hat der Verf.
eine ganze Skala von Zensuren zur Verfügung, die auf die Dauer peinlich wirken,
zumal sie selbst bei unzweifelbaren Meisterwerken wie den Olympiametopen nicht
verstummen. Das kommt einmal von der erwähnten falschen Voraussetzung, in der
Hauptsache aber aus einem Grundirrtum, der bedenklicher ist: das ist die alles durch-
ziehende, alles in schiefes Licht rückende, wie ich glaubte längst erledigte Anschau-
ung, daß jede ältere Epoche ihren Sinn erschöpfe als Vorstufe, Vorbereitung der fol-
genden, nicht aber ihren eigenen Sinn, ihre Vollendung, sagen wir ihre Klassik in sich
trägt. So kommt es, daß altertümlich gleichbedeutend ist mit schematisch, daß alle
Kompositionen nur Vorversuche sind, alles nur Tasten und Herumprobieren, bis
schließlich die „wirklich befriedigenden Lösungen" der Parthenonmetopen gefunden
werden. Wenn alles Vorherige rückschauend nur vom Parthenon her gesehen wird,
so verbaut man sich natürlich jede Erkennung der Eigengesetzlichkeit der älteren
Epochen und damit ihres Wesens überhaupt. Daß von einer solchen verfehlten Grund-
haltung aus eine ganze Arbeit bestimmt ist, findet keine Entschuldigung darin, daß
Größen der Wissenschaft sie geteilt und gelehrt haben. Es ist gewiß eine alte An-
gewohnheit, Dinge, in denen man keinen Sinn sieht, auch sofort als sinnlos zu be-
zeichnen — so wenn der Verf. z. B. die Darstellung einer Sphinx oder dergleichen
„rein dekorativ" nennt und damit inhaltlos meint; aber eine falsche Sache wird
durch dauernde Wiederholung nicht zur richtigen. — Die Arbeit ist ein Muster-