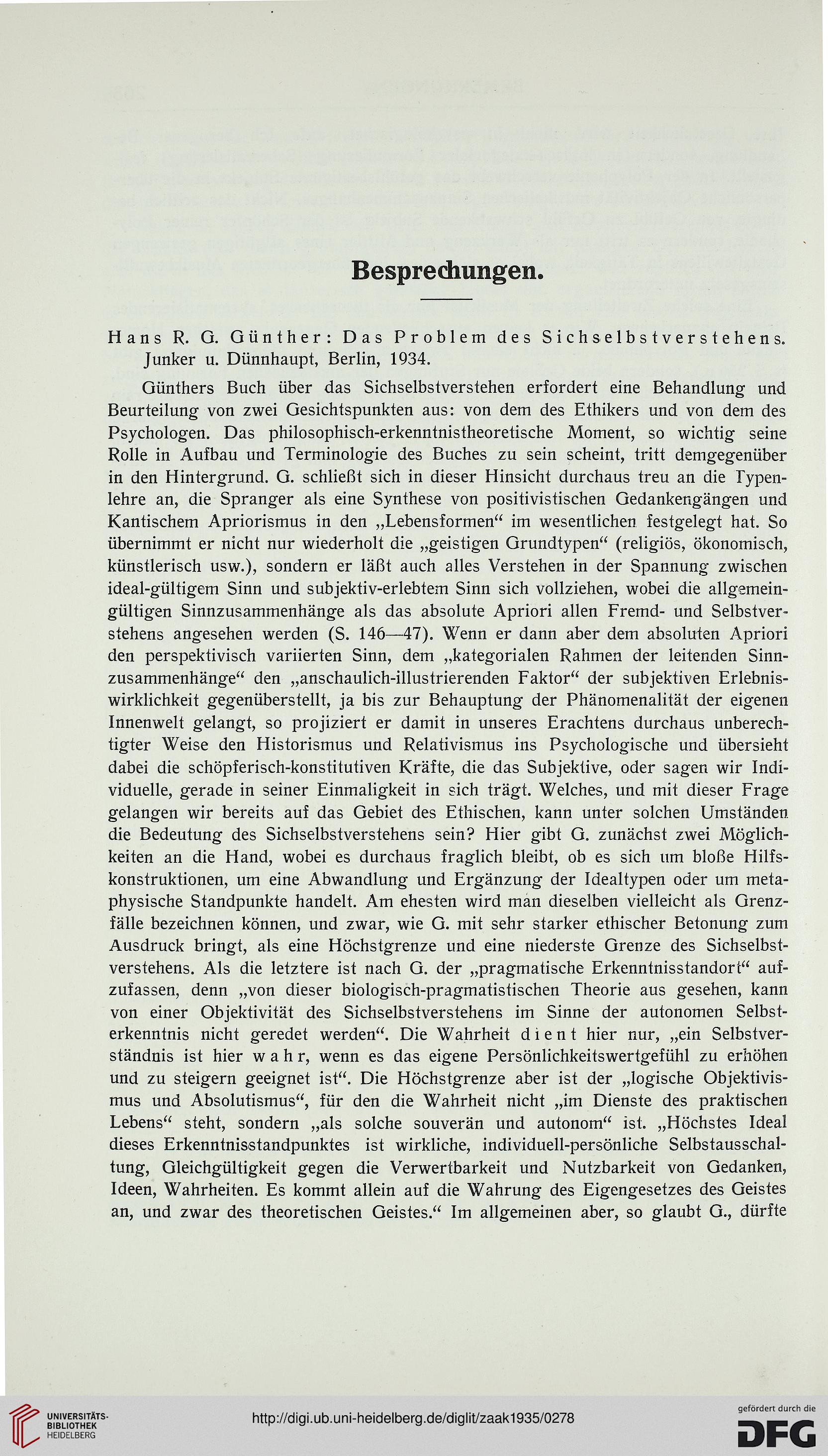Besprechungen.
Hans R. G. Günther: Das Problem des Sichselbstverstehens.
Junker u. Dünnhaupt, Berlin, 1934.
Günthers Buch über das Sichselbstverstehen erfordert eine Behandlung und
Beurteilung von zwei Gesichtspunkten aus: von dem des Ethikers und von dem des
Psychologen. Das philosophisch-erkenntnistheoretische Moment, so wichtig seine
Rolle in Aufbau und Terminologie des Buches zu sein scheint, tritt demgegenüber
in den Hintergrund. G. schließt sich in dieser Hinsicht durchaus treu an die lypen-
lehre an, die Spranger als eine Synthese von positivistischen Gedankengängen und
Kantischem Apriorismus in den Lebensformen" im wesentlichen festgelegt hat. So
übernimmt er nicht nur wiederholt die „geistigen Grundtypen" (religiös, ökonomisch,
künstlerisch usw.), sondern er läßt auch alles Verstehen in der Spannung zwischen
ideal-gültigem Sinn und subjektiv-erlebtem Sinn sich vollziehen, wobei die allgemein-
gültigen Sinnzusammenhänge als das absolute Apriori allen Fremd- und Selbstver-
stehens angesehen werden (S. 146—47). Wenn er dann aber dem absoluten Apriori
den perspektivisch variierten Sinn, dem „kategorialen Rahmen der leitenden Sinn-
zusammenhänge" den „anschaulich-illustrierenden Faktor" der subjektiven Erlebnis-
wirklichkeit gegenüberstellt, ja bis zur Behauptung der Phänomenalität der eigenen
Innenwelt gelangt, so projiziert er damit in unseres Erachtens durchaus unberech-
tigter Weise den Historismus und Relativismus ins Psychologische und übersieht
dabei die schöpferisch-konstitutiven Kräfte, die das Subjektive, oder sagen wir Indi-
viduelle, gerade in seiner Einmaligkeit in sich trägt. Welches, und mit dieser Frage
gelangen wir bereits auf das Gebiet des Ethischen, kann unter solchen Umständen
die Bedeutung des Sichselbstverstehens sein? Hier gibt G. zunächst zwei Möglich-
keiten an die Hand, wobei es durchaus fraglich bleibt, ob es sich um bloße Hilfs-
konstruktionen, um eine Abwandlung und Ergänzung der Idealtypen oder um meta-
physische Standpunkte handelt. Am ehesten wird man dieselben vielleicht als Grenz-
fälle bezeichnen können, und zwar, wie G. mit sehr starker ethischer Betonung zum
Ausdruck bringt, als eine Höchstgrenze und eine niederste Grenze des Sichselbst-
verstehens. Als die letztere ist nach G. der „pragmatische Erkenntnisstandort" auf-
zufassen, denn „von dieser biologisch-pragmatistischen Theorie aus gesehen, kann
von einer Objektivität des Sichselbstverstehens im Sinne der autonomen Selbst-
erkenntnis nicht geredet werden". Die Wahrheit dient hier nur, „ein Selbstver-
ständnis ist hier wahr, wenn es das eigene Persönlichkeitswertgefühl zu erhöhen
und zu steigern geeignet ist". Die Höchstgrenze aber ist der „logische Objektivis-
mus und Absolutismus", für den die Wahrheit nicht „im Dienste des praktischen
Lebens" steht, sondern „als solche souverän und autonom" ist. „Höchstes Ideal
dieses Erkenntnisstandpunktes ist wirkliche, individuell-persönliche Selbstausschal-
tung, Gleichgültigkeit gegen die Verwertbarkeit und Nutzbarkeit von Gedanken,
Ideen, Wahrheiten. Es kommt allein auf die Wahrung des Eigengesetzes des Geistes
an, und zwar des theoretischen Geistes." Im allgemeinen aber, so glaubt G., dürfte
Hans R. G. Günther: Das Problem des Sichselbstverstehens.
Junker u. Dünnhaupt, Berlin, 1934.
Günthers Buch über das Sichselbstverstehen erfordert eine Behandlung und
Beurteilung von zwei Gesichtspunkten aus: von dem des Ethikers und von dem des
Psychologen. Das philosophisch-erkenntnistheoretische Moment, so wichtig seine
Rolle in Aufbau und Terminologie des Buches zu sein scheint, tritt demgegenüber
in den Hintergrund. G. schließt sich in dieser Hinsicht durchaus treu an die lypen-
lehre an, die Spranger als eine Synthese von positivistischen Gedankengängen und
Kantischem Apriorismus in den Lebensformen" im wesentlichen festgelegt hat. So
übernimmt er nicht nur wiederholt die „geistigen Grundtypen" (religiös, ökonomisch,
künstlerisch usw.), sondern er läßt auch alles Verstehen in der Spannung zwischen
ideal-gültigem Sinn und subjektiv-erlebtem Sinn sich vollziehen, wobei die allgemein-
gültigen Sinnzusammenhänge als das absolute Apriori allen Fremd- und Selbstver-
stehens angesehen werden (S. 146—47). Wenn er dann aber dem absoluten Apriori
den perspektivisch variierten Sinn, dem „kategorialen Rahmen der leitenden Sinn-
zusammenhänge" den „anschaulich-illustrierenden Faktor" der subjektiven Erlebnis-
wirklichkeit gegenüberstellt, ja bis zur Behauptung der Phänomenalität der eigenen
Innenwelt gelangt, so projiziert er damit in unseres Erachtens durchaus unberech-
tigter Weise den Historismus und Relativismus ins Psychologische und übersieht
dabei die schöpferisch-konstitutiven Kräfte, die das Subjektive, oder sagen wir Indi-
viduelle, gerade in seiner Einmaligkeit in sich trägt. Welches, und mit dieser Frage
gelangen wir bereits auf das Gebiet des Ethischen, kann unter solchen Umständen
die Bedeutung des Sichselbstverstehens sein? Hier gibt G. zunächst zwei Möglich-
keiten an die Hand, wobei es durchaus fraglich bleibt, ob es sich um bloße Hilfs-
konstruktionen, um eine Abwandlung und Ergänzung der Idealtypen oder um meta-
physische Standpunkte handelt. Am ehesten wird man dieselben vielleicht als Grenz-
fälle bezeichnen können, und zwar, wie G. mit sehr starker ethischer Betonung zum
Ausdruck bringt, als eine Höchstgrenze und eine niederste Grenze des Sichselbst-
verstehens. Als die letztere ist nach G. der „pragmatische Erkenntnisstandort" auf-
zufassen, denn „von dieser biologisch-pragmatistischen Theorie aus gesehen, kann
von einer Objektivität des Sichselbstverstehens im Sinne der autonomen Selbst-
erkenntnis nicht geredet werden". Die Wahrheit dient hier nur, „ein Selbstver-
ständnis ist hier wahr, wenn es das eigene Persönlichkeitswertgefühl zu erhöhen
und zu steigern geeignet ist". Die Höchstgrenze aber ist der „logische Objektivis-
mus und Absolutismus", für den die Wahrheit nicht „im Dienste des praktischen
Lebens" steht, sondern „als solche souverän und autonom" ist. „Höchstes Ideal
dieses Erkenntnisstandpunktes ist wirkliche, individuell-persönliche Selbstausschal-
tung, Gleichgültigkeit gegen die Verwertbarkeit und Nutzbarkeit von Gedanken,
Ideen, Wahrheiten. Es kommt allein auf die Wahrung des Eigengesetzes des Geistes
an, und zwar des theoretischen Geistes." Im allgemeinen aber, so glaubt G., dürfte