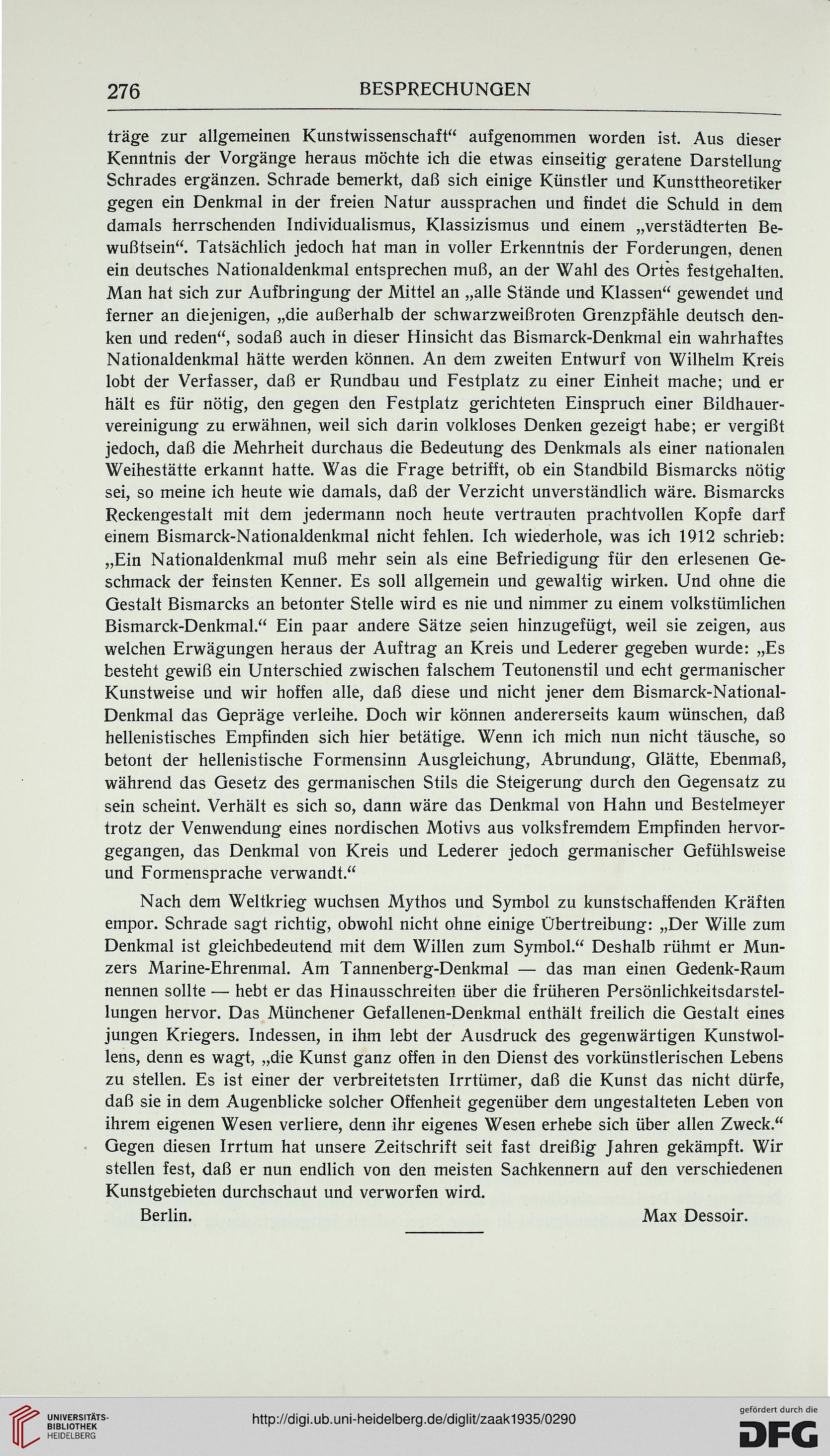276
BESPRECHUNGEN
träge zur allgemeinen Kunstwissenschaft" aufgenommen worden ist. Aus dieser
Kenntnis der Vorgänge heraus möchte ich die etwas einseitig geratene Darstellung
Schrades ergänzen. Schrade bemerkt, daß sich einige Künstler und Kunsttheoretiker
gegen ein Denkmal in der freien Natur aussprachen und findet die Schuld in dem
damals herrschenden Individualismus, Klassizismus und einem „verstädterten Be-
wußtsein". Tatsächlich jedoch hat man in voller Erkenntnis der Forderungen, denen
ein deutsches Nationaldenkmal entsprechen muß, an der Wahl des Ortes festgehalten.
Man hat sich zur Aufbringung der Mittel an „alle Stände und Klassen" gewendet und
ferner an diejenigen, „die außerhalb der schwarzweißroten Grenzpfähle deutsch den-
ken und reden", sodaß auch in dieser Hinsicht das Bismarck-Denkmal ein wahrhaftes
Nationaldenkmal hätte werden können. An dem zweiten Entwurf von Wilhelm Kreis
lobt der Verfasser, daß er Rundbau und Festplatz zu einer Einheit mache; und er
hält es für nötig, den gegen den Festplatz gerichteten Einspruch einer Bildhauer-
vereinigung zu erwähnen, weil sich darin volkloses Denken gezeigt habe; er vergißt
jedoch, daß die Mehrheit durchaus die Bedeutung des Denkmals als einer nationalen
Weihestätte erkannt hatte. Was die Frage betrifft, ob ein Standbild Bismarcks nötig
sei, so meine ich heute wie damals, daß der Verzicht unverständlich wäre. Bismarcks
Reckengestalt mit dem jedermann noch heute vertrauten prachtvollen Kopfe darf
einem Bismarck-Nationaldenkmal nicht fehlen. Ich wiederhole, was ich 1912 schrieb:
„Ein Nationaldenkmal muß mehr sein als eine Befriedigung für den erlesenen Ge-
schmack der feinsten Kenner. Es soll allgemein und gewaltig wirken. Und ohne die
Gestalt Bismarcks an betonter Stelle wird es nie und nimmer zu einem volkstümlichen
Bismarck-Denkmal." Ein paar andere Sätze seien hinzugefügt, weil sie zeigen, aus
welchen Erwägungen heraus der Auftrag an Kreis und Lederer gegeben wurde: „Es
besteht gewiß ein Unterschied zwischen falschem Teutonenstil und echt germanischer
Kunstweise und wir hoffen alle, daß diese und nicht jener dem Bismarck-National-
Denkmal das Gepräge verleihe. Doch wir können andererseits kaum wünschen, daß
hellenistisches Empfinden sich hier betätige. Wenn ich mich nun nicht täusche, so
betont der hellenistische Formensinn Ausgleichung, Abrundung, Glätte, Ebenmaß,
während das Gesetz des germanischen Stils die Steigerung durch den Gegensatz zu
sein scheint. Verhält es sich so, dann wäre das Denkmal von Hahn und Bestelmeyer
trotz der Venwendung eines nordischen Motivs aus volksfremdem Empfinden hervor-
gegangen, das Denkmal von Kreis und Lederer jedoch germanischer Gefühlsweise
und Formensprache verwandt."
Nach dem Weltkrieg wuchsen Mythos und Symbol zu kunstschaffenden Kräften
empor. Schrade sagt richtig, obwohl nicht ohne einige Übertreibung: „Der Wille zum
Denkmal ist gleichbedeutend mit dem Willen zum Symbol." Deshalb rühmt er Mun-
zers Marine-Ehrenmal. Am Tannenberg-Denkmal — das man einen Gedenk-Raum
nennen sollte — hebt er das Hinausschreiten über die früheren Persönlichkeitsdarstel-
lungen hervor. Das Münchener Gefallenen-Denkmal enthält freilich die Gestalt eines
jungen Kriegers. Indessen, in ihm lebt der Ausdruck des gegenwärtigen Kunstwol-
lens, denn es wagt, „die Kunst ganz offen in den Dienst des vorkünstlerischen Lebens
zu stellen. Es ist einer der verbreitetsten Irrtümer, daß die Kunst das nicht dürfe,
daß sie in dem Augenblicke solcher Offenheit gegenüber dem ungestalteten Leben von
ihrem eigenen Wesen verliere, denn ihr eigenes Wesen erhebe sich über allen Zweck."
Gegen diesen Irrtum hat unsere Zeitschrift seit fast dreißig Jahren gekämpft. Wir
stellen fest, daß er nun endlich von den meisten Sachkennern auf den verschiedenen
Kunstgebieten durchschaut und verworfen wird.
Berlin. Max Dessoir.
BESPRECHUNGEN
träge zur allgemeinen Kunstwissenschaft" aufgenommen worden ist. Aus dieser
Kenntnis der Vorgänge heraus möchte ich die etwas einseitig geratene Darstellung
Schrades ergänzen. Schrade bemerkt, daß sich einige Künstler und Kunsttheoretiker
gegen ein Denkmal in der freien Natur aussprachen und findet die Schuld in dem
damals herrschenden Individualismus, Klassizismus und einem „verstädterten Be-
wußtsein". Tatsächlich jedoch hat man in voller Erkenntnis der Forderungen, denen
ein deutsches Nationaldenkmal entsprechen muß, an der Wahl des Ortes festgehalten.
Man hat sich zur Aufbringung der Mittel an „alle Stände und Klassen" gewendet und
ferner an diejenigen, „die außerhalb der schwarzweißroten Grenzpfähle deutsch den-
ken und reden", sodaß auch in dieser Hinsicht das Bismarck-Denkmal ein wahrhaftes
Nationaldenkmal hätte werden können. An dem zweiten Entwurf von Wilhelm Kreis
lobt der Verfasser, daß er Rundbau und Festplatz zu einer Einheit mache; und er
hält es für nötig, den gegen den Festplatz gerichteten Einspruch einer Bildhauer-
vereinigung zu erwähnen, weil sich darin volkloses Denken gezeigt habe; er vergißt
jedoch, daß die Mehrheit durchaus die Bedeutung des Denkmals als einer nationalen
Weihestätte erkannt hatte. Was die Frage betrifft, ob ein Standbild Bismarcks nötig
sei, so meine ich heute wie damals, daß der Verzicht unverständlich wäre. Bismarcks
Reckengestalt mit dem jedermann noch heute vertrauten prachtvollen Kopfe darf
einem Bismarck-Nationaldenkmal nicht fehlen. Ich wiederhole, was ich 1912 schrieb:
„Ein Nationaldenkmal muß mehr sein als eine Befriedigung für den erlesenen Ge-
schmack der feinsten Kenner. Es soll allgemein und gewaltig wirken. Und ohne die
Gestalt Bismarcks an betonter Stelle wird es nie und nimmer zu einem volkstümlichen
Bismarck-Denkmal." Ein paar andere Sätze seien hinzugefügt, weil sie zeigen, aus
welchen Erwägungen heraus der Auftrag an Kreis und Lederer gegeben wurde: „Es
besteht gewiß ein Unterschied zwischen falschem Teutonenstil und echt germanischer
Kunstweise und wir hoffen alle, daß diese und nicht jener dem Bismarck-National-
Denkmal das Gepräge verleihe. Doch wir können andererseits kaum wünschen, daß
hellenistisches Empfinden sich hier betätige. Wenn ich mich nun nicht täusche, so
betont der hellenistische Formensinn Ausgleichung, Abrundung, Glätte, Ebenmaß,
während das Gesetz des germanischen Stils die Steigerung durch den Gegensatz zu
sein scheint. Verhält es sich so, dann wäre das Denkmal von Hahn und Bestelmeyer
trotz der Venwendung eines nordischen Motivs aus volksfremdem Empfinden hervor-
gegangen, das Denkmal von Kreis und Lederer jedoch germanischer Gefühlsweise
und Formensprache verwandt."
Nach dem Weltkrieg wuchsen Mythos und Symbol zu kunstschaffenden Kräften
empor. Schrade sagt richtig, obwohl nicht ohne einige Übertreibung: „Der Wille zum
Denkmal ist gleichbedeutend mit dem Willen zum Symbol." Deshalb rühmt er Mun-
zers Marine-Ehrenmal. Am Tannenberg-Denkmal — das man einen Gedenk-Raum
nennen sollte — hebt er das Hinausschreiten über die früheren Persönlichkeitsdarstel-
lungen hervor. Das Münchener Gefallenen-Denkmal enthält freilich die Gestalt eines
jungen Kriegers. Indessen, in ihm lebt der Ausdruck des gegenwärtigen Kunstwol-
lens, denn es wagt, „die Kunst ganz offen in den Dienst des vorkünstlerischen Lebens
zu stellen. Es ist einer der verbreitetsten Irrtümer, daß die Kunst das nicht dürfe,
daß sie in dem Augenblicke solcher Offenheit gegenüber dem ungestalteten Leben von
ihrem eigenen Wesen verliere, denn ihr eigenes Wesen erhebe sich über allen Zweck."
Gegen diesen Irrtum hat unsere Zeitschrift seit fast dreißig Jahren gekämpft. Wir
stellen fest, daß er nun endlich von den meisten Sachkennern auf den verschiedenen
Kunstgebieten durchschaut und verworfen wird.
Berlin. Max Dessoir.