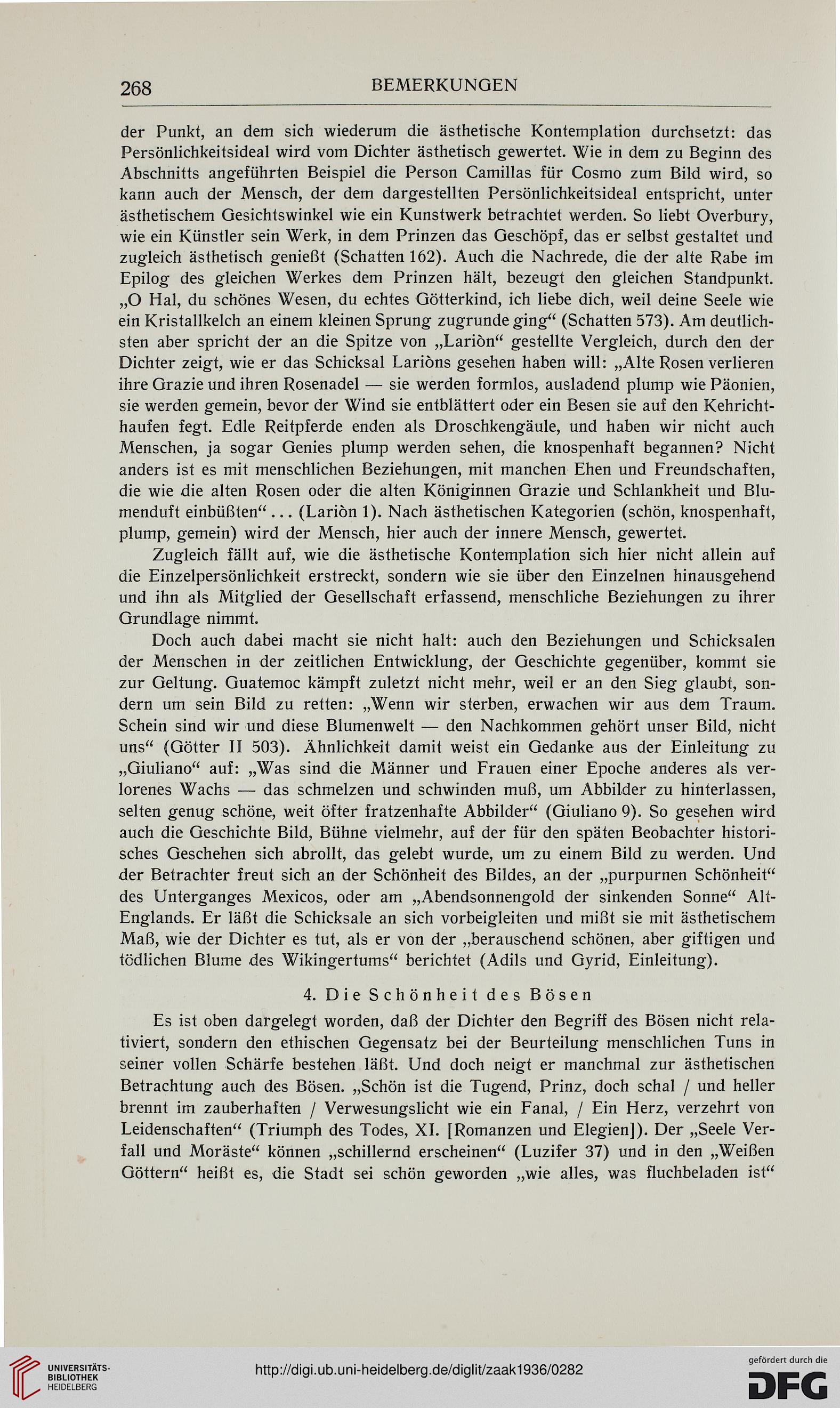der Punkt, an dem sich wiederum die ästhetische Kontemplation durchsetzt: das
Persönlichkeitsideal wird vom Dichter ästhetisch gewertet. Wie in dem zu Beginn des
Abschnitts angeführten Beispiel die Person Camillas für Cosmo zum Bild wird, so
kann auch der Mensch, der dem dargestellten Persönlichkeitsideal entspricht, unter
ästhetischem Gesichtswinkel wie ein Kunstwerk betrachtet werden. So liebt Overbury,
wie ein Künstler sein Werk, in dem Prinzen das Geschöpf, das er selbst gestaltet und
zugleich ästhetisch genießt (Schatten 162). Auch die Nachrede, die der alte Rabe im
Epilog des gleichen Werkes dem Prinzen hält, bezeugt den gleichen Standpunkt.
„O Hai, du schönes Wesen, du echtes Götterkind, ich liebe dich, weil deine Seele wie
ein Kristallkelch an einem kleinen Sprung zugrunde ging" (Schatten 573). Am deutlich-
sten aber spricht der an die Spitze von „Lariön" gestellte Vergleich, durch den der
Dichter zeigt, wie er das Schicksal Lariöns gesehen haben will: „Alte Rosen verlieren
ihre Grazie und ihren Rosenadel — sie werden formlos, ausladend plump wie Päonien,
sie werden gemein, bevor der Wind sie entblättert oder ein Besen sie auf den Kehricht-
haufen fegt. Edle Reitpferde enden als Droschkengäule, und haben wir nicht auch
Menschen, ja sogar Genies plump werden sehen, die knospenhaft begannen? Nicht
anders ist es mit menschlichen Beziehungen, mit manchen Ehen und Freundschaften,
die wie die alten Rosen oder die alten Königinnen Grazie und Schlankheit und Blu-
menduft einbüßten" ... (Lariön 1). Nach ästhetischen Kategorien (schön, knospenhaft,
plump, gemein) wird der Mensch, hier auch der innere Mensch, gewertet.
Zugleich fällt auf, wie die ästhetische Kontemplation sich hier nicht allein auf
die Einzelpersönlichkeit erstreckt, sondern wie sie über den Einzelnen hinausgehend
und ihn als Mitglied der Gesellschaft erfassend, menschliche Beziehungen zu ihrer
Grundlage nimmt.
Doch auch dabei macht sie nicht halt: auch den Beziehungen und Schicksalen
der Menschen in der zeitlichen Entwicklung, der Geschichte gegenüber, kommt sie
zur Geltung. Guatemoc kämpft zuletzt nicht mehr, weil er an den Sieg glaubt, son-
dern um sein Bild zu retten: „Wenn wir sterben, erwachen wir aus dem Traum.
Schein sind wir und diese Blumenwelt — den Nachkommen gehört unser Bild, nicht
uns" (Götter II 503). Ähnlichkeit damit weist ein Gedanke aus der Einleitung zu
„Giuliano" auf: „Was sind die Männer und Frauen einer Epoche anderes als ver-
lorenes Wachs — das schmelzen und schwinden muß, um Abbilder zu hinterlassen,
selten genug schöne, weit öfter fratzenhafte Abbilder" (Giuliano 9). So gesehen wird
auch die Geschichte Bild, Bühne vielmehr, auf der für den späten Beobachter histori-
sches Geschehen sich abrollt, das gelebt wurde, um zu einem Bild zu werden. Und
der Betrachter freut sich an der Schönheit des Bildes, an der „purpurnen Schönheit"
des Unterganges Mexicos, oder am „Abendsonnengold der sinkenden Sonne" Alt-
Englands. Er läßt die Schicksale an sich vorbeigleiten und mißt sie mit ästhetischem
Maß, wie der Dichter es tut, als er von der „berauschend schönen, aber giftigen und
tödlichen Blume des Wikingertums" berichtet (Adils und Gyrid, Einleitung).
4. Die Schönheit des Bösen
Es ist oben dargelegt worden, daß der Dichter den Begriff des Bösen nicht rela-
tiviert, sondern den ethischen Gegensatz bei der Beurteilung menschlichen Tuns in
seiner vollen Schärfe bestehen läßt. Und doch neigt er manchmal zur ästhetischen
Betrachtung auch des Bösen. „Schön ist die Tugend, Prinz, doch schal / und heller
brennt im zauberhaften / Verwesungslicht wie ein Fanal, / Ein Herz, verzehrt von
Leidenschaften" (Triumph des Todes, XI. [Romanzen und Elegien]). Der „Seele Ver-
fall und Moräste" können „schillernd erscheinen" (Luzifer 37) und in den „Weißen
Göttern" heißt es, die Stadt sei schön geworden „wie alles, was fluchbeladen ist"
Persönlichkeitsideal wird vom Dichter ästhetisch gewertet. Wie in dem zu Beginn des
Abschnitts angeführten Beispiel die Person Camillas für Cosmo zum Bild wird, so
kann auch der Mensch, der dem dargestellten Persönlichkeitsideal entspricht, unter
ästhetischem Gesichtswinkel wie ein Kunstwerk betrachtet werden. So liebt Overbury,
wie ein Künstler sein Werk, in dem Prinzen das Geschöpf, das er selbst gestaltet und
zugleich ästhetisch genießt (Schatten 162). Auch die Nachrede, die der alte Rabe im
Epilog des gleichen Werkes dem Prinzen hält, bezeugt den gleichen Standpunkt.
„O Hai, du schönes Wesen, du echtes Götterkind, ich liebe dich, weil deine Seele wie
ein Kristallkelch an einem kleinen Sprung zugrunde ging" (Schatten 573). Am deutlich-
sten aber spricht der an die Spitze von „Lariön" gestellte Vergleich, durch den der
Dichter zeigt, wie er das Schicksal Lariöns gesehen haben will: „Alte Rosen verlieren
ihre Grazie und ihren Rosenadel — sie werden formlos, ausladend plump wie Päonien,
sie werden gemein, bevor der Wind sie entblättert oder ein Besen sie auf den Kehricht-
haufen fegt. Edle Reitpferde enden als Droschkengäule, und haben wir nicht auch
Menschen, ja sogar Genies plump werden sehen, die knospenhaft begannen? Nicht
anders ist es mit menschlichen Beziehungen, mit manchen Ehen und Freundschaften,
die wie die alten Rosen oder die alten Königinnen Grazie und Schlankheit und Blu-
menduft einbüßten" ... (Lariön 1). Nach ästhetischen Kategorien (schön, knospenhaft,
plump, gemein) wird der Mensch, hier auch der innere Mensch, gewertet.
Zugleich fällt auf, wie die ästhetische Kontemplation sich hier nicht allein auf
die Einzelpersönlichkeit erstreckt, sondern wie sie über den Einzelnen hinausgehend
und ihn als Mitglied der Gesellschaft erfassend, menschliche Beziehungen zu ihrer
Grundlage nimmt.
Doch auch dabei macht sie nicht halt: auch den Beziehungen und Schicksalen
der Menschen in der zeitlichen Entwicklung, der Geschichte gegenüber, kommt sie
zur Geltung. Guatemoc kämpft zuletzt nicht mehr, weil er an den Sieg glaubt, son-
dern um sein Bild zu retten: „Wenn wir sterben, erwachen wir aus dem Traum.
Schein sind wir und diese Blumenwelt — den Nachkommen gehört unser Bild, nicht
uns" (Götter II 503). Ähnlichkeit damit weist ein Gedanke aus der Einleitung zu
„Giuliano" auf: „Was sind die Männer und Frauen einer Epoche anderes als ver-
lorenes Wachs — das schmelzen und schwinden muß, um Abbilder zu hinterlassen,
selten genug schöne, weit öfter fratzenhafte Abbilder" (Giuliano 9). So gesehen wird
auch die Geschichte Bild, Bühne vielmehr, auf der für den späten Beobachter histori-
sches Geschehen sich abrollt, das gelebt wurde, um zu einem Bild zu werden. Und
der Betrachter freut sich an der Schönheit des Bildes, an der „purpurnen Schönheit"
des Unterganges Mexicos, oder am „Abendsonnengold der sinkenden Sonne" Alt-
Englands. Er läßt die Schicksale an sich vorbeigleiten und mißt sie mit ästhetischem
Maß, wie der Dichter es tut, als er von der „berauschend schönen, aber giftigen und
tödlichen Blume des Wikingertums" berichtet (Adils und Gyrid, Einleitung).
4. Die Schönheit des Bösen
Es ist oben dargelegt worden, daß der Dichter den Begriff des Bösen nicht rela-
tiviert, sondern den ethischen Gegensatz bei der Beurteilung menschlichen Tuns in
seiner vollen Schärfe bestehen läßt. Und doch neigt er manchmal zur ästhetischen
Betrachtung auch des Bösen. „Schön ist die Tugend, Prinz, doch schal / und heller
brennt im zauberhaften / Verwesungslicht wie ein Fanal, / Ein Herz, verzehrt von
Leidenschaften" (Triumph des Todes, XI. [Romanzen und Elegien]). Der „Seele Ver-
fall und Moräste" können „schillernd erscheinen" (Luzifer 37) und in den „Weißen
Göttern" heißt es, die Stadt sei schön geworden „wie alles, was fluchbeladen ist"