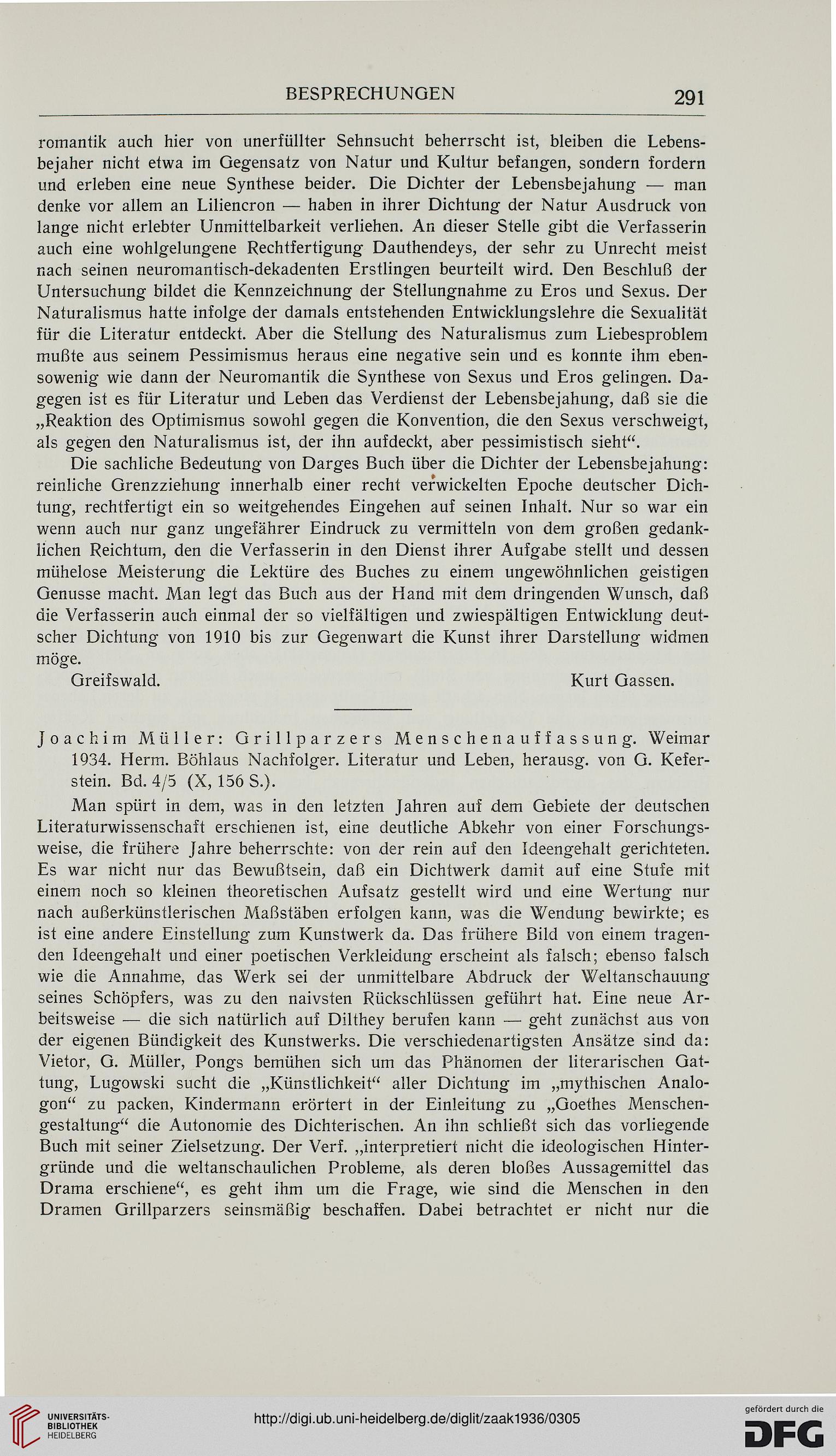BESPRECHUNGEN
291
romantik auch hier von unerfüllter Sehnsucht beherrscht ist, bleiben die Lebens-
bejaher nicht etwa im Gegensatz von Natur und Kultur befangen, sondern fordern
und erleben eine neue Synthese beider. Die Dichter der Lebensbejahung — man
denke vor allem an Liliencron — haben in ihrer Dichtung der Natur Ausdruck von
lange nicht erlebter Unmittelbarkeit verliehen. An dieser Stelle gibt die Verfasserin
auch eine wohlgelungene Rechtfertigung Dauthendeys, der sehr zu Unrecht meist
nach seinen neuromantisch-dekadenten Erstlingen beurteilt wird. Den Beschluß der
Untersuchung bildet die Kennzeichnung der Stellungnahme zu Eros und Sexus. Der
Naturalismus hatte infolge der damals entstehenden Entwicklungslehre die Sexualität
für die Literatur entdeckt. Aber die Stellung des Naturalismus zum Liebesproblem
mußte aus seinem Pessimismus heraus eine negative sein und es konnte ihm eben-
sowenig wie dann der Neuromantik die Synthese von Sexus und Eros gelingen. Da-
gegen ist es für Literatur und Leben das Verdienst der Lebensbejahung, daß sie die
„Reaktion des Optimismus sowohl gegen die Konvention, die den Sexus verschweigt,
als gegen den Naturalismus ist, der ihn aufdeckt, aber pessimistisch sieht".
Die sachliche Bedeutung von Darges Buch über die Dichter der Lebensbejahung:
reinliche Grenzziehung innerhalb einer recht verwickelten Epoche deutscher Dich-
tung, rechtfertigt ein so weitgehendes Eingehen auf seinen Inhalt. Nur so war ein
wenn auch nur ganz ungefährer Eindruck zu vermitteln von dem großen gedank-
lichen Reichtum, den die Verfasserin in den Dienst ihrer Aufgabe stellt und dessen
mühelose Meisterung die Lektüre des Buches zu einem ungewöhnlichen geistigen
Genüsse macht. Man legt das Buch aus der Hand mit dem dringenden Wunsch, daß
die Verfasserin auch einmal der so vielfältigen und zwiespältigen Entwicklung deut-
scher Dichtung von 1910 bis zur Gegenwart die Kunst ihrer Darstellung widmen
möge.
Greifswald. Kurt Gassen.
Joachim Müller: Grillparzers Menschenauffassung. Weimar
1934. Herrn. Böhlaus Nachfolger. Literatur und Leben, herausg. von G. Kefer-
stein. Bd. 4/5 (X, 156 S.).
Man spürt in dem, was in den letzten Jahren auf dem Gebiete der deutschen
Literaturwissenschaft erschienen ist, eine deutliche Abkehr von einer Forschungs-
weise, die frühere Jahre beherrschte: von der rein auf den Ideengehalt gerichteten.
Es war nicht nur das Bewußtsein, daß ein Dichtwerk damit auf eine Stufe mit
einem noch so kleinen theoretischen Aufsatz gestellt wird und eine Wertung nur
nach außerkünstlerischen Maßstäben erfolgen kann, was die Wendung bewirkte; es
ist eine andere Einstellung zum Kunstwerk da. Das frühere Bild von einem tragen-
den Ideengehalt und einer poetischen Verkleidung erscheint als falsch; ebenso falsch
wie die Annahme, das Werk sei der unmittelbare Abdruck der Weltanschauung
seines Schöpfers, was zu den naivsten Rückschlüssen geführt hat. Eine neue Ar-
beitsweise — die sich natürlich auf Dilthey berufen kann — geht zunächst aus von
der eigenen Bündigkeit des Kunstwerks. Die verschiedenartigsten Ansätze sind da:
Vietor, G. Müller, Pongs bemühen sich um das Phänomen der literarischen Gat-
tung, Lugowski sucht die „Künstlichkeit" aller Dichtung im „mythischen Analo-
gon" zu packen, Kindermann erörtert in der Einleitung zu „Goethes Menschen-
gestaltung" die Autonomie des Dichterischen. An ihn schließt sich das vorliegende
Buch mit seiner Zielsetzung. Der Verf. „interpretiert nicht die ideologischen Hinter-
gründe und die weltanschaulichen Probleme, als deren bloßes Aussagemittel das
Drama erschiene", es geht ihm um die Frage, wie sind die Menschen in den
Dramen Grillparzers seinsmäßig beschaffen. Dabei betrachtet er nicht nur die
291
romantik auch hier von unerfüllter Sehnsucht beherrscht ist, bleiben die Lebens-
bejaher nicht etwa im Gegensatz von Natur und Kultur befangen, sondern fordern
und erleben eine neue Synthese beider. Die Dichter der Lebensbejahung — man
denke vor allem an Liliencron — haben in ihrer Dichtung der Natur Ausdruck von
lange nicht erlebter Unmittelbarkeit verliehen. An dieser Stelle gibt die Verfasserin
auch eine wohlgelungene Rechtfertigung Dauthendeys, der sehr zu Unrecht meist
nach seinen neuromantisch-dekadenten Erstlingen beurteilt wird. Den Beschluß der
Untersuchung bildet die Kennzeichnung der Stellungnahme zu Eros und Sexus. Der
Naturalismus hatte infolge der damals entstehenden Entwicklungslehre die Sexualität
für die Literatur entdeckt. Aber die Stellung des Naturalismus zum Liebesproblem
mußte aus seinem Pessimismus heraus eine negative sein und es konnte ihm eben-
sowenig wie dann der Neuromantik die Synthese von Sexus und Eros gelingen. Da-
gegen ist es für Literatur und Leben das Verdienst der Lebensbejahung, daß sie die
„Reaktion des Optimismus sowohl gegen die Konvention, die den Sexus verschweigt,
als gegen den Naturalismus ist, der ihn aufdeckt, aber pessimistisch sieht".
Die sachliche Bedeutung von Darges Buch über die Dichter der Lebensbejahung:
reinliche Grenzziehung innerhalb einer recht verwickelten Epoche deutscher Dich-
tung, rechtfertigt ein so weitgehendes Eingehen auf seinen Inhalt. Nur so war ein
wenn auch nur ganz ungefährer Eindruck zu vermitteln von dem großen gedank-
lichen Reichtum, den die Verfasserin in den Dienst ihrer Aufgabe stellt und dessen
mühelose Meisterung die Lektüre des Buches zu einem ungewöhnlichen geistigen
Genüsse macht. Man legt das Buch aus der Hand mit dem dringenden Wunsch, daß
die Verfasserin auch einmal der so vielfältigen und zwiespältigen Entwicklung deut-
scher Dichtung von 1910 bis zur Gegenwart die Kunst ihrer Darstellung widmen
möge.
Greifswald. Kurt Gassen.
Joachim Müller: Grillparzers Menschenauffassung. Weimar
1934. Herrn. Böhlaus Nachfolger. Literatur und Leben, herausg. von G. Kefer-
stein. Bd. 4/5 (X, 156 S.).
Man spürt in dem, was in den letzten Jahren auf dem Gebiete der deutschen
Literaturwissenschaft erschienen ist, eine deutliche Abkehr von einer Forschungs-
weise, die frühere Jahre beherrschte: von der rein auf den Ideengehalt gerichteten.
Es war nicht nur das Bewußtsein, daß ein Dichtwerk damit auf eine Stufe mit
einem noch so kleinen theoretischen Aufsatz gestellt wird und eine Wertung nur
nach außerkünstlerischen Maßstäben erfolgen kann, was die Wendung bewirkte; es
ist eine andere Einstellung zum Kunstwerk da. Das frühere Bild von einem tragen-
den Ideengehalt und einer poetischen Verkleidung erscheint als falsch; ebenso falsch
wie die Annahme, das Werk sei der unmittelbare Abdruck der Weltanschauung
seines Schöpfers, was zu den naivsten Rückschlüssen geführt hat. Eine neue Ar-
beitsweise — die sich natürlich auf Dilthey berufen kann — geht zunächst aus von
der eigenen Bündigkeit des Kunstwerks. Die verschiedenartigsten Ansätze sind da:
Vietor, G. Müller, Pongs bemühen sich um das Phänomen der literarischen Gat-
tung, Lugowski sucht die „Künstlichkeit" aller Dichtung im „mythischen Analo-
gon" zu packen, Kindermann erörtert in der Einleitung zu „Goethes Menschen-
gestaltung" die Autonomie des Dichterischen. An ihn schließt sich das vorliegende
Buch mit seiner Zielsetzung. Der Verf. „interpretiert nicht die ideologischen Hinter-
gründe und die weltanschaulichen Probleme, als deren bloßes Aussagemittel das
Drama erschiene", es geht ihm um die Frage, wie sind die Menschen in den
Dramen Grillparzers seinsmäßig beschaffen. Dabei betrachtet er nicht nur die