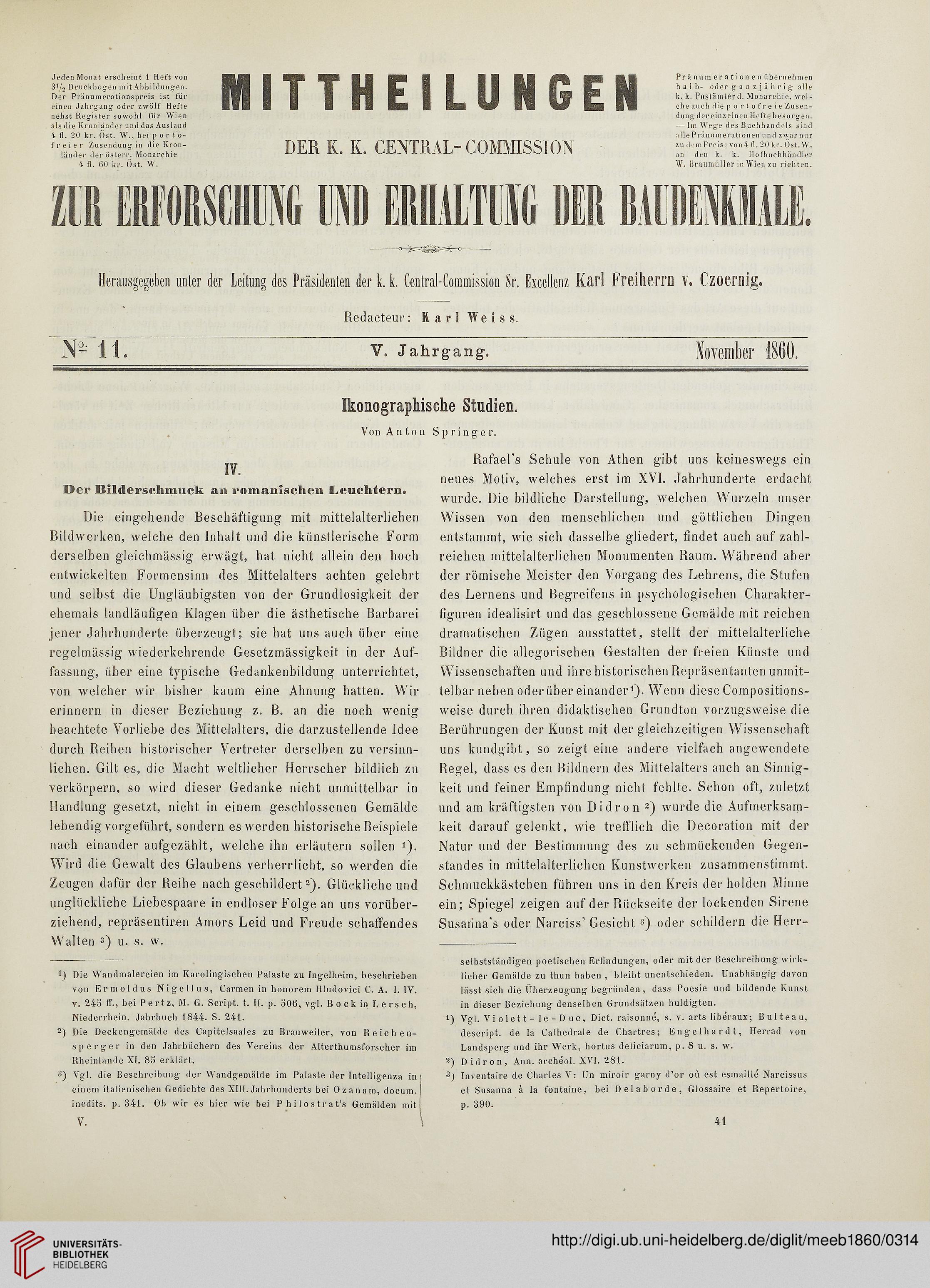Jeden Monat erscheint 1 Heft von
31/2 Druckbogen mit Abbildungen.
Der Pränumerationspreis ist für
einen Jahrgang oder zwölf Hefte
nebst Register sowohl für Wien
als die Kronländer und das Ausland
4 fl. 20 kr. Öst. W., bei porto-
freier Zusenduug in die Kron-
länder der österr. Monarchie
4 fl. 60 kr. Öst. W.
MITTHEILUNGEN
DER K. K. CENTRAL- COMMISSION
Prä num er ati on e n übernehmen
halb- oder g a n z j ä h r i g alle
k.k. Postämterd. Monarchie, wel-
che auch die p o r t o f r e i e Zusen-
dung der einzelnen Hefte besorgen.
— Iin Wege des Buchhandels sind
alle Pränumerationen und zwar nur
zudem Preise von 4 fl. 20 kr. Öst. W.
an den k. k. Hofbuchhändler
W. Braumüller in Wien zu richten.
Herausgegeben unter der Leitung des Präsidenten der L k. Central-Commission Sr. Excellenz Karl Freiherrn v, Czoernig.
Redacteur: Karl Weiss.
V. Jahrgang.
November 1860.
Ikonographische Studien.
Von A nt on
Die eingehende Beschäftigung mit mittelalterlichen
Bildwerken, welche den Inhalt und die künstlerische Form
derselben gleichmässig erwägt, hat nicht allein den hoch
entwickelten Formensinn des Mittelalters achten gelehrt
und selbst die Ungläubigsten von der Grundlosigkeit der
ehemals landläufigen Klagen über die ästhetische Barbarei
jener Jahrhunderte überzeugt; sie hat uns auch über eine
regelmässig wiederkehrende Gesetzmässigkeit in der Auf-
fassung, über eine typische Gedankenbildung unterrichtet,
von welcher wir bisher kaum eine Ahnung hatten. Wir
erinnern in dieser Beziehung z. B. an die noch wenig
beachtete Vorliebe des Mittelalters, die darzustellende Idee
durch Reihen historischer Vertreter derselben zu versinn-
lichen. Gilt es, die Macht weltlicher Herrscher bildlich zu
verkörpern, so wird dieser Gedanke nicht unmittelbar in
Handlung gesetzt, nicht in einem geschlossenen Gemälde
lebendig vorgeführt, sondern es werden historische Beispiele
nach einander aufgezählt, weiche ihn erläutern sollen !).
Wird die Gewalt des Glaubens verherrlicht, so werden die
Zeugen dafür der Reihe nach geschildert* 2)- Glückliche und
unglückliche Liebespaare in endloser Folge an uns vorüber-
ziehend, repräsentiren Amors Leid und Freude schaffendes
Walten 3) u. s. w.
Die Wandmalereien im Karolingischen Palaste zu Ingelheim, beschrieben
von Ermoldus Nigellus, Carmen in honorem Hludovici C. A. 1. IV.
v. 243 fT., bei P ertz, M. G. Script, t. il. p. 306, vgl. B o c k in Lersch,
Niederrhein. Jahrbuch 1844. S. 241.
2) Die Deckengemälde des Capitelsaales zu Brauweiler, von Reich en-
sperger in den Jahrbüchern des Vereins der Alterthumsforscher im
Rheinlande XI. 83 erklärt.
3) Vgl. die Beschreibung der Wandgemälde im Palaste der Intelligenza in
einem italienischen Gedichte des XIII. Jahrhunderts bei Ozanam, docum.
inedits. p. 341. Oh wir es hier wie bei Philostrat’s Gemälden mit
Springer.
Rafael’s Schule von Athen gibt uns keineswegs ein
neues Motiv, welches erst im XVI. Jahrhunderte erdacht
wurde. Die bildliche Darstellung, welchen Wurzeln unser
Wissen von den menschlichen und göttlichen Dingen
entstammt, wie sich dasselbe gliedert, findet auch auf zahl-
reichen mittelalterlichen Monumenten Raum. Während aber
der römische Meister den Vorgang des Lehrens, die Stufen
des Lernens und Begreifens in psychologischen Charakter-
figuren idealisirt und das geschlossene Gemälde mit reichen
dramatischen Zügen ausstattet, stellt der mittelalterliche
Bildner die allegorischen Gestalten der freien Künste und
Wissenschaften und ihre historischen Repräsentanten unmit-
telbar neben oder über einander1). Wenn diese Compositions-
weise durch ihren didaktischen Grundton vorzugsweise die
Berührungen der Kunst mit der gleichzeitigen Wissenschaft
uns kundgibt, so zeigt eine andere vielfach angewendete
Regel, dass es den Bildnein des Mittelalters auch an Sinnig-
keit und feiner Empfindung nicht fehlte. Schon oft, zuletzt
und am kräftigsten von Didron 2) wurde die Aufmerksam-
keit darauf gelenkt, wie trefflich die Decoratiou mit der
Natur und der Bestimmung des zu schmückenden Gegen-
standes in mittelalterlichen Kunstwerken zusammenstimmt.
Schmuckkästchen führen uns in den Kreis der holden Minne
ein; Spiegel zeigen auf der Rückseite der lockenden Sirene
Susaiina’s oder Narciss1 Gesicht 3) oder schildern die Herr-
selbstständigen poetischen Erfindungen, oder mit der Beschreibung wirk-
licher Gemälde zu thun haben , bleibt unentschieden. Unabhängig davon
lässt sich die Überzeugung'begründen, dass Poesie und bildende Kunst
in dieser Beziehung denselben Grundsätzen huldigten.
1) Vgl. Violett - le-Duc, Dict. raisonne, s. v. arts libe'raux; B u I tea u,
descript. de la Cathedrale de Chartres; Engelhardt, Herrad von
Landsperg und ihr Werk, hortus deliciarum, p. 8 u. s. w.
2) Didron, Ann. archeol. XVI. 281.
3) Inventaire de Charles V: Un miroir garny d’or ou est esmaille Narcissus
et Susanna ä la fontaine, bei D ela borde, Glossaire et Repertoire,
p. 390.
4t
31/2 Druckbogen mit Abbildungen.
Der Pränumerationspreis ist für
einen Jahrgang oder zwölf Hefte
nebst Register sowohl für Wien
als die Kronländer und das Ausland
4 fl. 20 kr. Öst. W., bei porto-
freier Zusenduug in die Kron-
länder der österr. Monarchie
4 fl. 60 kr. Öst. W.
MITTHEILUNGEN
DER K. K. CENTRAL- COMMISSION
Prä num er ati on e n übernehmen
halb- oder g a n z j ä h r i g alle
k.k. Postämterd. Monarchie, wel-
che auch die p o r t o f r e i e Zusen-
dung der einzelnen Hefte besorgen.
— Iin Wege des Buchhandels sind
alle Pränumerationen und zwar nur
zudem Preise von 4 fl. 20 kr. Öst. W.
an den k. k. Hofbuchhändler
W. Braumüller in Wien zu richten.
Herausgegeben unter der Leitung des Präsidenten der L k. Central-Commission Sr. Excellenz Karl Freiherrn v, Czoernig.
Redacteur: Karl Weiss.
V. Jahrgang.
November 1860.
Ikonographische Studien.
Von A nt on
Die eingehende Beschäftigung mit mittelalterlichen
Bildwerken, welche den Inhalt und die künstlerische Form
derselben gleichmässig erwägt, hat nicht allein den hoch
entwickelten Formensinn des Mittelalters achten gelehrt
und selbst die Ungläubigsten von der Grundlosigkeit der
ehemals landläufigen Klagen über die ästhetische Barbarei
jener Jahrhunderte überzeugt; sie hat uns auch über eine
regelmässig wiederkehrende Gesetzmässigkeit in der Auf-
fassung, über eine typische Gedankenbildung unterrichtet,
von welcher wir bisher kaum eine Ahnung hatten. Wir
erinnern in dieser Beziehung z. B. an die noch wenig
beachtete Vorliebe des Mittelalters, die darzustellende Idee
durch Reihen historischer Vertreter derselben zu versinn-
lichen. Gilt es, die Macht weltlicher Herrscher bildlich zu
verkörpern, so wird dieser Gedanke nicht unmittelbar in
Handlung gesetzt, nicht in einem geschlossenen Gemälde
lebendig vorgeführt, sondern es werden historische Beispiele
nach einander aufgezählt, weiche ihn erläutern sollen !).
Wird die Gewalt des Glaubens verherrlicht, so werden die
Zeugen dafür der Reihe nach geschildert* 2)- Glückliche und
unglückliche Liebespaare in endloser Folge an uns vorüber-
ziehend, repräsentiren Amors Leid und Freude schaffendes
Walten 3) u. s. w.
Die Wandmalereien im Karolingischen Palaste zu Ingelheim, beschrieben
von Ermoldus Nigellus, Carmen in honorem Hludovici C. A. 1. IV.
v. 243 fT., bei P ertz, M. G. Script, t. il. p. 306, vgl. B o c k in Lersch,
Niederrhein. Jahrbuch 1844. S. 241.
2) Die Deckengemälde des Capitelsaales zu Brauweiler, von Reich en-
sperger in den Jahrbüchern des Vereins der Alterthumsforscher im
Rheinlande XI. 83 erklärt.
3) Vgl. die Beschreibung der Wandgemälde im Palaste der Intelligenza in
einem italienischen Gedichte des XIII. Jahrhunderts bei Ozanam, docum.
inedits. p. 341. Oh wir es hier wie bei Philostrat’s Gemälden mit
Springer.
Rafael’s Schule von Athen gibt uns keineswegs ein
neues Motiv, welches erst im XVI. Jahrhunderte erdacht
wurde. Die bildliche Darstellung, welchen Wurzeln unser
Wissen von den menschlichen und göttlichen Dingen
entstammt, wie sich dasselbe gliedert, findet auch auf zahl-
reichen mittelalterlichen Monumenten Raum. Während aber
der römische Meister den Vorgang des Lehrens, die Stufen
des Lernens und Begreifens in psychologischen Charakter-
figuren idealisirt und das geschlossene Gemälde mit reichen
dramatischen Zügen ausstattet, stellt der mittelalterliche
Bildner die allegorischen Gestalten der freien Künste und
Wissenschaften und ihre historischen Repräsentanten unmit-
telbar neben oder über einander1). Wenn diese Compositions-
weise durch ihren didaktischen Grundton vorzugsweise die
Berührungen der Kunst mit der gleichzeitigen Wissenschaft
uns kundgibt, so zeigt eine andere vielfach angewendete
Regel, dass es den Bildnein des Mittelalters auch an Sinnig-
keit und feiner Empfindung nicht fehlte. Schon oft, zuletzt
und am kräftigsten von Didron 2) wurde die Aufmerksam-
keit darauf gelenkt, wie trefflich die Decoratiou mit der
Natur und der Bestimmung des zu schmückenden Gegen-
standes in mittelalterlichen Kunstwerken zusammenstimmt.
Schmuckkästchen führen uns in den Kreis der holden Minne
ein; Spiegel zeigen auf der Rückseite der lockenden Sirene
Susaiina’s oder Narciss1 Gesicht 3) oder schildern die Herr-
selbstständigen poetischen Erfindungen, oder mit der Beschreibung wirk-
licher Gemälde zu thun haben , bleibt unentschieden. Unabhängig davon
lässt sich die Überzeugung'begründen, dass Poesie und bildende Kunst
in dieser Beziehung denselben Grundsätzen huldigten.
1) Vgl. Violett - le-Duc, Dict. raisonne, s. v. arts libe'raux; B u I tea u,
descript. de la Cathedrale de Chartres; Engelhardt, Herrad von
Landsperg und ihr Werk, hortus deliciarum, p. 8 u. s. w.
2) Didron, Ann. archeol. XVI. 281.
3) Inventaire de Charles V: Un miroir garny d’or ou est esmaille Narcissus
et Susanna ä la fontaine, bei D ela borde, Glossaire et Repertoire,
p. 390.
4t