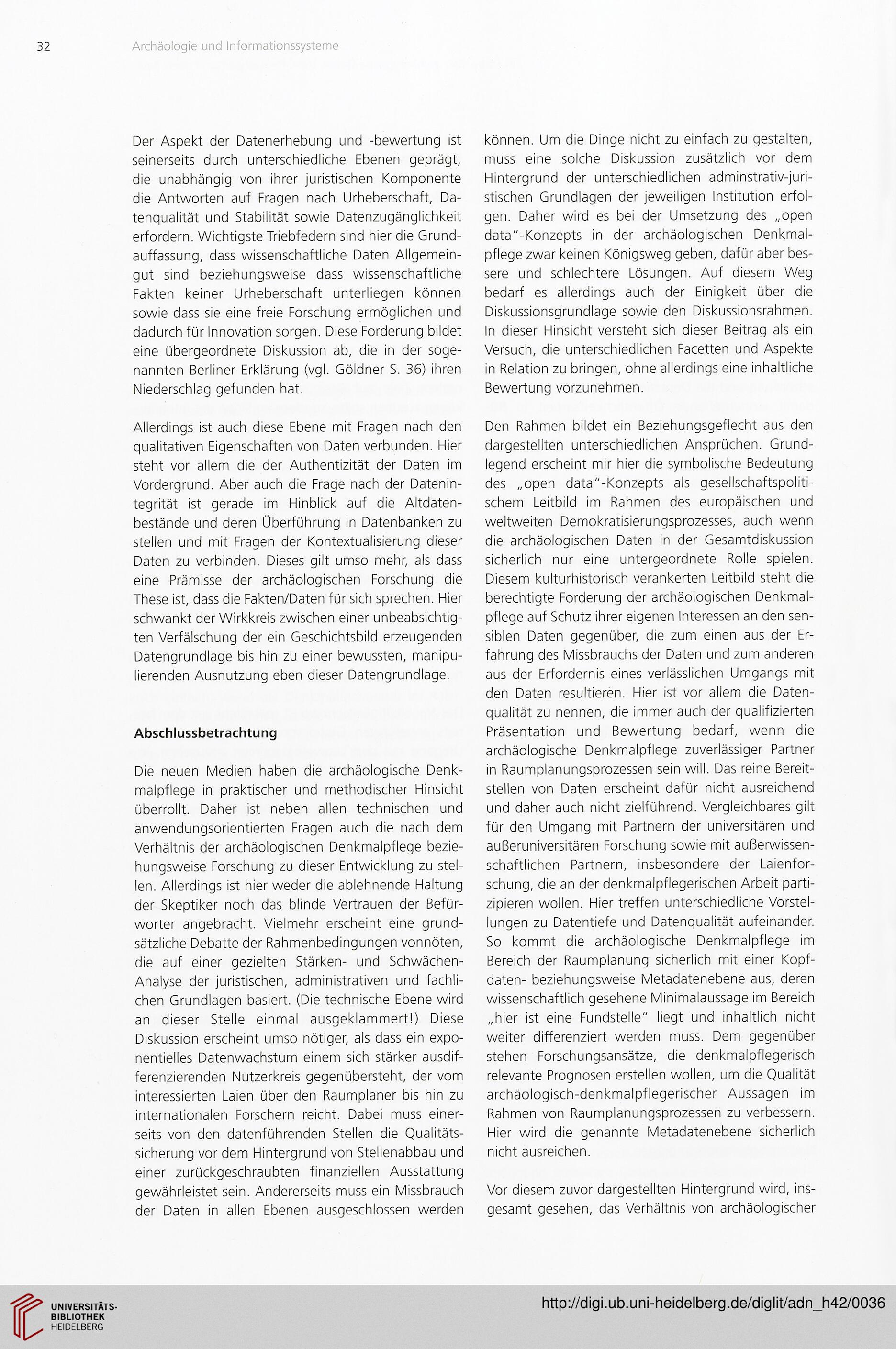32
Archäologie und Informationssysteme
Der Aspekt der Datenerhebung und -bewertung ist
seinerseits durch unterschiedliche Ebenen geprägt,
die unabhängig von ihrer juristischen Komponente
die Antworten auf Fragen nach Urheberschaft, Da-
tenqualität und Stabilität sowie Datenzugänglichkeit
erfordern. Wichtigste Triebfedern sind hier die Grund-
auffassung, dass wissenschaftliche Daten Allgemein-
gut sind beziehungsweise dass wissenschaftliche
Fakten keiner Urheberschaft unterliegen können
sowie dass sie eine freie Forschung ermöglichen und
dadurch für Innovation sorgen. Diese Forderung bildet
eine übergeordnete Diskussion ab, die in der soge-
nannten Berliner Erklärung (vgl. Göldner S. 36) ihren
Niederschlag gefunden hat.
Allerdings ist auch diese Ebene mit Fragen nach den
qualitativen Eigenschaften von Daten verbunden. Hier
steht vor allem die der Authentizität der Daten im
Vordergrund. Aber auch die Frage nach der Datenin-
tegrität ist gerade im Hinblick auf die Altdaten-
bestände und deren Überführung in Datenbanken zu
stellen und mit Fragen der Kontextualisierung dieser
Daten zu verbinden. Dieses gilt umso mehr, als dass
eine Prämisse der archäologischen Forschung die
These ist, dass die Fakten/Daten für sich sprechen. Hier
schwankt der Wirkkreis zwischen einer unbeabsichtig-
ten Verfälschung der ein Geschichtsbild erzeugenden
Datengrundlage bis hin zu einer bewussten, manipu-
lierenden Ausnutzung eben dieser Datengrundlage.
Abschlussbetrachtung
Die neuen Medien haben die archäologische Denk-
malpflege in praktischer und methodischer Hinsicht
überrollt. Daher ist neben allen technischen und
anwendungsorientierten Fragen auch die nach dem
Verhältnis der archäologischen Denkmalpflege bezie-
hungsweise Forschung zu dieser Entwicklung zu stel-
len. Allerdings ist hier weder die ablehnende Haltung
der Skeptiker noch das blinde Vertrauen der Befür-
worter angebracht. Vielmehr erscheint eine grund-
sätzliche Debatte der Rahmenbedingungen vonnöten,
die auf einer gezielten Stärken- und Schwächen-
Analyse der juristischen, administrativen und fachli-
chen Grundlagen basiert. (Die technische Ebene wird
an dieser Stelle einmal ausgeklammert!) Diese
Diskussion erscheint umso nötiger, als dass ein expo-
nentielles Datenwachstum einem sich stärker ausdif-
ferenzierenden Nutzerkreis gegenübersteht, der vom
interessierten Laien über den Raumplaner bis hin zu
internationalen Forschern reicht. Dabei muss einer-
seits von den datenführenden Stellen die Qualitäts-
sicherung vor dem Hintergrund von Stellenabbau und
einer zurückgeschraubten finanziellen Ausstattung
gewährleistet sein. Andererseits muss ein Missbrauch
der Daten in allen Ebenen ausgeschlossen werden
können. Um die Dinge nicht zu einfach zu gestalten,
muss eine solche Diskussion zusätzlich vor dem
Hintergrund der unterschiedlichen adminstrativ-juri-
stischen Grundlagen der jeweiligen Institution erfol-
gen. Daher wird es bei der Umsetzung des „open
data "-Konzepts in der archäologischen Denkmal-
pflege zwar keinen Königsweg geben, dafür aber bes-
sere und schlechtere Lösungen. Auf diesem Weg
bedarf es allerdings auch der Einigkeit über die
Diskussionsgrundlage sowie den Diskussionsrahmen.
In dieser Hinsicht versteht sich dieser Beitrag als ein
Versuch, die unterschiedlichen Facetten und Aspekte
in Relation zu bringen, ohne allerdings eine inhaltliche
Bewertung vorzunehmen.
Den Rahmen bildet ein Beziehungsgeflecht aus den
dargestellten unterschiedlichen Ansprüchen. Grund-
legend erscheint mir hier die symbolische Bedeutung
des „open data "-Konzepts als gesellschaftspoliti-
schem Leitbild im Rahmen des europäischen und
weltweiten Demokratisierungsprozesses, auch wenn
die archäologischen Daten in der Gesamtdiskussion
sicherlich nur eine untergeordnete Rolle spielen.
Diesem kulturhistorisch verankerten Leitbild steht die
berechtigte Forderung der archäologischen Denkmal-
pflege auf Schutz ihrer eigenen Interessen an den sen-
siblen Daten gegenüber, die zum einen aus der Er-
fahrung des Missbrauchs der Daten und zum anderen
aus der Erfordernis eines verlässlichen Umgangs mit
den Daten resultieren. Hier ist vor allem die Daten-
qualität zu nennen, die immer auch der qualifizierten
Präsentation und Bewertung bedarf, wenn die
archäologische Denkmalpflege zuverlässiger Partner
in Raumplanungsprozessen sein will. Das reine Bereit-
stellen von Daten erscheint dafür nicht ausreichend
und daher auch nicht zielführend. Vergleichbares gilt
für den Umgang mit Partnern der universitären und
außeruniversitären Forschung sowie mit außerwissen-
schaftlichen Partnern, insbesondere der Laienfor-
schung, die an der denkmalpflegerischen Arbeit parti-
zipieren wollen. Hier treffen unterschiedliche Vorstel-
lungen zu Datentiefe und Datenqualität aufeinander.
So kommt die archäologische Denkmalpflege im
Bereich der Raumplanung sicherlich mit einer Kopf-
daten- beziehungsweise Metadatenebene aus, deren
wissenschaftlich gesehene Minimalaussage im Bereich
„hier ist eine Fundstelle" liegt und inhaltlich nicht
weiter differenziert werden muss. Dem gegenüber
stehen Forschungsansätze, die denkmalpflegerisch
relevante Prognosen erstellen wollen, um die Qualität
archäologisch-denkmalpflegerischer Aussagen im
Rahmen von Raumplanungsprozessen zu verbessern.
Hier wird die genannte Metadatenebene sicherlich
nicht ausreichen.
Vor diesem zuvor dargestellten Hintergrund wird, ins-
gesamt gesehen, das Verhältnis von archäologischer
Archäologie und Informationssysteme
Der Aspekt der Datenerhebung und -bewertung ist
seinerseits durch unterschiedliche Ebenen geprägt,
die unabhängig von ihrer juristischen Komponente
die Antworten auf Fragen nach Urheberschaft, Da-
tenqualität und Stabilität sowie Datenzugänglichkeit
erfordern. Wichtigste Triebfedern sind hier die Grund-
auffassung, dass wissenschaftliche Daten Allgemein-
gut sind beziehungsweise dass wissenschaftliche
Fakten keiner Urheberschaft unterliegen können
sowie dass sie eine freie Forschung ermöglichen und
dadurch für Innovation sorgen. Diese Forderung bildet
eine übergeordnete Diskussion ab, die in der soge-
nannten Berliner Erklärung (vgl. Göldner S. 36) ihren
Niederschlag gefunden hat.
Allerdings ist auch diese Ebene mit Fragen nach den
qualitativen Eigenschaften von Daten verbunden. Hier
steht vor allem die der Authentizität der Daten im
Vordergrund. Aber auch die Frage nach der Datenin-
tegrität ist gerade im Hinblick auf die Altdaten-
bestände und deren Überführung in Datenbanken zu
stellen und mit Fragen der Kontextualisierung dieser
Daten zu verbinden. Dieses gilt umso mehr, als dass
eine Prämisse der archäologischen Forschung die
These ist, dass die Fakten/Daten für sich sprechen. Hier
schwankt der Wirkkreis zwischen einer unbeabsichtig-
ten Verfälschung der ein Geschichtsbild erzeugenden
Datengrundlage bis hin zu einer bewussten, manipu-
lierenden Ausnutzung eben dieser Datengrundlage.
Abschlussbetrachtung
Die neuen Medien haben die archäologische Denk-
malpflege in praktischer und methodischer Hinsicht
überrollt. Daher ist neben allen technischen und
anwendungsorientierten Fragen auch die nach dem
Verhältnis der archäologischen Denkmalpflege bezie-
hungsweise Forschung zu dieser Entwicklung zu stel-
len. Allerdings ist hier weder die ablehnende Haltung
der Skeptiker noch das blinde Vertrauen der Befür-
worter angebracht. Vielmehr erscheint eine grund-
sätzliche Debatte der Rahmenbedingungen vonnöten,
die auf einer gezielten Stärken- und Schwächen-
Analyse der juristischen, administrativen und fachli-
chen Grundlagen basiert. (Die technische Ebene wird
an dieser Stelle einmal ausgeklammert!) Diese
Diskussion erscheint umso nötiger, als dass ein expo-
nentielles Datenwachstum einem sich stärker ausdif-
ferenzierenden Nutzerkreis gegenübersteht, der vom
interessierten Laien über den Raumplaner bis hin zu
internationalen Forschern reicht. Dabei muss einer-
seits von den datenführenden Stellen die Qualitäts-
sicherung vor dem Hintergrund von Stellenabbau und
einer zurückgeschraubten finanziellen Ausstattung
gewährleistet sein. Andererseits muss ein Missbrauch
der Daten in allen Ebenen ausgeschlossen werden
können. Um die Dinge nicht zu einfach zu gestalten,
muss eine solche Diskussion zusätzlich vor dem
Hintergrund der unterschiedlichen adminstrativ-juri-
stischen Grundlagen der jeweiligen Institution erfol-
gen. Daher wird es bei der Umsetzung des „open
data "-Konzepts in der archäologischen Denkmal-
pflege zwar keinen Königsweg geben, dafür aber bes-
sere und schlechtere Lösungen. Auf diesem Weg
bedarf es allerdings auch der Einigkeit über die
Diskussionsgrundlage sowie den Diskussionsrahmen.
In dieser Hinsicht versteht sich dieser Beitrag als ein
Versuch, die unterschiedlichen Facetten und Aspekte
in Relation zu bringen, ohne allerdings eine inhaltliche
Bewertung vorzunehmen.
Den Rahmen bildet ein Beziehungsgeflecht aus den
dargestellten unterschiedlichen Ansprüchen. Grund-
legend erscheint mir hier die symbolische Bedeutung
des „open data "-Konzepts als gesellschaftspoliti-
schem Leitbild im Rahmen des europäischen und
weltweiten Demokratisierungsprozesses, auch wenn
die archäologischen Daten in der Gesamtdiskussion
sicherlich nur eine untergeordnete Rolle spielen.
Diesem kulturhistorisch verankerten Leitbild steht die
berechtigte Forderung der archäologischen Denkmal-
pflege auf Schutz ihrer eigenen Interessen an den sen-
siblen Daten gegenüber, die zum einen aus der Er-
fahrung des Missbrauchs der Daten und zum anderen
aus der Erfordernis eines verlässlichen Umgangs mit
den Daten resultieren. Hier ist vor allem die Daten-
qualität zu nennen, die immer auch der qualifizierten
Präsentation und Bewertung bedarf, wenn die
archäologische Denkmalpflege zuverlässiger Partner
in Raumplanungsprozessen sein will. Das reine Bereit-
stellen von Daten erscheint dafür nicht ausreichend
und daher auch nicht zielführend. Vergleichbares gilt
für den Umgang mit Partnern der universitären und
außeruniversitären Forschung sowie mit außerwissen-
schaftlichen Partnern, insbesondere der Laienfor-
schung, die an der denkmalpflegerischen Arbeit parti-
zipieren wollen. Hier treffen unterschiedliche Vorstel-
lungen zu Datentiefe und Datenqualität aufeinander.
So kommt die archäologische Denkmalpflege im
Bereich der Raumplanung sicherlich mit einer Kopf-
daten- beziehungsweise Metadatenebene aus, deren
wissenschaftlich gesehene Minimalaussage im Bereich
„hier ist eine Fundstelle" liegt und inhaltlich nicht
weiter differenziert werden muss. Dem gegenüber
stehen Forschungsansätze, die denkmalpflegerisch
relevante Prognosen erstellen wollen, um die Qualität
archäologisch-denkmalpflegerischer Aussagen im
Rahmen von Raumplanungsprozessen zu verbessern.
Hier wird die genannte Metadatenebene sicherlich
nicht ausreichen.
Vor diesem zuvor dargestellten Hintergrund wird, ins-
gesamt gesehen, das Verhältnis von archäologischer