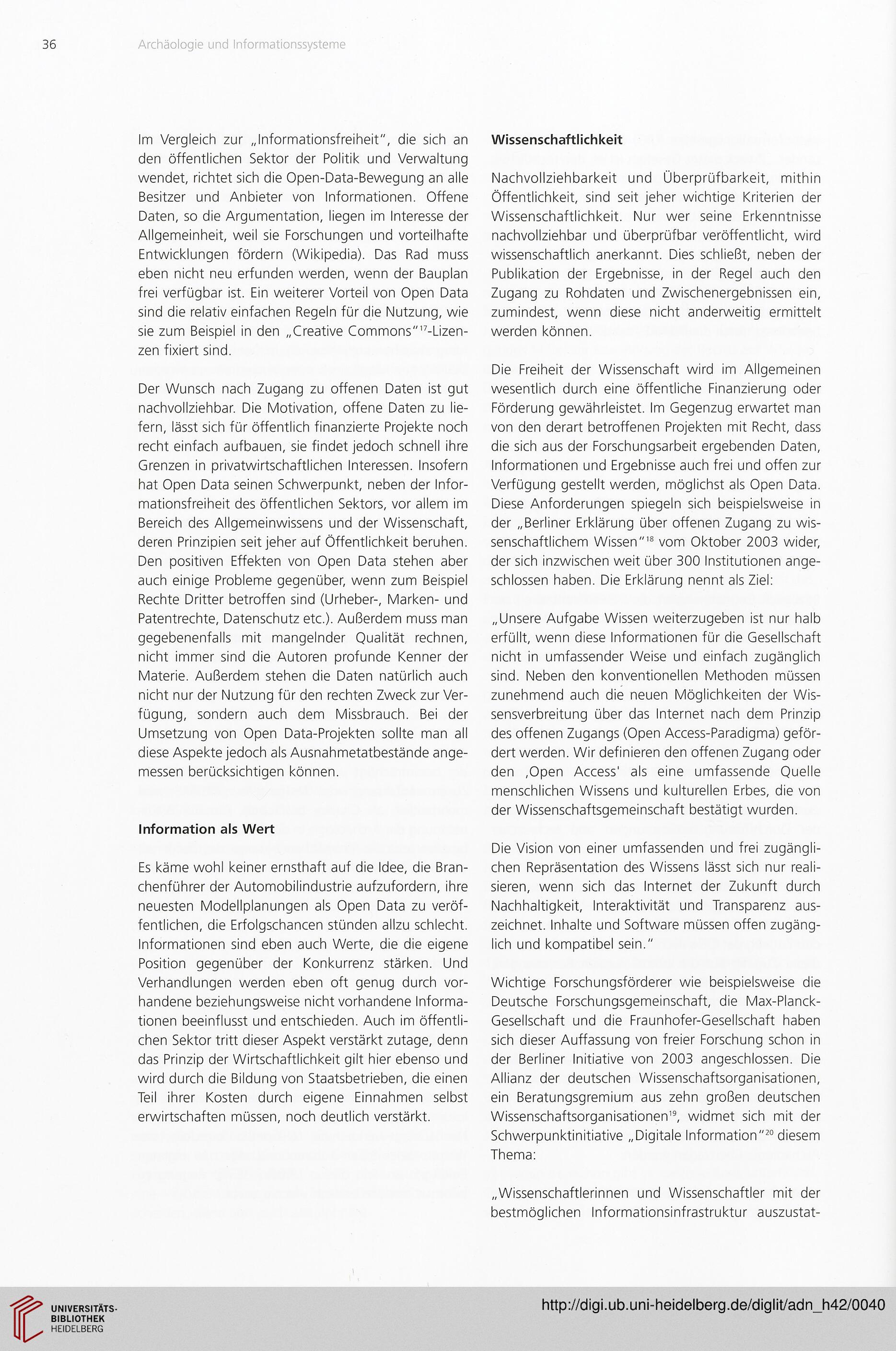36
Archäologie und Informationssysteme
Im Vergleich zur „Informationsfreiheit", die sich an
den öffentlichen Sektor der Politik und Verwaltung
wendet, richtet sich die Open-Data-Bewegung an alle
Besitzer und Anbieter von Informationen. Offene
Daten, so die Argumentation, liegen im Interesse der
Allgemeinheit, weil sie Forschungen und vorteilhafte
Entwicklungen fördern (Wikipedia). Das Rad muss
eben nicht neu erfunden werden, wenn der Bauplan
frei verfügbar ist. Ein weiterer Vorteil von Open Data
sind die relativ einfachen Regeln für die Nutzung, wie
sie zum Beispiel in den „Creative Commons",7-Lizen-
zen fixiert sind.
Der Wunsch nach Zugang zu offenen Daten ist gut
nachvollziehbar. Die Motivation, offene Daten zu lie-
fern, lässt sich für öffentlich finanzierte Projekte noch
recht einfach aufbauen, sie findet jedoch schnell ihre
Grenzen in privatwirtschaftlichen Interessen. Insofern
hat Open Data seinen Schwerpunkt, neben der Infor-
mationsfreiheit des öffentlichen Sektors, vor allem im
Bereich des Allgemeinwissens und der Wissenschaft,
deren Prinzipien seit jeher auf Öffentlichkeit beruhen.
Den positiven Effekten von Open Data stehen aber
auch einige Probleme gegenüber, wenn zum Beispiel
Rechte Dritter betroffen sind (Urheber-, Marken- und
Patentrechte, Datenschutz etc.). Außerdem muss man
gegebenenfalls mit mangelnder Qualität rechnen,
nicht immer sind die Autoren profunde Kenner der
Materie. Außerdem stehen die Daten natürlich auch
nicht nur der Nutzung für den rechten Zweck zur Ver-
fügung, sondern auch dem Missbrauch. Bei der
Umsetzung von Open Data-Projekten sollte man all
diese Aspekte jedoch als Ausnahmetatbestände ange-
messen berücksichtigen können.
Information als Wert
Es käme wohl keiner ernsthaft auf die Idee, die Bran-
chenführer der Automobilindustrie aufzufordern, ihre
neuesten Modellplanungen als Open Data zu veröf-
fentlichen, die Erfolgschancen stünden allzu schlecht.
Informationen sind eben auch Werte, die die eigene
Position gegenüber der Konkurrenz stärken. Und
Verhandlungen werden eben oft genug durch vor-
handene beziehungsweise nicht vorhandene Informa-
tionen beeinflusst und entschieden. Auch im öffentli-
chen Sektor tritt dieser Aspekt verstärkt zutage, denn
das Prinzip der Wirtschaftlichkeit gilt hier ebenso und
wird durch die Bildung von Staatsbetrieben, die einen
Teil ihrer Kosten durch eigene Einnahmen selbst
erwirtschaften müssen, noch deutlich verstärkt.
Wissenschaftlichkeit
Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit, mithin
Öffentlichkeit, sind seit jeher wichtige Kriterien der
Wissenschaftlichkeit. Nur wer seine Erkenntnisse
nachvollziehbar und überprüfbar veröffentlicht, wird
wissenschaftlich anerkannt. Dies schließt, neben der
Publikation der Ergebnisse, in der Regel auch den
Zugang zu Rohdaten und Zwischenergebnissen ein,
zumindest, wenn diese nicht anderweitig ermittelt
werden können.
Die Freiheit der Wissenschaft wird im Allgemeinen
wesentlich durch eine öffentliche Finanzierung oder
Förderung gewährleistet. Im Gegenzug erwartet man
von den derart betroffenen Projekten mit Recht, dass
die sich aus der Forschungsarbeit ergebenden Daten,
Informationen und Ergebnisse auch frei und offen zur
Verfügung gestellt werden, möglichst als Open Data.
Diese Anforderungen spiegeln sich beispielsweise in
der „Berliner Erklärung über offenen Zugang zu wis-
senschaftlichem Wissen"18 vom Oktober 2003 wider,
der sich inzwischen weit über 300 Institutionen ange-
schlossen haben. Die Erklärung nennt als Ziel:
„Unsere Aufgabe Wissen weiterzugeben ist nur halb
erfüllt, wenn diese Informationen für die Gesellschaft
nicht in umfassender Weise und einfach zugänglich
sind. Neben den konventionellen Methoden müssen
zunehmend auch die neuen Möglichkeiten der Wis-
sensverbreitung über das Internet nach dem Prinzip
des offenen Zugangs (Open Access-Paradigma) geför-
dert werden. Wir definieren den offenen Zugang oder
den ,Open Access' als eine umfassende Quelle
menschlichen Wissens und kulturellen Erbes, die von
der Wissenschaftsgemeinschaft bestätigt wurden.
Die Vision von einer umfassenden und frei zugängli-
chen Repräsentation des Wissens lässt sich nur reali-
sieren, wenn sich das Internet der Zukunft durch
Nachhaltigkeit, Interaktivität und Transparenz aus-
zeichnet. Inhalte und Software müssen offen zugäng-
lich und kompatibel sein."
Wichtige Forschungsförderer wie beispielsweise die
Deutsche Forschungsgemeinschaft, die Max-Planck-
Gesellschaft und die Fraunhofer-Gesellschaft haben
sich dieser Auffassung von freier Forschung schon in
der Berliner Initiative von 2003 angeschlossen. Die
Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen,
ein Beratungsgremium aus zehn großen deutschen
Wissenschaftsorganisationen'9, widmet sich mit der
Schwerpunktinitiative „Digitale Information"20 diesem
Thema:
„Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit der
bestmöglichen Informationsinfrastruktur auszustat-
Archäologie und Informationssysteme
Im Vergleich zur „Informationsfreiheit", die sich an
den öffentlichen Sektor der Politik und Verwaltung
wendet, richtet sich die Open-Data-Bewegung an alle
Besitzer und Anbieter von Informationen. Offene
Daten, so die Argumentation, liegen im Interesse der
Allgemeinheit, weil sie Forschungen und vorteilhafte
Entwicklungen fördern (Wikipedia). Das Rad muss
eben nicht neu erfunden werden, wenn der Bauplan
frei verfügbar ist. Ein weiterer Vorteil von Open Data
sind die relativ einfachen Regeln für die Nutzung, wie
sie zum Beispiel in den „Creative Commons",7-Lizen-
zen fixiert sind.
Der Wunsch nach Zugang zu offenen Daten ist gut
nachvollziehbar. Die Motivation, offene Daten zu lie-
fern, lässt sich für öffentlich finanzierte Projekte noch
recht einfach aufbauen, sie findet jedoch schnell ihre
Grenzen in privatwirtschaftlichen Interessen. Insofern
hat Open Data seinen Schwerpunkt, neben der Infor-
mationsfreiheit des öffentlichen Sektors, vor allem im
Bereich des Allgemeinwissens und der Wissenschaft,
deren Prinzipien seit jeher auf Öffentlichkeit beruhen.
Den positiven Effekten von Open Data stehen aber
auch einige Probleme gegenüber, wenn zum Beispiel
Rechte Dritter betroffen sind (Urheber-, Marken- und
Patentrechte, Datenschutz etc.). Außerdem muss man
gegebenenfalls mit mangelnder Qualität rechnen,
nicht immer sind die Autoren profunde Kenner der
Materie. Außerdem stehen die Daten natürlich auch
nicht nur der Nutzung für den rechten Zweck zur Ver-
fügung, sondern auch dem Missbrauch. Bei der
Umsetzung von Open Data-Projekten sollte man all
diese Aspekte jedoch als Ausnahmetatbestände ange-
messen berücksichtigen können.
Information als Wert
Es käme wohl keiner ernsthaft auf die Idee, die Bran-
chenführer der Automobilindustrie aufzufordern, ihre
neuesten Modellplanungen als Open Data zu veröf-
fentlichen, die Erfolgschancen stünden allzu schlecht.
Informationen sind eben auch Werte, die die eigene
Position gegenüber der Konkurrenz stärken. Und
Verhandlungen werden eben oft genug durch vor-
handene beziehungsweise nicht vorhandene Informa-
tionen beeinflusst und entschieden. Auch im öffentli-
chen Sektor tritt dieser Aspekt verstärkt zutage, denn
das Prinzip der Wirtschaftlichkeit gilt hier ebenso und
wird durch die Bildung von Staatsbetrieben, die einen
Teil ihrer Kosten durch eigene Einnahmen selbst
erwirtschaften müssen, noch deutlich verstärkt.
Wissenschaftlichkeit
Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit, mithin
Öffentlichkeit, sind seit jeher wichtige Kriterien der
Wissenschaftlichkeit. Nur wer seine Erkenntnisse
nachvollziehbar und überprüfbar veröffentlicht, wird
wissenschaftlich anerkannt. Dies schließt, neben der
Publikation der Ergebnisse, in der Regel auch den
Zugang zu Rohdaten und Zwischenergebnissen ein,
zumindest, wenn diese nicht anderweitig ermittelt
werden können.
Die Freiheit der Wissenschaft wird im Allgemeinen
wesentlich durch eine öffentliche Finanzierung oder
Förderung gewährleistet. Im Gegenzug erwartet man
von den derart betroffenen Projekten mit Recht, dass
die sich aus der Forschungsarbeit ergebenden Daten,
Informationen und Ergebnisse auch frei und offen zur
Verfügung gestellt werden, möglichst als Open Data.
Diese Anforderungen spiegeln sich beispielsweise in
der „Berliner Erklärung über offenen Zugang zu wis-
senschaftlichem Wissen"18 vom Oktober 2003 wider,
der sich inzwischen weit über 300 Institutionen ange-
schlossen haben. Die Erklärung nennt als Ziel:
„Unsere Aufgabe Wissen weiterzugeben ist nur halb
erfüllt, wenn diese Informationen für die Gesellschaft
nicht in umfassender Weise und einfach zugänglich
sind. Neben den konventionellen Methoden müssen
zunehmend auch die neuen Möglichkeiten der Wis-
sensverbreitung über das Internet nach dem Prinzip
des offenen Zugangs (Open Access-Paradigma) geför-
dert werden. Wir definieren den offenen Zugang oder
den ,Open Access' als eine umfassende Quelle
menschlichen Wissens und kulturellen Erbes, die von
der Wissenschaftsgemeinschaft bestätigt wurden.
Die Vision von einer umfassenden und frei zugängli-
chen Repräsentation des Wissens lässt sich nur reali-
sieren, wenn sich das Internet der Zukunft durch
Nachhaltigkeit, Interaktivität und Transparenz aus-
zeichnet. Inhalte und Software müssen offen zugäng-
lich und kompatibel sein."
Wichtige Forschungsförderer wie beispielsweise die
Deutsche Forschungsgemeinschaft, die Max-Planck-
Gesellschaft und die Fraunhofer-Gesellschaft haben
sich dieser Auffassung von freier Forschung schon in
der Berliner Initiative von 2003 angeschlossen. Die
Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen,
ein Beratungsgremium aus zehn großen deutschen
Wissenschaftsorganisationen'9, widmet sich mit der
Schwerpunktinitiative „Digitale Information"20 diesem
Thema:
„Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit der
bestmöglichen Informationsinfrastruktur auszustat-