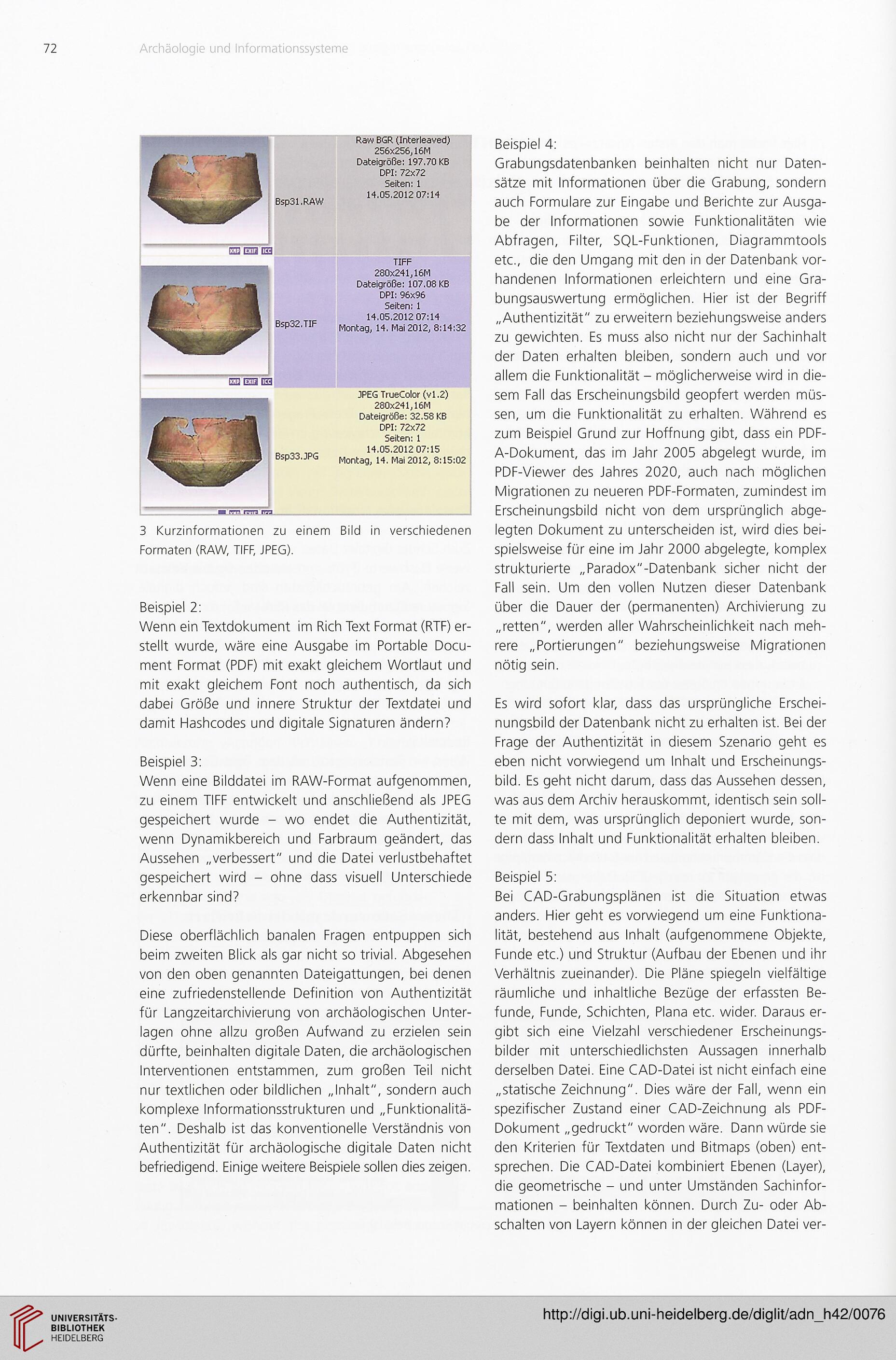72
Archäologie und Informationssysteme
Raw BGR (Interleaved)
256x256,16M
Dateigröße: 197.70 KB
DPI: 72x72
Seiten: 1
14.05.2012 07:14
TIFF
280x241,16M
Dateigröße: 107.08 KB
DPI: 96x96
Seiten: 1
14.05.2012 07:14
Montag, 14. Mai 2012, 8:14:32
JPEG TrueColor (vl.2)
280x241,16M
Dateigröße: 32.58 KB
DPI: 72x72
Seiten: 1
14.05.2012 07:15
Montag, 14. Mai 2012, 8:15:02
3 Kurzinformationen zu einem Bild in verschiedenen
Formaten (RAW, TIFF, JPEG).
Beispiel 2:
Wenn ein Textdokument im Rich Text Format (RTF) er-
stellt wurde, wäre eine Ausgabe im Portable Docu-
ment Format (PDF) mit exakt gleichem Wortlaut und
mit exakt gleichem Font noch authentisch, da sich
dabei Größe und innere Struktur der Textdatei und
damit Hashcodes und digitale Signaturen ändern?
Beispiel 3:
Wenn eine Bilddatei im RAW-Format aufgenommen,
zu einem TIFF entwickelt und anschließend als JPEG
gespeichert wurde - wo endet die Authentizität,
wenn Dynamikbereich und Farbraum geändert, das
Aussehen „verbessert" und die Datei verlustbehaftet
gespeichert wird - ohne dass visuell Unterschiede
erkennbar sind?
Diese oberflächlich banalen Fragen entpuppen sich
beim zweiten Blick als gar nicht so trivial. Abgesehen
von den oben genannten Dateigattungen, bei denen
eine zufriedenstellende Definition von Authentizität
für Langzeitarchivierung von archäologischen Unter-
lagen ohne allzu großen Aufwand zu erzielen sein
dürfte, beinhalten digitale Daten, die archäologischen
Interventionen entstammen, zum großen Teil nicht
nur textlichen oder bildlichen „Inhalt", sondern auch
komplexe Informationsstrukturen und „Funktionalitä-
ten". Deshalb ist das konventionelle Verständnis von
Authentizität für archäologische digitale Daten nicht
befriedigend. Einige weitere Beispiele sollen dies zeigen.
Beispiel 4:
Grabungsdatenbanken beinhalten nicht nur Daten-
sätze mit Informationen über die Grabung, sondern
auch Formulare zur Eingabe und Berichte zur Ausga-
be der Informationen sowie Funktionalitäten wie
Abfragen, Filter, SQL-Funktionen, Diagrammtools
etc., die den Umgang mit den in der Datenbank vor-
handenen Informationen erleichtern und eine Gra-
bungsauswertung ermöglichen. Hier ist der Begriff
„Authentizität" zu erweitern beziehungsweise anders
zu gewichten. Es muss also nicht nur der Sachinhalt
der Daten erhalten bleiben, sondern auch und vor
allem die Funktionalität - möglicherweise wird in die-
sem Fall das Erscheinungsbild geopfert werden müs-
sen, um die Funktionalität zu erhalten. Während es
zum Beispiel Grund zur Hoffnung gibt, dass ein PDF-
A-Dokument, das im Jahr 2005 abgelegt wurde, im
PDF-Viewer des Jahres 2020, auch nach möglichen
Migrationen zu neueren PDF-Formaten, zumindest im
Erscheinungsbild nicht von dem ursprünglich abge-
legten Dokument zu unterscheiden ist, wird dies bei-
spielsweise für eine im Jahr 2000 abgelegte, komplex
strukturierte „Paradox"-Datenbank sicher nicht der
Fall sein. Um den vollen Nutzen dieser Datenbank
über die Dauer der (permanenten) Archivierung zu
„retten", werden aller Wahrscheinlichkeit nach meh-
rere „Portierungen" beziehungsweise Migrationen
nötig sein.
Es wird sofort klar, dass das ursprüngliche Erschei-
nungsbild der Datenbank nicht zu erhalten ist. Bei der
Frage der Authentizität in diesem Szenario geht es
eben nicht vorwiegend um Inhalt und Erscheinungs-
bild. Es geht nicht darum, dass das Aussehen dessen,
was aus dem Archiv herauskommt, identisch sein soll-
te mit dem, was ursprünglich deponiert wurde, son-
dern dass Inhalt und Funktionalität erhalten bleiben.
Beispiel 5:
Bei CAD-Grabungsplänen ist die Situation etwas
anders. Hier geht es vorwiegend um eine Funktiona-
lität, bestehend aus Inhalt (aufgenommene Objekte,
Funde etc.) und Struktur (Aufbau der Ebenen und ihr
Verhältnis zueinander). Die Pläne spiegeln vielfältige
räumliche und inhaltliche Bezüge der erfassten Be-
funde, Funde, Schichten, Plana etc. wider. Daraus er-
gibt sich eine Vielzahl verschiedener Erscheinungs-
bilder mit unterschiedlichsten Aussagen innerhalb
derselben Datei. Eine CAD-Datei ist nicht einfach eine
„statische Zeichnung". Dies wäre der Fall, wenn ein
spezifischer Zustand einer CAD-Zeichnung als PDF-
Dokument „gedruckt" worden wäre. Dann würde sie
den Kriterien für Textdaten und Bitmaps (oben) ent-
sprechen. Die CAD-Datei kombiniert Ebenen (Layer),
die geometrische - und unter Umständen Sachinfor-
mationen - beinhalten können. Durch Zu- oder Ab-
schalten von Layern können in der gleichen Datei ver-
Archäologie und Informationssysteme
Raw BGR (Interleaved)
256x256,16M
Dateigröße: 197.70 KB
DPI: 72x72
Seiten: 1
14.05.2012 07:14
TIFF
280x241,16M
Dateigröße: 107.08 KB
DPI: 96x96
Seiten: 1
14.05.2012 07:14
Montag, 14. Mai 2012, 8:14:32
JPEG TrueColor (vl.2)
280x241,16M
Dateigröße: 32.58 KB
DPI: 72x72
Seiten: 1
14.05.2012 07:15
Montag, 14. Mai 2012, 8:15:02
3 Kurzinformationen zu einem Bild in verschiedenen
Formaten (RAW, TIFF, JPEG).
Beispiel 2:
Wenn ein Textdokument im Rich Text Format (RTF) er-
stellt wurde, wäre eine Ausgabe im Portable Docu-
ment Format (PDF) mit exakt gleichem Wortlaut und
mit exakt gleichem Font noch authentisch, da sich
dabei Größe und innere Struktur der Textdatei und
damit Hashcodes und digitale Signaturen ändern?
Beispiel 3:
Wenn eine Bilddatei im RAW-Format aufgenommen,
zu einem TIFF entwickelt und anschließend als JPEG
gespeichert wurde - wo endet die Authentizität,
wenn Dynamikbereich und Farbraum geändert, das
Aussehen „verbessert" und die Datei verlustbehaftet
gespeichert wird - ohne dass visuell Unterschiede
erkennbar sind?
Diese oberflächlich banalen Fragen entpuppen sich
beim zweiten Blick als gar nicht so trivial. Abgesehen
von den oben genannten Dateigattungen, bei denen
eine zufriedenstellende Definition von Authentizität
für Langzeitarchivierung von archäologischen Unter-
lagen ohne allzu großen Aufwand zu erzielen sein
dürfte, beinhalten digitale Daten, die archäologischen
Interventionen entstammen, zum großen Teil nicht
nur textlichen oder bildlichen „Inhalt", sondern auch
komplexe Informationsstrukturen und „Funktionalitä-
ten". Deshalb ist das konventionelle Verständnis von
Authentizität für archäologische digitale Daten nicht
befriedigend. Einige weitere Beispiele sollen dies zeigen.
Beispiel 4:
Grabungsdatenbanken beinhalten nicht nur Daten-
sätze mit Informationen über die Grabung, sondern
auch Formulare zur Eingabe und Berichte zur Ausga-
be der Informationen sowie Funktionalitäten wie
Abfragen, Filter, SQL-Funktionen, Diagrammtools
etc., die den Umgang mit den in der Datenbank vor-
handenen Informationen erleichtern und eine Gra-
bungsauswertung ermöglichen. Hier ist der Begriff
„Authentizität" zu erweitern beziehungsweise anders
zu gewichten. Es muss also nicht nur der Sachinhalt
der Daten erhalten bleiben, sondern auch und vor
allem die Funktionalität - möglicherweise wird in die-
sem Fall das Erscheinungsbild geopfert werden müs-
sen, um die Funktionalität zu erhalten. Während es
zum Beispiel Grund zur Hoffnung gibt, dass ein PDF-
A-Dokument, das im Jahr 2005 abgelegt wurde, im
PDF-Viewer des Jahres 2020, auch nach möglichen
Migrationen zu neueren PDF-Formaten, zumindest im
Erscheinungsbild nicht von dem ursprünglich abge-
legten Dokument zu unterscheiden ist, wird dies bei-
spielsweise für eine im Jahr 2000 abgelegte, komplex
strukturierte „Paradox"-Datenbank sicher nicht der
Fall sein. Um den vollen Nutzen dieser Datenbank
über die Dauer der (permanenten) Archivierung zu
„retten", werden aller Wahrscheinlichkeit nach meh-
rere „Portierungen" beziehungsweise Migrationen
nötig sein.
Es wird sofort klar, dass das ursprüngliche Erschei-
nungsbild der Datenbank nicht zu erhalten ist. Bei der
Frage der Authentizität in diesem Szenario geht es
eben nicht vorwiegend um Inhalt und Erscheinungs-
bild. Es geht nicht darum, dass das Aussehen dessen,
was aus dem Archiv herauskommt, identisch sein soll-
te mit dem, was ursprünglich deponiert wurde, son-
dern dass Inhalt und Funktionalität erhalten bleiben.
Beispiel 5:
Bei CAD-Grabungsplänen ist die Situation etwas
anders. Hier geht es vorwiegend um eine Funktiona-
lität, bestehend aus Inhalt (aufgenommene Objekte,
Funde etc.) und Struktur (Aufbau der Ebenen und ihr
Verhältnis zueinander). Die Pläne spiegeln vielfältige
räumliche und inhaltliche Bezüge der erfassten Be-
funde, Funde, Schichten, Plana etc. wider. Daraus er-
gibt sich eine Vielzahl verschiedener Erscheinungs-
bilder mit unterschiedlichsten Aussagen innerhalb
derselben Datei. Eine CAD-Datei ist nicht einfach eine
„statische Zeichnung". Dies wäre der Fall, wenn ein
spezifischer Zustand einer CAD-Zeichnung als PDF-
Dokument „gedruckt" worden wäre. Dann würde sie
den Kriterien für Textdaten und Bitmaps (oben) ent-
sprechen. Die CAD-Datei kombiniert Ebenen (Layer),
die geometrische - und unter Umständen Sachinfor-
mationen - beinhalten können. Durch Zu- oder Ab-
schalten von Layern können in der gleichen Datei ver-