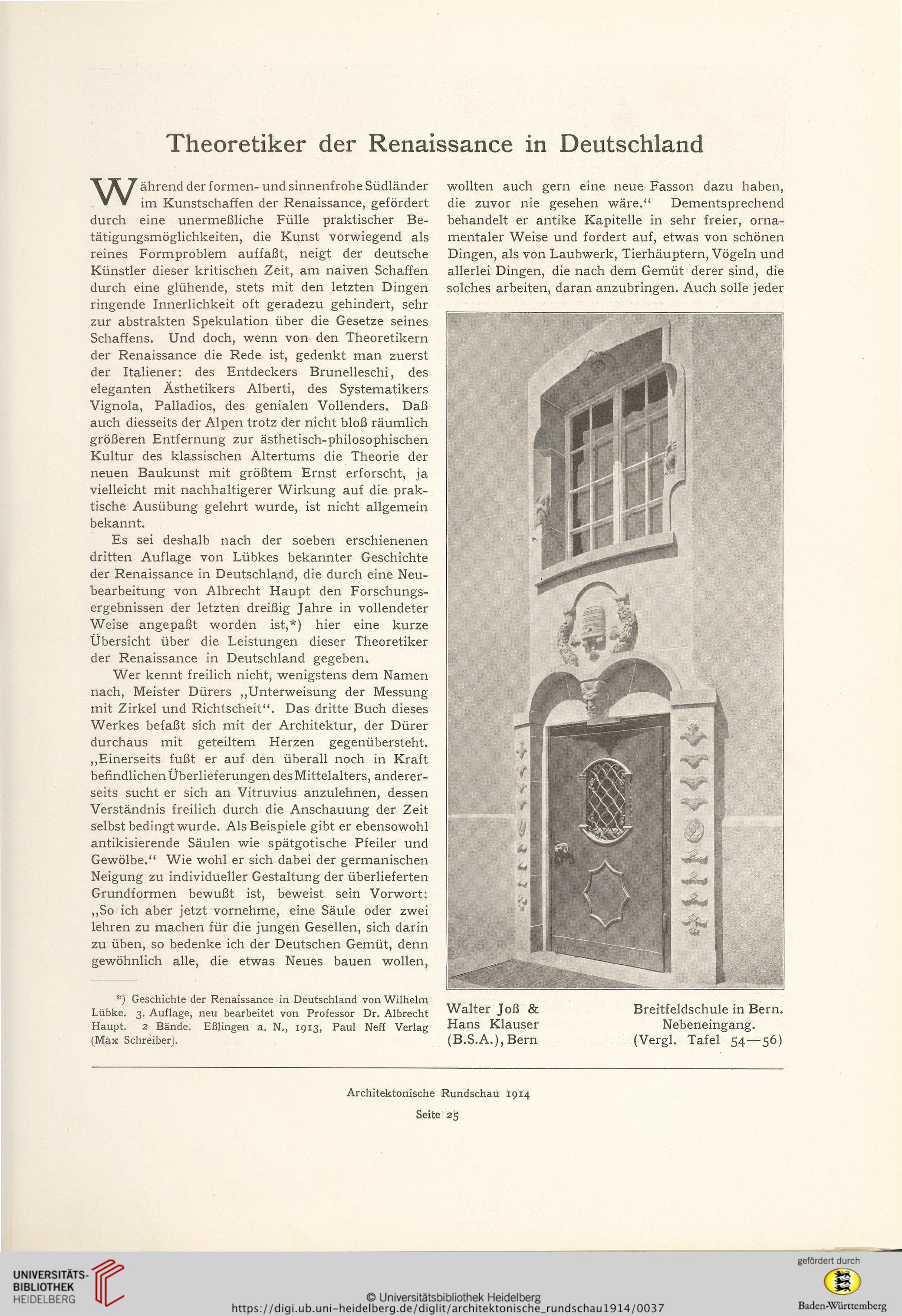Theoretiker der Renaissance in Deutschland
Während der formen- und sinnenfrohe Südländer
im Kunstschaffen der Renaissance, gefördert
durch eine unermeßliche Fülle praktischer Be-
tätigungsmöglichkeiten, die Kunst vorwiegend als
reines Formproblem auffaßt, neigt der deutsche
Künstler dieser kritischen Zeit, am naiven Schaffen
durch eine glühende, stets mit den letzten Dingen
ringende Innerlichkeit oft geradezu gehindert, sehr
zur abstrakten Spekulation über die Gesetze seines
Schaffens. Und doch, wenn von den Theoretikern
der Renaissance die Rede ist, gedenkt man zuerst
der Italiener: des Entdeckers Brunelleschi, des
eleganten Ästhetikers Alberti, des Systematikers
Vignola, Palladios, des genialen Vollenders. Daß
auch diesseits der Alpen trotz der nicht bloß räumlich
größeren Entfernung zur ästhetisch-philosophischen
Kultur des klassischen Altertums die Theorie der
neuen Baukunst mit größtem Ernst erforscht, ja
vielleicht mit nachhaltigerer Wirkung auf die prak-
tische Ausübung gelehrt wurde, ist nicht allgemein
bekannt.
Es sei deshalb nach der soeben erschienenen
dritten Auflage von Lübkes bekannter Geschichte
der Renaissance in Deutschland, die durch eine Neu-
bearbeitung von Albrecht Haupt den Forschungs-
ergebnissen der letzten dreißig Jahre in vollendeter
Weise angepaßt worden ist,*) hier eine kurze
Übersicht über die Leistungen dieser Theoretiker
der Renaissance in Deutschland gegeben.
Wer kennt freilich nicht, wenigstens dem Namen
nach, Meister Dürers ,,Unterweisung der Messung
mit Zirkel und Richtscheit“. Das dritte Buch dieses
Werkes befaßt sich mit der Architektur, der Dürer
durchaus mit geteiltem Herzen gegenübersteht.
,,Einerseits fußt er auf den überall noch in Kraft
befindlichen Überlieferungen des Mittelalters, anderer-
seits sucht er sich an Vitruvius anzulehnen, dessen
Verständnis freilich durch die Anschauung der Zeit
selbst bedingt wurde. Als Beispiele gibt er ebensowohl
antikisierende Säulen wie spätgotische Pfeiler und
Gewölbe.“ Wie wohl er sich dabei der germanischen
Neigung zu individueller Gestaltung der überlieferten
Grundformen bewußt ist, beweist sein Vorwort:
„So ich aber jetzt vornehme, eine Säule oder zwei
lehren zu machen für die jungen Gesellen, sich darin
zu üben, so bedenke ich der Deutschen Gemüt, denn
gewöhnlich alle, die etwas Neues bauen wollen,
*) Geschichte der Renaissance in Deutschland von Wilhelm
Lübke. 3. Auflage, neu bearbeitet von Professor Dr. Albrecht
Haupt. 2 Bände. Eßlingen a. N., 1913, Paul Neff Verlag
(Max Schreiber).
wollten auch gern eine neue Fasson dazu haben,
die zuvor nie gesehen wäre.“ Dementsprechend
behandelt er antike Kapitelle in sehr freier, orna-
mentaler Weise und fordert auf, etwas von schönen
Dingen, als von Laubwerk, Tierhäuptern, Vögeln und
allerlei Dingen, die nach dem Gemüt derer sind, die
solches arbeiten, daran anzubringen. Auch solle jeder
Walter Joß &
Hans Kiauser
(B.S.A.), Bern
Breitfeldschule in Bern.
Nebeneingang.
(Vergl. Tafel 54—56)
Architektonische Rundschau 1914
Seite 25
Während der formen- und sinnenfrohe Südländer
im Kunstschaffen der Renaissance, gefördert
durch eine unermeßliche Fülle praktischer Be-
tätigungsmöglichkeiten, die Kunst vorwiegend als
reines Formproblem auffaßt, neigt der deutsche
Künstler dieser kritischen Zeit, am naiven Schaffen
durch eine glühende, stets mit den letzten Dingen
ringende Innerlichkeit oft geradezu gehindert, sehr
zur abstrakten Spekulation über die Gesetze seines
Schaffens. Und doch, wenn von den Theoretikern
der Renaissance die Rede ist, gedenkt man zuerst
der Italiener: des Entdeckers Brunelleschi, des
eleganten Ästhetikers Alberti, des Systematikers
Vignola, Palladios, des genialen Vollenders. Daß
auch diesseits der Alpen trotz der nicht bloß räumlich
größeren Entfernung zur ästhetisch-philosophischen
Kultur des klassischen Altertums die Theorie der
neuen Baukunst mit größtem Ernst erforscht, ja
vielleicht mit nachhaltigerer Wirkung auf die prak-
tische Ausübung gelehrt wurde, ist nicht allgemein
bekannt.
Es sei deshalb nach der soeben erschienenen
dritten Auflage von Lübkes bekannter Geschichte
der Renaissance in Deutschland, die durch eine Neu-
bearbeitung von Albrecht Haupt den Forschungs-
ergebnissen der letzten dreißig Jahre in vollendeter
Weise angepaßt worden ist,*) hier eine kurze
Übersicht über die Leistungen dieser Theoretiker
der Renaissance in Deutschland gegeben.
Wer kennt freilich nicht, wenigstens dem Namen
nach, Meister Dürers ,,Unterweisung der Messung
mit Zirkel und Richtscheit“. Das dritte Buch dieses
Werkes befaßt sich mit der Architektur, der Dürer
durchaus mit geteiltem Herzen gegenübersteht.
,,Einerseits fußt er auf den überall noch in Kraft
befindlichen Überlieferungen des Mittelalters, anderer-
seits sucht er sich an Vitruvius anzulehnen, dessen
Verständnis freilich durch die Anschauung der Zeit
selbst bedingt wurde. Als Beispiele gibt er ebensowohl
antikisierende Säulen wie spätgotische Pfeiler und
Gewölbe.“ Wie wohl er sich dabei der germanischen
Neigung zu individueller Gestaltung der überlieferten
Grundformen bewußt ist, beweist sein Vorwort:
„So ich aber jetzt vornehme, eine Säule oder zwei
lehren zu machen für die jungen Gesellen, sich darin
zu üben, so bedenke ich der Deutschen Gemüt, denn
gewöhnlich alle, die etwas Neues bauen wollen,
*) Geschichte der Renaissance in Deutschland von Wilhelm
Lübke. 3. Auflage, neu bearbeitet von Professor Dr. Albrecht
Haupt. 2 Bände. Eßlingen a. N., 1913, Paul Neff Verlag
(Max Schreiber).
wollten auch gern eine neue Fasson dazu haben,
die zuvor nie gesehen wäre.“ Dementsprechend
behandelt er antike Kapitelle in sehr freier, orna-
mentaler Weise und fordert auf, etwas von schönen
Dingen, als von Laubwerk, Tierhäuptern, Vögeln und
allerlei Dingen, die nach dem Gemüt derer sind, die
solches arbeiten, daran anzubringen. Auch solle jeder
Walter Joß &
Hans Kiauser
(B.S.A.), Bern
Breitfeldschule in Bern.
Nebeneingang.
(Vergl. Tafel 54—56)
Architektonische Rundschau 1914
Seite 25