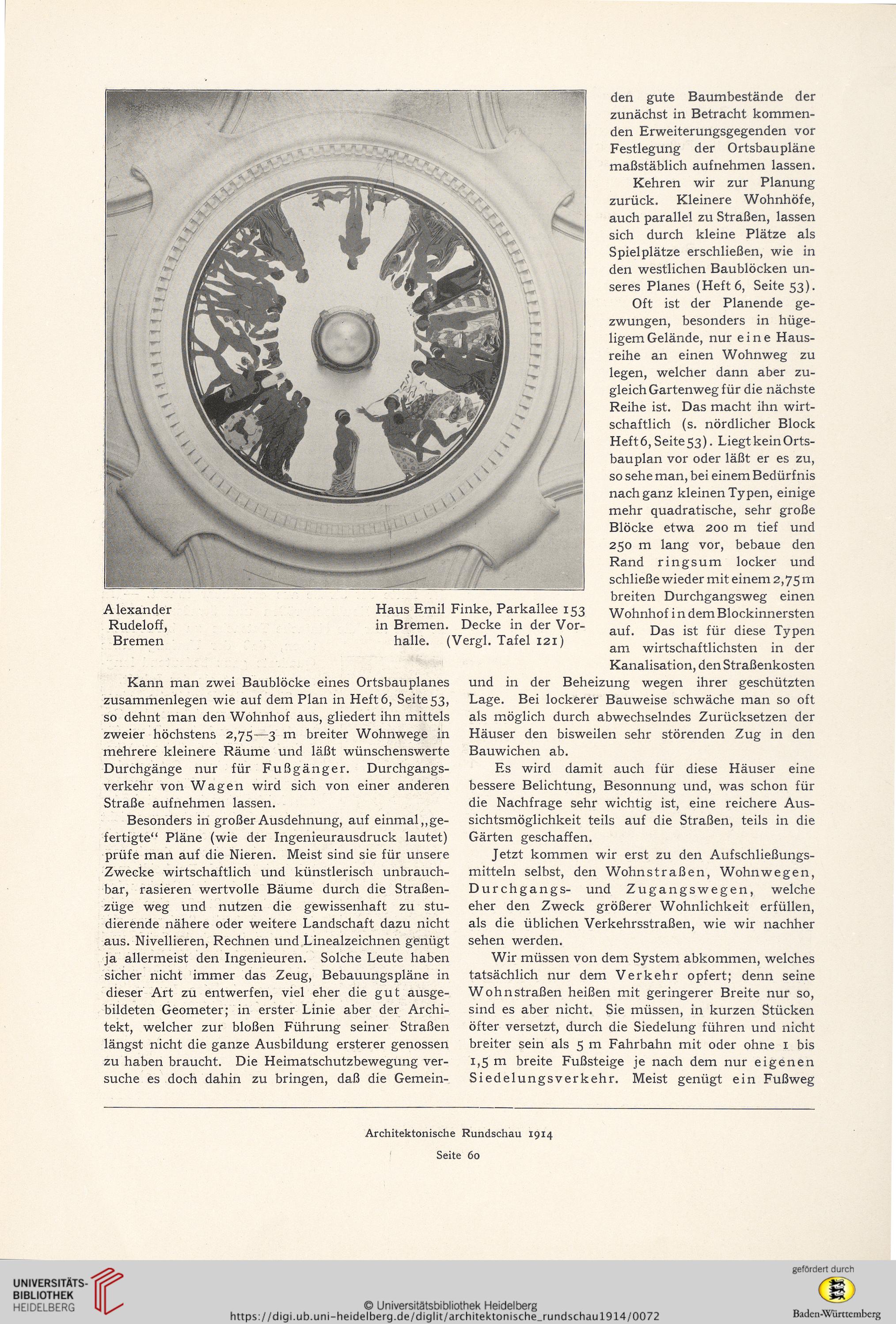Alexander Haus Emil Finke, Parkallee 153
Rudeloff, in Bremen. Decke in der Vor-
Bremen halle. (Vergl. Tafel 121)
Kann man zwei Baublöcke eines Ortsbauplanes
Zusammenlegen wie auf dem Plan in Heft 6, Seite 53,
so dehnt man den Wohnhof aus, gliedert ihn mittels
zweier höchstens 2,75—3 m breiter Wohnwege in
mehrere kleinere Räume und läßt wünschenswerte
Durchgänge nur für Fußgänger. Durchgangs-
verkehr von Wagen wird sich von einer anderen
Straße aufnehmen lassen.
Besonders in großer Ausdehnung, auf einmal,ge-
fertigte“ Pläne (wie der Ingenieurausdruck lautet)
prüfe man auf die Nieren. Meist sind sie für unsere
Zwecke wirtschaftlich und künstlerisch unbrauch-
bar, rasieren wertvolle Bäume durch die Straßen-
züge weg und nutzen die gewissenhaft zu stu-
dierende nähere oder weitere Landschaft dazu nicht
aus. Nivellieren, Rechnen und Linealzeichnen genügt
ja allermeist den Ingenieuren. Solche Leute haben
sicher nicht immer das Zeug, Bebauungspläne in
dieser Art zu entwerfen, viel eher die gut ausge-
bildeten Geometer; in erster Linie aber der Archi-
tekt, welcher zur bloßen Führung seiner Straßen
längst nicht die ganze Ausbildung ersterer genossen
zu haben braucht. Die Heimatschutzbewegung ver-
suche es doch dahin zu bringen, daß die Gemein-
den gute Baumbestände der
zunächst in Betracht kommen-
den Erweiterungsgegenden vor
Festlegung der Ortsbaupläne
maßstäblich auf nehmen lassen.
Kehren wir zur Planung
zurück. Kleinere Wohnhöfe,
auch parallel zu Straßen, lassen
sich durch kleine Plätze als
Spielplätze erschließen, wie in
den westlichen Baublöcken un-
seres Planes (Heft 6, Seite 53).
Oft ist der Planende ge-
zwungen, besonders in hüge-
ligem Gelände, nur eine Haus-
reihe an einen Wohnweg zu
legen, welcher dann aber zu-
gleich Gartenweg für die nächste
Reihe ist. Das macht ihn wirt-
schaftlich (s. nördlicher Block
Heftö, Seite53). Liegt kein Orts-
bauplan vor oder läßt er es zu,
so sehe man, bei einem Bedürfnis
nach ganz kleinen Typen, einige
mehr quadratische, sehr große
Blöcke etwa 200 m tief und
250 m lang vor, bebaue den
Rand ringsum locker und
schließe wieder mit einem 2,75 m
breiten Durchgangsweg einen
Wohnhof i n dem Blockinnersten
auf. Das ist für diese Typen
am wirtschaftlichsten in der
Kanalisation, den Straßenkosten
und in der Beheizung wegen ihrer geschützten
Lage. Bei lockerer Bauweise schwäche man so oft
als möglich durch abwechselndes Zurücksetzen der
Häuser den bisweilen sehr störenden Zug in den
Bauwichen ab.
Es wird damit auch für diese Häuser eine
bessere Belichtung, Besonnung und, was schon für
die Nachfrage sehr wichtig ist, eine reichere Aus-
sichtsmöglichkeit teils auf die Straßen, teils in die
Gärten geschaffen.
Jetzt kommen wir erst zu den Aufschließungs-
mitteln selbst, den Wohnstraßen, Wohnwegen,
Durchgangs- und Zugangswegen, welche
eher den Zweck größerer Wohnlichkeit erfüllen,
als die üblichen Verkehrsstraßen, wie wir nachher
sehen werden.
Wir müssen von dem System abkommen, welches
tatsächlich nur dem Verkehr opfert; denn seine
Wohnstraßen heißen mit geringerer Breite nur so,
sind es aber nicht. Sie müssen, in kurzen Stücken
öfter versetzt, durch die Siedelung führen und nicht
breiter sein als 5 m Fahrbahn mit oder ohne 1 bis
1,5 m breite Fußsteige je nach dem nur eigenen
Siedelungsverkehr. Meist genügt ein Fußweg
Architektonische Rundschau 1914
Seite 60
Rudeloff, in Bremen. Decke in der Vor-
Bremen halle. (Vergl. Tafel 121)
Kann man zwei Baublöcke eines Ortsbauplanes
Zusammenlegen wie auf dem Plan in Heft 6, Seite 53,
so dehnt man den Wohnhof aus, gliedert ihn mittels
zweier höchstens 2,75—3 m breiter Wohnwege in
mehrere kleinere Räume und läßt wünschenswerte
Durchgänge nur für Fußgänger. Durchgangs-
verkehr von Wagen wird sich von einer anderen
Straße aufnehmen lassen.
Besonders in großer Ausdehnung, auf einmal,ge-
fertigte“ Pläne (wie der Ingenieurausdruck lautet)
prüfe man auf die Nieren. Meist sind sie für unsere
Zwecke wirtschaftlich und künstlerisch unbrauch-
bar, rasieren wertvolle Bäume durch die Straßen-
züge weg und nutzen die gewissenhaft zu stu-
dierende nähere oder weitere Landschaft dazu nicht
aus. Nivellieren, Rechnen und Linealzeichnen genügt
ja allermeist den Ingenieuren. Solche Leute haben
sicher nicht immer das Zeug, Bebauungspläne in
dieser Art zu entwerfen, viel eher die gut ausge-
bildeten Geometer; in erster Linie aber der Archi-
tekt, welcher zur bloßen Führung seiner Straßen
längst nicht die ganze Ausbildung ersterer genossen
zu haben braucht. Die Heimatschutzbewegung ver-
suche es doch dahin zu bringen, daß die Gemein-
den gute Baumbestände der
zunächst in Betracht kommen-
den Erweiterungsgegenden vor
Festlegung der Ortsbaupläne
maßstäblich auf nehmen lassen.
Kehren wir zur Planung
zurück. Kleinere Wohnhöfe,
auch parallel zu Straßen, lassen
sich durch kleine Plätze als
Spielplätze erschließen, wie in
den westlichen Baublöcken un-
seres Planes (Heft 6, Seite 53).
Oft ist der Planende ge-
zwungen, besonders in hüge-
ligem Gelände, nur eine Haus-
reihe an einen Wohnweg zu
legen, welcher dann aber zu-
gleich Gartenweg für die nächste
Reihe ist. Das macht ihn wirt-
schaftlich (s. nördlicher Block
Heftö, Seite53). Liegt kein Orts-
bauplan vor oder läßt er es zu,
so sehe man, bei einem Bedürfnis
nach ganz kleinen Typen, einige
mehr quadratische, sehr große
Blöcke etwa 200 m tief und
250 m lang vor, bebaue den
Rand ringsum locker und
schließe wieder mit einem 2,75 m
breiten Durchgangsweg einen
Wohnhof i n dem Blockinnersten
auf. Das ist für diese Typen
am wirtschaftlichsten in der
Kanalisation, den Straßenkosten
und in der Beheizung wegen ihrer geschützten
Lage. Bei lockerer Bauweise schwäche man so oft
als möglich durch abwechselndes Zurücksetzen der
Häuser den bisweilen sehr störenden Zug in den
Bauwichen ab.
Es wird damit auch für diese Häuser eine
bessere Belichtung, Besonnung und, was schon für
die Nachfrage sehr wichtig ist, eine reichere Aus-
sichtsmöglichkeit teils auf die Straßen, teils in die
Gärten geschaffen.
Jetzt kommen wir erst zu den Aufschließungs-
mitteln selbst, den Wohnstraßen, Wohnwegen,
Durchgangs- und Zugangswegen, welche
eher den Zweck größerer Wohnlichkeit erfüllen,
als die üblichen Verkehrsstraßen, wie wir nachher
sehen werden.
Wir müssen von dem System abkommen, welches
tatsächlich nur dem Verkehr opfert; denn seine
Wohnstraßen heißen mit geringerer Breite nur so,
sind es aber nicht. Sie müssen, in kurzen Stücken
öfter versetzt, durch die Siedelung führen und nicht
breiter sein als 5 m Fahrbahn mit oder ohne 1 bis
1,5 m breite Fußsteige je nach dem nur eigenen
Siedelungsverkehr. Meist genügt ein Fußweg
Architektonische Rundschau 1914
Seite 60