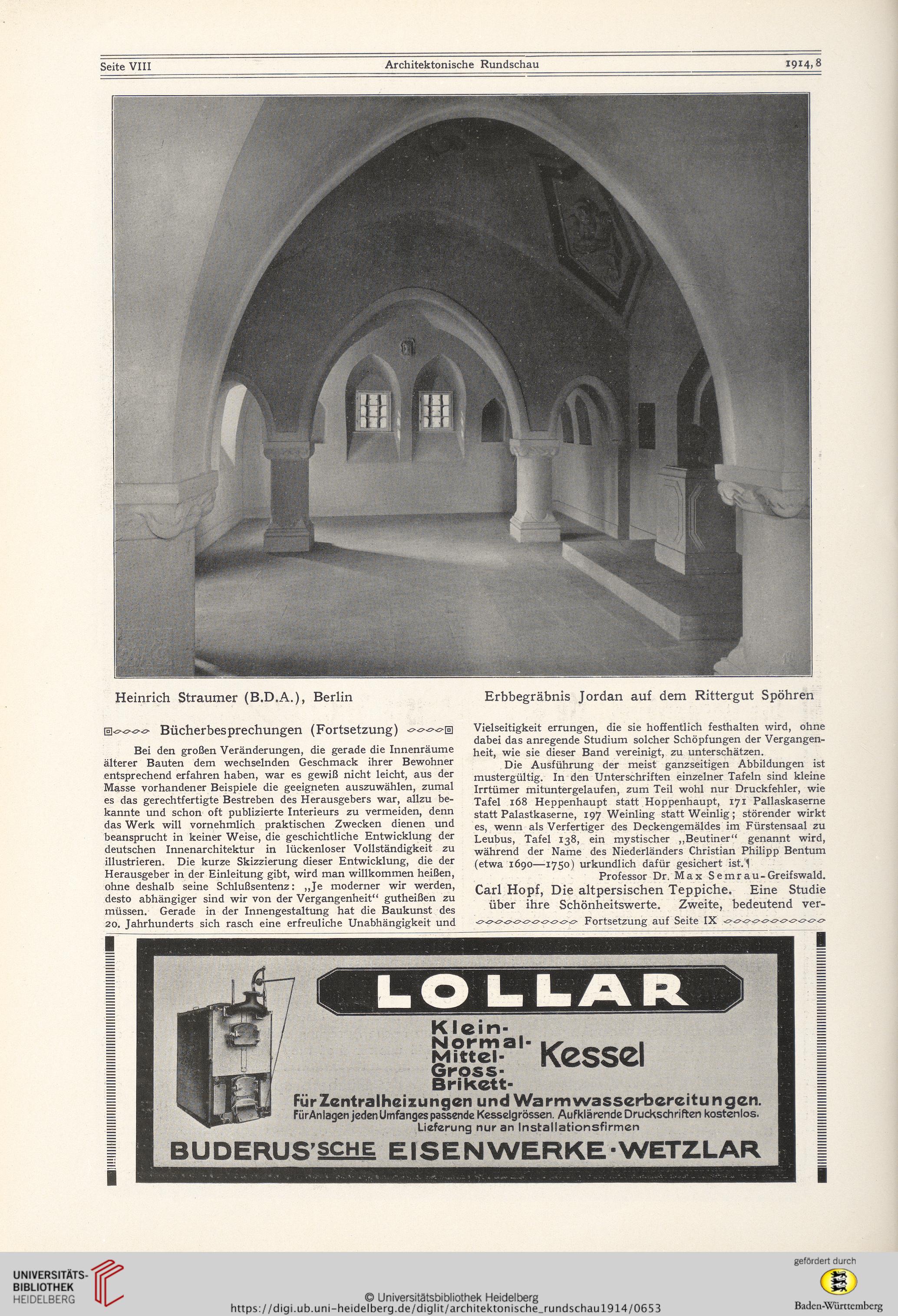Seite VIII Architektonische Rundschau _1914,8
Heinrich Straumer (B.D.A.), Berlin Erbbegräbnis Jordan auf dem Rittergut Spöhren
Bücherbesprechungen (Fortsetzung)
Bei den großen Veränderungen, die gerade die Innenräume
älterer Bauten dem wechselnden Geschmack ihrer Bewohner
entsprechend erfahren haben, war es gewiß nicht leicht, aus der
Masse vorhandener Beispiele die geeigneten auszuwählen, zumal
es das gerechtfertigte Bestreben des Herausgebers war, allzu be-
kannte und schon oft publizierte Interieurs zu vermeiden, denn
das Werk will vornehmlich praktischen Zwecken dienen und
beansprucht in keiner Weise, die geschichtliche Entwicklung der
deutschen Innenarchitektur in lückenloser Vollständigkeit zu
illustrieren. Die kurze Skizzierung dieser Entwicklung, die der
Herausgeber in der Einleitung gibt, wird man willkommen heißen,
ohne deshalb seine Schlußsentenz: „Je moderner wir werden,
desto abhängiger sind wir von der Vergangenheit“ gutheißen zu
müssen. Gerade in der Innengestaltung hat die Baukunst des
20. Jahrhunderts sich rasch eine erfreuliche Unabhängigkeit und
Vielseitigkeit errungen, die sie hoffentlich festhalten wird, ohne
dabei das anregende Studium solcher Schöpfungen der Vergangen-
heit, wie sie dieser Band vereinigt, zu unterschätzen.
Die Ausführung der meist ganzseitigen Abbildungen ist
mustergültig. In den Unterschriften einzelner Tafeln sind kleine
Irrtümer mituntergelaufen, zum Teil wohl nur Druckfehler, wie
Tafel 168 Heppenhaupt statt Hoppenhaupt, 171 Pallaskaserne
statt Palastkaserne, 197 Weinling statt Weinlig; störender wirkt
es, wenn als Verfertiger des Deckengemäldes im Fürstensaal zu
Leubus, Tafel 138, ein mystischer „Beutiner“ genannt wird,
während der Name des Niederländers Christian Philipp Bentum
(etwa 1690—1750) urkundlich dafür gesichert ist.1
Professor Dr. Max Semrau-Greifswald.
Carl Hopf, Die altpersischen Teppiche. Eine Studie
über ihre Schönheitswerte. Zweite, bedeutend ver-
Fortsetzung auf Seite IX
I
I
Heinrich Straumer (B.D.A.), Berlin Erbbegräbnis Jordan auf dem Rittergut Spöhren
Bücherbesprechungen (Fortsetzung)
Bei den großen Veränderungen, die gerade die Innenräume
älterer Bauten dem wechselnden Geschmack ihrer Bewohner
entsprechend erfahren haben, war es gewiß nicht leicht, aus der
Masse vorhandener Beispiele die geeigneten auszuwählen, zumal
es das gerechtfertigte Bestreben des Herausgebers war, allzu be-
kannte und schon oft publizierte Interieurs zu vermeiden, denn
das Werk will vornehmlich praktischen Zwecken dienen und
beansprucht in keiner Weise, die geschichtliche Entwicklung der
deutschen Innenarchitektur in lückenloser Vollständigkeit zu
illustrieren. Die kurze Skizzierung dieser Entwicklung, die der
Herausgeber in der Einleitung gibt, wird man willkommen heißen,
ohne deshalb seine Schlußsentenz: „Je moderner wir werden,
desto abhängiger sind wir von der Vergangenheit“ gutheißen zu
müssen. Gerade in der Innengestaltung hat die Baukunst des
20. Jahrhunderts sich rasch eine erfreuliche Unabhängigkeit und
Vielseitigkeit errungen, die sie hoffentlich festhalten wird, ohne
dabei das anregende Studium solcher Schöpfungen der Vergangen-
heit, wie sie dieser Band vereinigt, zu unterschätzen.
Die Ausführung der meist ganzseitigen Abbildungen ist
mustergültig. In den Unterschriften einzelner Tafeln sind kleine
Irrtümer mituntergelaufen, zum Teil wohl nur Druckfehler, wie
Tafel 168 Heppenhaupt statt Hoppenhaupt, 171 Pallaskaserne
statt Palastkaserne, 197 Weinling statt Weinlig; störender wirkt
es, wenn als Verfertiger des Deckengemäldes im Fürstensaal zu
Leubus, Tafel 138, ein mystischer „Beutiner“ genannt wird,
während der Name des Niederländers Christian Philipp Bentum
(etwa 1690—1750) urkundlich dafür gesichert ist.1
Professor Dr. Max Semrau-Greifswald.
Carl Hopf, Die altpersischen Teppiche. Eine Studie
über ihre Schönheitswerte. Zweite, bedeutend ver-
Fortsetzung auf Seite IX
I
I