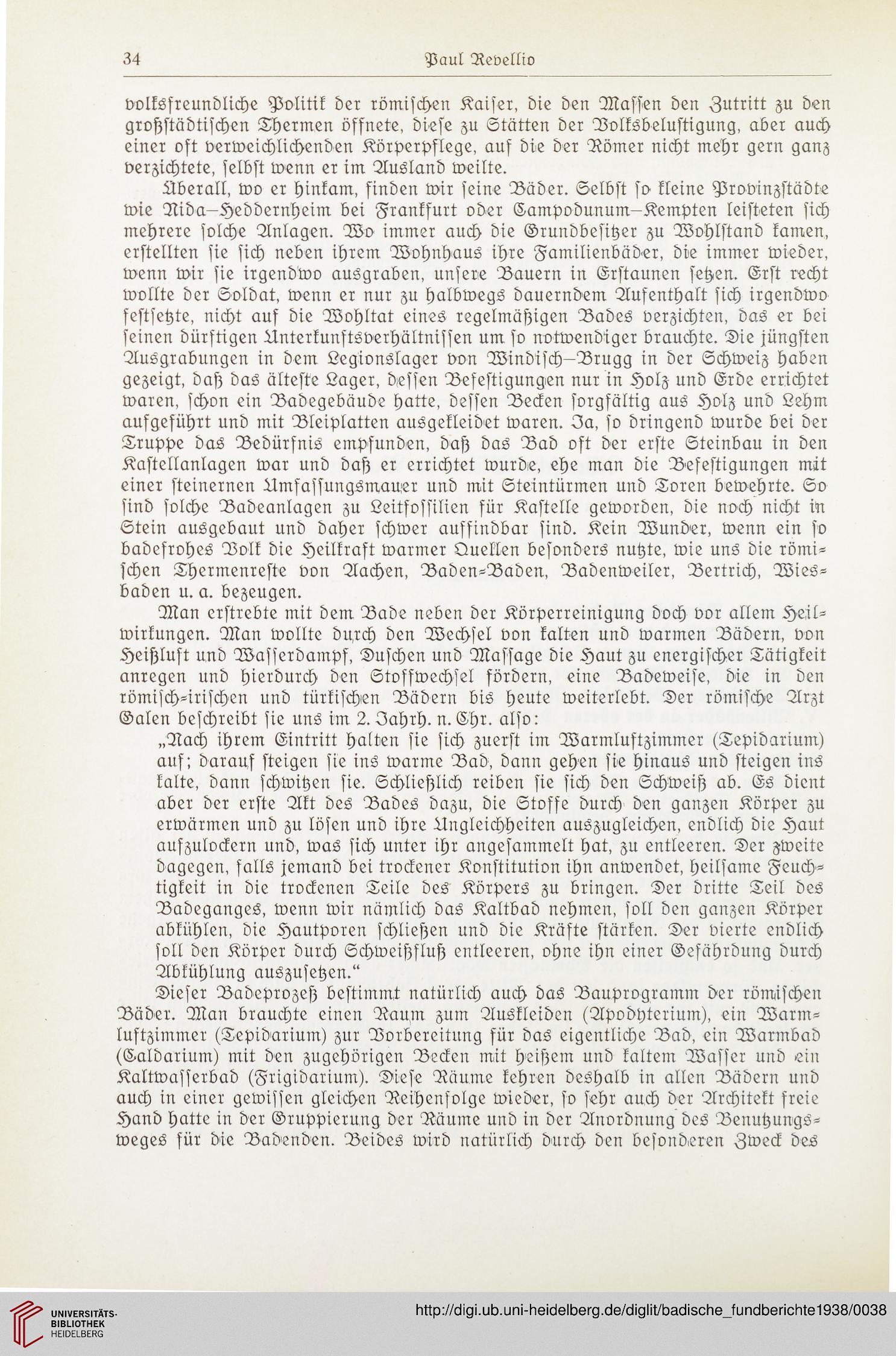34
Paul Revellio
volksfreundliche Politik der römischen Kaiser, die den Massen den Zutritt zu den
großstädtischen Thermen öffnete, diese zu Stätten der Volksbelustigung, aber auch
einer oft verweichlichenden Körperpflege, auf die der Römer nicht mehr gern ganz
verzichtete, selbst wenn er im Ausland weilte.
Liberal!, wo er hinkam, finden wir seine Bäder. Selbst so kleine Provinzstädte
wie Nida-Heddernheim bei Frankfurt oder Campodunum-Kempten leisteten sich
mehrere solche Anlagen. Wo immer auch die Grundbesitzer zu Wohlstand kamen,
erstellten sie sich neben ihrem Wohnhaus ihre Familienbäder, die immer wieder,
wenn wir sie irgendwo ausgraben, unsere Bauern in Erstaunen setzen. Erst recht
wollte der Soldat, wenn er nur zu Halbwegs dauerndem Aufenthalt sich irgendwo
festsetzte, nicht auf die Wohltat eines regelmäßigen Bades verzichten, das er bei
seinen dürftigen Llnterkunstsderhältnissen um so notwendiger brauchte. Die jüngsten
Ausgrabungen in dem Legionslager von Windisch-Brugg in der Schweiz haben
gezeigt, daß das älteste Lager, dessen Befestigungen nur in Holz und Erde errichtet
waren, schon ein Badegebäude hatte, dessen Becken sorgfältig aus Holz und Lehm
aufgeführt und mit Bleiplatten ausgekleidet waren. Ja, so dringend wurde bei der
Truppe das Bedürfnis empfunden, daß das Bad oft der erste Steinbau in den
Kastellanlagen war und daß er errichtet wurde, ehe man die Befestigungen mit
einer steinernen Umfassungsmauer und mit Steintürmen und Toren bewehrte. So
sind solche Badeanlagen zu Leitfossilien für Kastelle geworden, die noch nicht in
Stein ausgebaut und daher schwer auffindbar sind. Kein Wunder, wenn ein so
badefrohes Volk die Heilkraft warmer Quellen besonders nutzte, wie uns die römi-
schen Thermenreste von Aachen, Baden-Baden, Badenweiler, Bertrich, Wies-
baden u. a. bezeugen.
Man erstrebte mit dem Bade neben der Körperreinigung doch vor allem Heil-
wirkungen. Man wollte dupch den Wechsel von kalten und warmen Bädern, von
Heißluft und Wasserdampf, Duschen und Massage die Haut zu energischer Tätigkeit
anregen und hierdurch den Stoffwechsel fördern, eine Badeweise, die in den
römisch-irischen und türkischen Bädern bis heute weiterlebt. Der römische Arzt
Galen beschreibt sie uns im 2. Iahrh. n. Ehr. also:
„Nach ihrem Eintritt halten sie sich zuerst im Warmluftzimmer (Tepidarium)
auf; darauf steigen sie ins warme Bad, dann gehen sie hinaus und steigen ins
kalte, dann schwitzen sie. Schließlich reiben sie sich den Schweiß ab. Es dient
aber der erste Akt des Bades dazu, die Stoffe durch den ganzen Körper zu
erwärmen und zu lösen und ihre Ungleichheiten auszugleichen, endlich die Haut
aufzulockern und, was sich unter ihr angesammelt hat, zu entleeren. Der zweite
dagegen, falls jemand bei trockener Konstitution ihn anwendet, heilsame Feuch-
tigkeit in die trockenen Teile des Körpers zu bringen. Der dritte Teil des
Badeganges, wenn wir nämlich das Kaltbad nehmen, soll den ganzen Körper
abkühlen, die Hautporen schließen und die Kräfte stärken. Der vierte endlich
soll den Körper durch Schweißfluh entleeren, ohne ihn einer Gefährdung durch
Abkühlung auszusetzen."
Dieser Badeprozeh bestimmt natürlich auch das Bauprogramm der römischen
Bäder. Man brauchte einen Rau,m zum Auskleiden (Apodhterium), ein Warm-
luftzimmer (Tepidarium) zur Vorbereitung für das eigentliche Bad, ein Warmbad
(Ealdarium) mit den zugehörigen Becken mit heißem und kaltem Wasser und «ein
Kaltwasserbad (Frigidarium). Diese Räume kehren deshalb in allen Bädern und
auch in einer gewissen gleichen Reihenfolge wieder, so sehr auch der Architekt freie
Hand hatte in der Gruppierung der Räume und in der Anordnung des Benutzungs-
weges für die Badenden. Beides wird natürlich durch den besonderen Zweck des
Paul Revellio
volksfreundliche Politik der römischen Kaiser, die den Massen den Zutritt zu den
großstädtischen Thermen öffnete, diese zu Stätten der Volksbelustigung, aber auch
einer oft verweichlichenden Körperpflege, auf die der Römer nicht mehr gern ganz
verzichtete, selbst wenn er im Ausland weilte.
Liberal!, wo er hinkam, finden wir seine Bäder. Selbst so kleine Provinzstädte
wie Nida-Heddernheim bei Frankfurt oder Campodunum-Kempten leisteten sich
mehrere solche Anlagen. Wo immer auch die Grundbesitzer zu Wohlstand kamen,
erstellten sie sich neben ihrem Wohnhaus ihre Familienbäder, die immer wieder,
wenn wir sie irgendwo ausgraben, unsere Bauern in Erstaunen setzen. Erst recht
wollte der Soldat, wenn er nur zu Halbwegs dauerndem Aufenthalt sich irgendwo
festsetzte, nicht auf die Wohltat eines regelmäßigen Bades verzichten, das er bei
seinen dürftigen Llnterkunstsderhältnissen um so notwendiger brauchte. Die jüngsten
Ausgrabungen in dem Legionslager von Windisch-Brugg in der Schweiz haben
gezeigt, daß das älteste Lager, dessen Befestigungen nur in Holz und Erde errichtet
waren, schon ein Badegebäude hatte, dessen Becken sorgfältig aus Holz und Lehm
aufgeführt und mit Bleiplatten ausgekleidet waren. Ja, so dringend wurde bei der
Truppe das Bedürfnis empfunden, daß das Bad oft der erste Steinbau in den
Kastellanlagen war und daß er errichtet wurde, ehe man die Befestigungen mit
einer steinernen Umfassungsmauer und mit Steintürmen und Toren bewehrte. So
sind solche Badeanlagen zu Leitfossilien für Kastelle geworden, die noch nicht in
Stein ausgebaut und daher schwer auffindbar sind. Kein Wunder, wenn ein so
badefrohes Volk die Heilkraft warmer Quellen besonders nutzte, wie uns die römi-
schen Thermenreste von Aachen, Baden-Baden, Badenweiler, Bertrich, Wies-
baden u. a. bezeugen.
Man erstrebte mit dem Bade neben der Körperreinigung doch vor allem Heil-
wirkungen. Man wollte dupch den Wechsel von kalten und warmen Bädern, von
Heißluft und Wasserdampf, Duschen und Massage die Haut zu energischer Tätigkeit
anregen und hierdurch den Stoffwechsel fördern, eine Badeweise, die in den
römisch-irischen und türkischen Bädern bis heute weiterlebt. Der römische Arzt
Galen beschreibt sie uns im 2. Iahrh. n. Ehr. also:
„Nach ihrem Eintritt halten sie sich zuerst im Warmluftzimmer (Tepidarium)
auf; darauf steigen sie ins warme Bad, dann gehen sie hinaus und steigen ins
kalte, dann schwitzen sie. Schließlich reiben sie sich den Schweiß ab. Es dient
aber der erste Akt des Bades dazu, die Stoffe durch den ganzen Körper zu
erwärmen und zu lösen und ihre Ungleichheiten auszugleichen, endlich die Haut
aufzulockern und, was sich unter ihr angesammelt hat, zu entleeren. Der zweite
dagegen, falls jemand bei trockener Konstitution ihn anwendet, heilsame Feuch-
tigkeit in die trockenen Teile des Körpers zu bringen. Der dritte Teil des
Badeganges, wenn wir nämlich das Kaltbad nehmen, soll den ganzen Körper
abkühlen, die Hautporen schließen und die Kräfte stärken. Der vierte endlich
soll den Körper durch Schweißfluh entleeren, ohne ihn einer Gefährdung durch
Abkühlung auszusetzen."
Dieser Badeprozeh bestimmt natürlich auch das Bauprogramm der römischen
Bäder. Man brauchte einen Rau,m zum Auskleiden (Apodhterium), ein Warm-
luftzimmer (Tepidarium) zur Vorbereitung für das eigentliche Bad, ein Warmbad
(Ealdarium) mit den zugehörigen Becken mit heißem und kaltem Wasser und «ein
Kaltwasserbad (Frigidarium). Diese Räume kehren deshalb in allen Bädern und
auch in einer gewissen gleichen Reihenfolge wieder, so sehr auch der Architekt freie
Hand hatte in der Gruppierung der Räume und in der Anordnung des Benutzungs-
weges für die Badenden. Beides wird natürlich durch den besonderen Zweck des