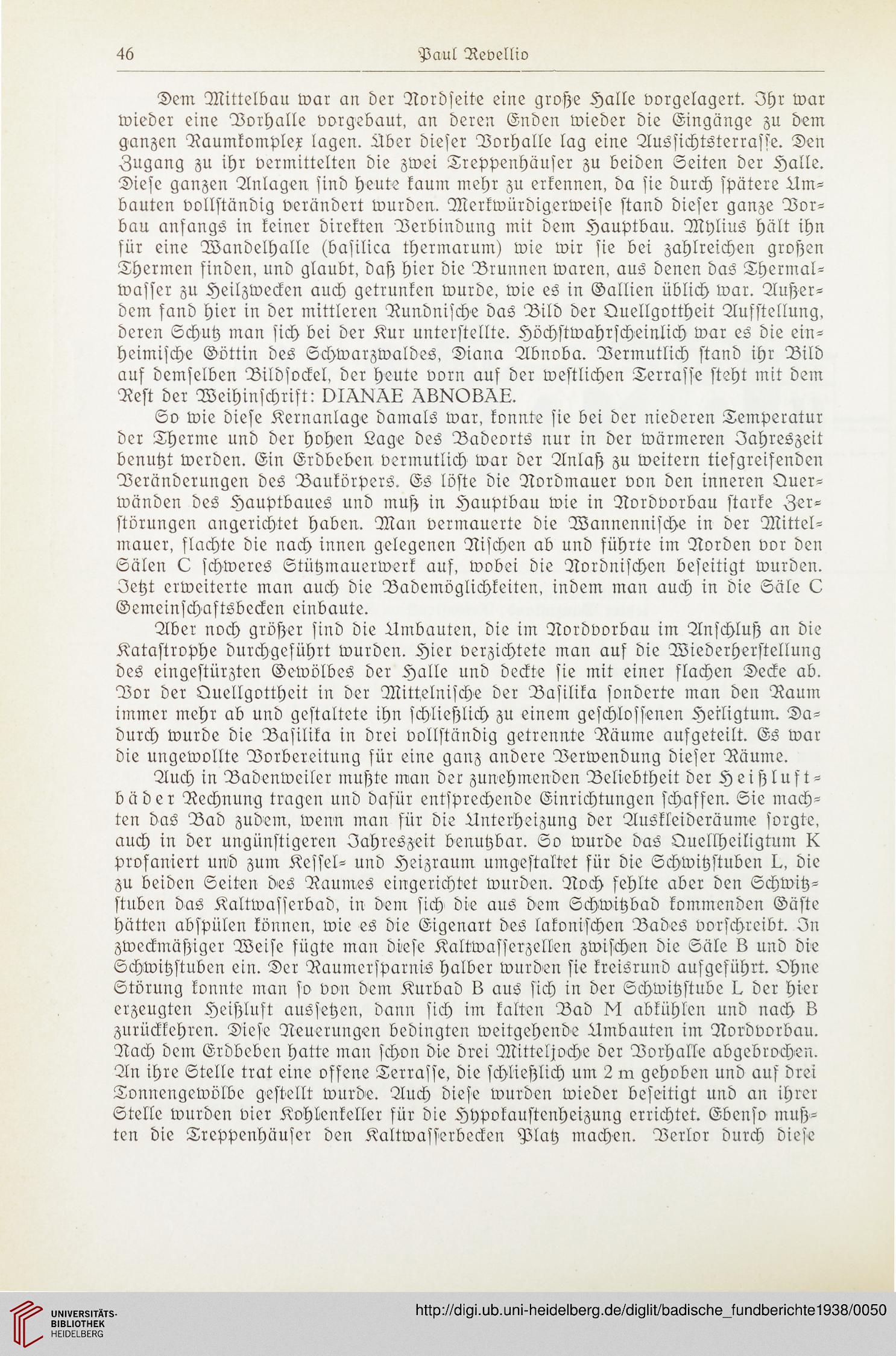46
Paul Revellio
Dem Mittelbau war an der Nordseite eine große Halle vorgelagert. Ihr war
wieder eine Vorhalle vorgebaut, an deren Enden wieder die Eingänge zu dem
ganzen Raumkomplex lagen. Aber dieser Vorhalle lag eine Aussichtsterrasse. Den
Zugang zu ihr vermittelten die zwei Treppenhäuser zu beiden Seiten der Halle.
Diese ganzen Anlagen sind heute kaum mehr zu erkennen, da sie durch spätere Um-
bauten vollständig verändert wurden. Merkwürdigerweise stand dieser ganze Vor-
bau anfangs in keiner direkten Verbindung mit dem Hauptbau. Mylius hält ihn
für eine Wandelhalle (bafilica thermarum) wie wir sie bei zahlreichen großen
Thermen finden, und glaubt, daß hier die Brunnen waren, aus denen das Thermal-
wafser zu Heilzwecken auch getrunken wurde, wie es in Gallien üblich war. Außer-
dem fand hier in der mittleren Rundnische das Bild der Quellgottheit Aufstellung,
deren Schuh man sich bei der Kur unterstellte. Höchstwahrscheinlich war es die ein-
heimische Göttin des Schwarzwaldes, Diana Abnoba. Vermutlich stand ihr Bild
auf demselben Bildfockel, der heute vorn auf der westlichen Terrasse steht mit dem
Rest der Weihinschrift: Ä.8Xl08^8.
So wie diese Kernanlage damals war, konnte sie bei der niederen Temperatur
der Therme und der hohen Lage des Badeorts nur in der wärmeren Jahreszeit
benutzt werden. Ein Erdbeben vermutlich war der Anlaß zu weitern tiefgreifenden
Veränderungen des Baukörpers. Es löste die Nordmauer von den inneren Quer-
wänden des Hauptbaues und muß in Hauptbau wie in Nordvorbau starke Zer-
störungen angerichtet haben. Man vermauerte die Wannennische in der Mittel-
mauer, flachte die nach innen gelegenen Nischen ab und führte im Norden vor den
Sälen E schweres Stützmauerwerk auf, wobei die Nordnischen beseitigt wurden.
Jetzt erweiterte man auch die Bademöglichkeiten, indem man auch in die Säle L
Gemeinschaftsbecken einbaute.
Aber noch größer sind die Umbauten, die im Nordvorbau im Anschluß an die
Katastrophe durchgeführt wurden. Hier verzichtete man auf die Wiederherstellung
des eingestürzten Gewölbes der Halle und deckte sie mit einer flachen Decke ab.
Vor der Quellgottheit in der Mittelnische der Basilika sonderte man den Raum
immer mehr ab und gestaltete ihn schließlich zu einem geschlossenen Heiligtum. Da-
durch wurde die Basilika in drei vollständig getrennte Räume aufgeteilt. Es war
die ungewollte Vorbereitung für eine ganz andere Verwendung dieser Räume.
Auch in Badenweiler mußte man der zunehmenden Beliebtheit der Heißluft-
bäder Rechnung tragen und dafür entsprechende Einrichtungen schaffen. Sie mach-
ten das Bad zudem, wenn man für die Anterheizung der Auskleideräume sorgte,
auch in der ungünstigeren Jahreszeit benutzbar. So wurde das Quellheiligtum X
profaniert urtd zum Kessel- und Heizraum umgestaltet für die Schwitzstuben 8, die
zu beiden Seiten des Raumes eingerichtet wurden. Noch fehlte aber den Schwitz-
stuben das Kaltwasserbad, in dem sich die aus dem Schwitzbad kommenden Gäste
hätten abspülen können, wie es die Eigenart des lakonischen Bades vorschreibt. In
zweckmäßiger Weise fügte man diese Kaltwasserzellen zwischen die Säle 8 und die
Schwitzstuben ein. Der Raumersparnis halber wurden sie kreisrund ausgesührt. Ohne
Störung konnte man so von dem Kurbad 8 aus sich in der Schwitzstube 8 der hier
erzeugten Heißluft aussetzen, dann sich im kalten Bad dck abkühlen und nach 8
zurückkehren. Diese Neuerungen bedingten weitgehende Ambauten im Nordvorbau.
Nach dein Erdbeben hatte man schon die drei Mitteljoche der Vorhalle abgebrochen.
An ihre Stelle trat eine offene Terrasse, die schließlich um 2 m gehoben und auf drei
Tonnengewölbe gestellt wurde. Auch diese wurden wieder beseitigt und an ihrer
Stelle wurden vier Kohlenkeller für die Hhpokaustenheizung errichtet. Ebenso muß-
ten die Treppenhäuser den Kaltwasserbecken Platz machen. Verlor durch diese
Paul Revellio
Dem Mittelbau war an der Nordseite eine große Halle vorgelagert. Ihr war
wieder eine Vorhalle vorgebaut, an deren Enden wieder die Eingänge zu dem
ganzen Raumkomplex lagen. Aber dieser Vorhalle lag eine Aussichtsterrasse. Den
Zugang zu ihr vermittelten die zwei Treppenhäuser zu beiden Seiten der Halle.
Diese ganzen Anlagen sind heute kaum mehr zu erkennen, da sie durch spätere Um-
bauten vollständig verändert wurden. Merkwürdigerweise stand dieser ganze Vor-
bau anfangs in keiner direkten Verbindung mit dem Hauptbau. Mylius hält ihn
für eine Wandelhalle (bafilica thermarum) wie wir sie bei zahlreichen großen
Thermen finden, und glaubt, daß hier die Brunnen waren, aus denen das Thermal-
wafser zu Heilzwecken auch getrunken wurde, wie es in Gallien üblich war. Außer-
dem fand hier in der mittleren Rundnische das Bild der Quellgottheit Aufstellung,
deren Schuh man sich bei der Kur unterstellte. Höchstwahrscheinlich war es die ein-
heimische Göttin des Schwarzwaldes, Diana Abnoba. Vermutlich stand ihr Bild
auf demselben Bildfockel, der heute vorn auf der westlichen Terrasse steht mit dem
Rest der Weihinschrift: Ä.8Xl08^8.
So wie diese Kernanlage damals war, konnte sie bei der niederen Temperatur
der Therme und der hohen Lage des Badeorts nur in der wärmeren Jahreszeit
benutzt werden. Ein Erdbeben vermutlich war der Anlaß zu weitern tiefgreifenden
Veränderungen des Baukörpers. Es löste die Nordmauer von den inneren Quer-
wänden des Hauptbaues und muß in Hauptbau wie in Nordvorbau starke Zer-
störungen angerichtet haben. Man vermauerte die Wannennische in der Mittel-
mauer, flachte die nach innen gelegenen Nischen ab und führte im Norden vor den
Sälen E schweres Stützmauerwerk auf, wobei die Nordnischen beseitigt wurden.
Jetzt erweiterte man auch die Bademöglichkeiten, indem man auch in die Säle L
Gemeinschaftsbecken einbaute.
Aber noch größer sind die Umbauten, die im Nordvorbau im Anschluß an die
Katastrophe durchgeführt wurden. Hier verzichtete man auf die Wiederherstellung
des eingestürzten Gewölbes der Halle und deckte sie mit einer flachen Decke ab.
Vor der Quellgottheit in der Mittelnische der Basilika sonderte man den Raum
immer mehr ab und gestaltete ihn schließlich zu einem geschlossenen Heiligtum. Da-
durch wurde die Basilika in drei vollständig getrennte Räume aufgeteilt. Es war
die ungewollte Vorbereitung für eine ganz andere Verwendung dieser Räume.
Auch in Badenweiler mußte man der zunehmenden Beliebtheit der Heißluft-
bäder Rechnung tragen und dafür entsprechende Einrichtungen schaffen. Sie mach-
ten das Bad zudem, wenn man für die Anterheizung der Auskleideräume sorgte,
auch in der ungünstigeren Jahreszeit benutzbar. So wurde das Quellheiligtum X
profaniert urtd zum Kessel- und Heizraum umgestaltet für die Schwitzstuben 8, die
zu beiden Seiten des Raumes eingerichtet wurden. Noch fehlte aber den Schwitz-
stuben das Kaltwasserbad, in dem sich die aus dem Schwitzbad kommenden Gäste
hätten abspülen können, wie es die Eigenart des lakonischen Bades vorschreibt. In
zweckmäßiger Weise fügte man diese Kaltwasserzellen zwischen die Säle 8 und die
Schwitzstuben ein. Der Raumersparnis halber wurden sie kreisrund ausgesührt. Ohne
Störung konnte man so von dem Kurbad 8 aus sich in der Schwitzstube 8 der hier
erzeugten Heißluft aussetzen, dann sich im kalten Bad dck abkühlen und nach 8
zurückkehren. Diese Neuerungen bedingten weitgehende Ambauten im Nordvorbau.
Nach dein Erdbeben hatte man schon die drei Mitteljoche der Vorhalle abgebrochen.
An ihre Stelle trat eine offene Terrasse, die schließlich um 2 m gehoben und auf drei
Tonnengewölbe gestellt wurde. Auch diese wurden wieder beseitigt und an ihrer
Stelle wurden vier Kohlenkeller für die Hhpokaustenheizung errichtet. Ebenso muß-
ten die Treppenhäuser den Kaltwasserbecken Platz machen. Verlor durch diese