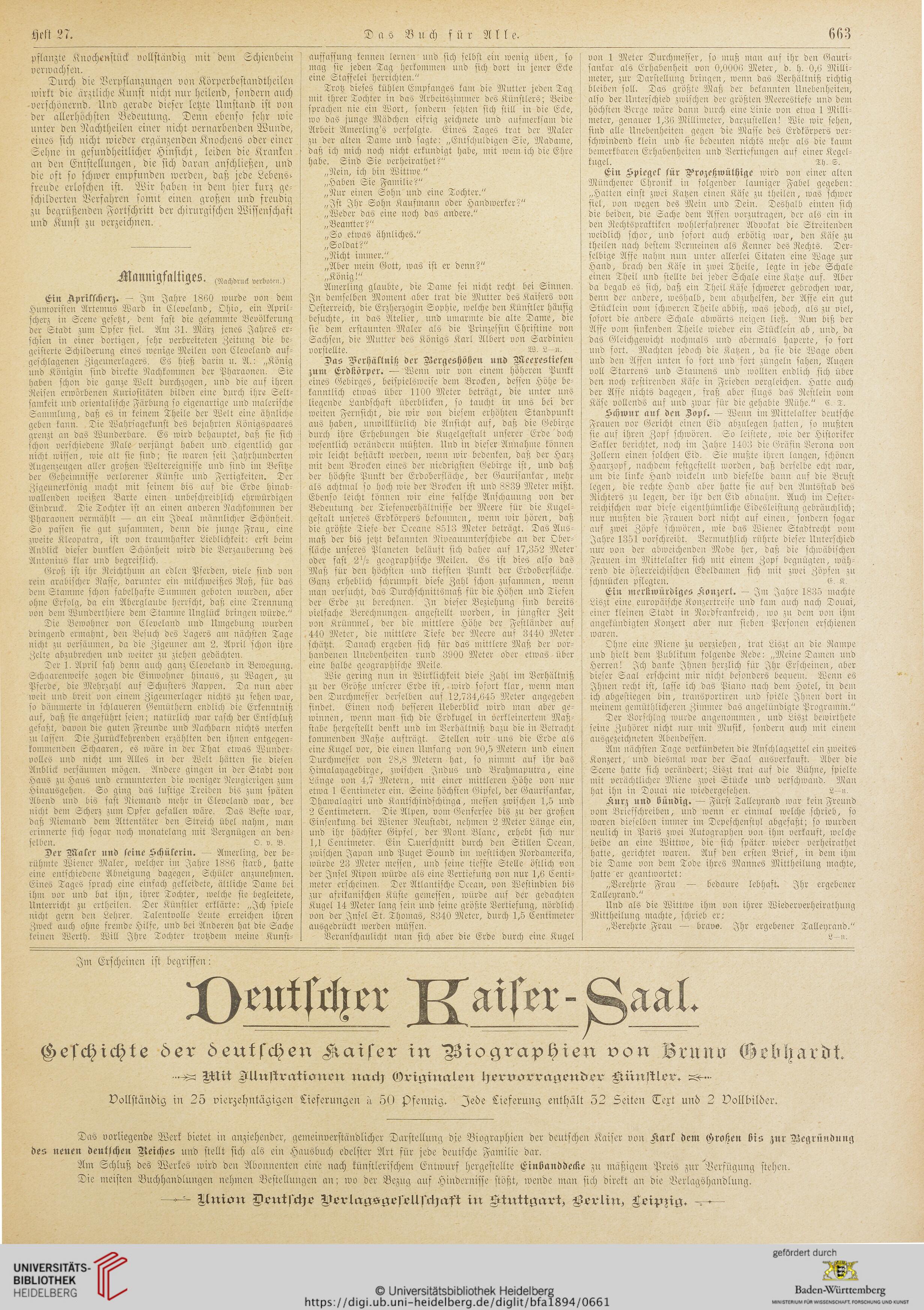tjrtt 27.
Das B ii ch für All e.
668
pflanzte Knochenstück vollständig nut dem Schienbein
verwachsen.
Durch die Verpflanzungen von Körperbestandtheilen
wirkt die ärztliche Kunst nicht nur heilend, sondern auch
verschönernd. Und gerade dieser letzte Umstand ist von
der allerhöchsten Bedeutung. Denn ebenso sehr uns
unter den Nachtheilen einer nicht vernarbenden Wunde,
eines sich nicht wieder ergänzenden Knochens oder einer
Sehne in gesundheitlicher Hinsicht, leiden die Kranken
an den Entstellungen, die sich daran anschließen, und
die oft so schwer empfunden werden, daß jede Lebens-
freude erloschen ist. Wir haben in dem hier kurz ge-
schilderten Verfahren somit einen großen und freudig
zu begrüßenden Fortschritt der chirurgischen Wissenschaft
und Kunst zu verzeichnen.
(Nachdruck Verbote!!.)
Gill Aprilscherz. — Im Jahre 1860 wurde von dem
Humoristen Artemus Ward in Cleveland, Ohio, ein April-
scherz in Scene gesetzt, dem fast die gejammte Bevölkerung
der Stadt zum Opfer fiel. Ain 31. März jenes Jahres er-
schien in einer dortigen, sehr verbreiteten Zeitung die be-
geisterte Schilderung eines wenige Meilen von Clevelnnd auf-
geschlagenen Zigeunerlagers. Es hieß darin u. A.: „König
und Königin find direkte Nachkommen der Pharaonen. Sie
haben schon die ganze Welt durchzogen, und die auf ihren
Reisen erworbenen Kuriositäten bilden eine durch ihre Selt-
samkeit und orientalische Färbung so eigenartige und malerische
Sammlung, daß es in keinem Theile der Welt eine ähnliche
geben kann. Die Wahrsngekunst des bejahrten Königspaares
grenzt an das Wunderbare. Es wird behauptet, daß sie sich
schon verschiedene Male verjüngt haben und eigentlich gar
nicht wissen, wie alt sie sind; sie waren seit Jahrhunderten
Augenzeugen aller großen Weltereigniffe und sind im Besitze
der Geheimnisse verlorener Künste und Fertigkeiten. Der
Zigeunerkönig macht mit seinem bis auf die Erde hinab-
wallenden weißen Barte einen unbeschreiblich ehrwürdigen
Eindruck. Die Tochter ist an einen anderen Nachkommen der
Pharaonen vermählt — an ein Ideal männlicher Schönheit.
So passen sie gut zusammen, denn die junge Frau, eine
zweite Kleopatra, ist von traumhafter Lieblichkeit: erst beim
Anblick dieser dunklen Schönheit wird die Verzauberung des
Antonius klar und begreiflich.
Groß ist ihr Reichthum an edlen Pferden, viele find von
rein arabischer Rasse, darunter ein milchweißes Roß, für das
dem Stamme schon fabelhafte Summen geboten wurden, aber
ohne Erfolg, da ein Aberglaube herrscht, daß eine Trennung
von dem Wunderthiere dem Stamme Unglück bringen würde."
Die Bewohner von Cleveland und Umgebung wurden
dringend ermahnt, den Besuch des Lagers am nächsten Tage
nicht zu versäumen, da die Zigeuner am 2. April schon ihre
Zelte abzubrechen und weiter zu ziehen gedächten.
Der 1. April sah denn auch ganz Cleveland in Bewegung.
Schaarenweise zogen die Einwohner hinaus, zu Wagen, zu
Pferde, die Mehrzahl aus Schusters Rappen. Da nun aber
weit und breit von einein Zigeunerlager nichts zu sehen war,
so dämmerte in schlaueren Gemüthern endlich die Erkenntniß
aus, daß sie angeführt seien; natürlich war rasch der Entschluß
gefaßt, davon die guten Freunde und Nachbarn nichts merken
zu lassen Die Zurückkehrenden erzählten den ihnen entgegen-
kommenden Schaaren, es wäre in der That etwas Wunder-
volles und nicht um Alles in der Welt hätten sie diesen
Anblick versäumen mögen. Andere gingen in der Stadt von
Haus zu Haus und ermunterten die weniger Neugierigen zum
Hinausgehen. So ging das lustige Treiben bis zum späten
Abend und bis fast Niemand mehr in Cleveland war, der
nicht dem Scherz zum Opfer gefallen wäre. Das Beste war,
daß Niemand dem Attentäter den Streich übel nahm, man
erinnerte sich sogar noch monatelang mit Vergnügen an den-
selben. O. v. B.
Der Waler und seine Schülerin. — Amerling, der be-
rühmte Wiener Maler, welcher in: Jahre 1886 starb, hatte
eine entschiedene Abneigung dagegen, Schüler anzunehmen.
Eines Tages sprach eine einfach gekleidete, ältliche Dame bei
ihm vor und bat ihn, ihrer Tochter, welche sie begleitete,
Unterricht zu ertheilen. Der Künstler erklärte: „Ich spiele
nicht gern den Lehrer. Talentvolle Leute erreichen ihren
Zweck auch ohne fremde Hilfe, und bei Anderen hat die Sache
keinen Werth. Will Ihre Tochter trotzdem meine Kunst-
! ausfasfung kennen lernen und sich selbst ein wenig üben, so
mag sie jeden Tag Herkommen und sich dort in jener Ecke
eine Staffelei Herrichten."
Trotz dieses kühlen Empfanges kam die Mutter jeden Tag
mit ihrer Tochter in das Arbeitszimmer des Künstlers; Beide
sprachen nie ein Wort, sondern setzten sich still in die Ecke,
wo das junge Mädchen eifrig zeichnete und aufmerksam die
Arbeit Amerling's verfolgte. Eines Tages trat der Maler
zu der alten Dame und sagte: „Entschuldigen Sie, Madame,
daß ich mich noch nicht erkundigt habe, mit wem ich die Ehre
habe. Sind Sie verheirathet?"
„Nein, ich bin Wittwe."
„Haben Sie Familie?"
„Nur einen Sohn und eine Tochter."
„Ist Ihr Sohn Kaufmann oder Handwerker?"
„Weder das eine noch das andere."
„Beamter?"
„So etwas ähnliches."
„Soldat?"
„Nicht immer."
„Aber mein Gott, was ist er denn?"
„König!"
Amerling glaubte, die Dame sei nicht recht bei Sinnen.
In demselben Moment aber trat die Mutter des Kaisers von
Oesterreich, die Erzherzogin Sophie, welche den Künstler häufig
besuchte, in das Atelier, und umarmte die alte Dame, die
sie dem erstaunten Maler als die Prinzessin Christine von
Sachsen, die Mutter des Königs Karl Albert von Sardinien
vorstellte. W. L-n.
Das Werhäktnis; der Wergeshöhen und Wecrestiefen
zum Grdkörper. — Wenn wir von einem höheren Punkt
eines Gebirges, beispielsweise dem Brocken, dessen Höhe be-
kanntlich etwas über 1100 Meter beträgt, die unter uns
liegende Landschaft überblicken, so taucht in uns bei der
weiten Fernsicht, die wir von diesem erhöhten Standpunkt
aus haben, unwillkürlich die Ansicht auf, daß die Gebirge
! durch ihre Erhebungen die Kugelgestalt unserer Erde doch
! wesentlich verändern müßten. Und in dieser Annahme können
wir leicht bestärkt werden, wenn wir bedenken, daß der Harz
mit dem Brocken eines der niedrigsten Gebirge ist, und daß
der höchste Punkt der Erdoberfläche, der Gaurisankar, mehr
als achtmal so hoch wie der Brocken ist und 8839 Meter mißt.
Ebenso leicht können wir eine falsche Anschauung von der
Bedeutung der Tiefenverhältnisfe der Meere für die Kugel-
gestalt unseres Erdkörpers bekommen, wenn wir Horen, daß
die größte Tiefe der Oceane 8513 Meter beträgt. Das Aus-
maß der bis jetzt bekannten Niveauunterschiede an der Ober-
fläche unseres Planeten beläuft sich daher auf 17,352 Meter
oder fast Nft geographische Meilen. Es ist dies also das
Maß für den höchsten und tiefsten Punkt der Erdoberfläche.
Ganz erheblich schrumpft diese Zahl schon zusammen, wenn
man versucht, das Durchschnittsmaß für die Höhen und Tiefen
der Erde zu berechnen. In dieser Beziehung sind bereits
vielfache Berechnungen angestellt worden, in jüngster Zeit
van Krümmel, der die mittlere Höhe der Festländer auf
440 Meter, die mittlere Tiefe der Meere auf 3440 Meter
schätzt. Danach ergeben sich für das mittlere Maß der vor-
handenen Unebenheiten rund 3900 Meter oder etwas über
eine halbe geographische Meile.
Wie gering nun in Wirklichkeit diese Zahl im Verhältnis;
zu der Größe unserer Erde ist, wird sofort klar, wenn man
den Durchmesser derselben auf 12,734,645 Meter angegeben
findet. Einen noch besseren Ueberblick wird inan aber ge-
winnen, wenn man sich die Erdkugel in verkleinertem Maß-
stabe hergestellt denkt und im Verhältnis; dazu die in Betracht
kommenden Maße aufträgt. Stellen wir uns die Erde als
eine Kugel vor, die einen Umfang von 90,5 Metern und einen
Durchmesser von 28,8 Metern hat, so nimmt aus ihr das
Himalapagebirge, zwischen Indus und Brahmaputra, eine
Länge von 4,7 Metern, mit einer mittleren Höhe von nur
etwa 1 Centimeter ein. Seine höchsten Gipfel, der Gaurisankar,
Dhawalagiri und Kantschindschinga, messen zwischen 1,5 und
2 Centimeter::. Die Alpen, vom Genfersee bis zu der großen
Einsenkung bei Wiener Neustadt, nehmen 2 Meter Länge ein,
und ihr höchster Gipfel, der Mont. Blanc, erhebt sich nur
1,1 Centimeter. Ein Querschnitt durch den Stillen Ocean,
zwischen Japan und Puget Sound im westlichen Nordamerika,
würde 23 Meter messen, und seine tiefste Stelle östlich von
der Insel Nipon würde als eine Vertiefung von nur 1,6 Centi-
meter erscheinen. Der Atlantische Ocean, von Westindien bis
zur afrikanischen Küste gemessen, würde auf der gedachten
Kugel 14 Meter lang sein und seine größte Vertiefung, nördlich
von der Insel St. Thomas, 8340 Meter, durch 1,5 Centimeter
ausgedrückt werden müssen.
Veranschaulicht man sich aber die Erde durch eine Kugel
von 1 Meter Durchmesser, so muß man auf ihr den Gauri-
sankar als Erhabenheit von 0,0006 Meter, d. h. 0,6 Milli-
ureter, zur Darstellung bringen, wenn das Verhältnis; richtig
bleiben soll. Das größte Maß der bekannten Unebenheiten,
also der Unterschied zwischen der größten Meerestiefe und dem
höchsten Berge wäre dann durch eine Linie von etwa 1 Milli-
meter, genauer 1,36 Millimeter, darzustellen! Wie wir sehen,
sind alle Unebenheiten gegen die Masse des Erdkörpers ver-
schwindend klein und sie bedeuten nichts mehr als die kaum
bemerkbaren Erhabenheiten und Vertiefungen auf einer Kegel-
kugel. Th. S.
Gin Spiegel für Iftozeßwüthige wird von einer alten
Münchener Chronik in folgender launiger Fabel gegeben:
„Hatten einst zwei Katzen einen Käse zu theilen, was schwer
fiel, von wegen des Mein und Dein. Deshalb einten sich
die beiden, die Sache dem Affen vorzutragen, der als ein in
den Rechtspraktiken wohlerfahrener Advokat die Streitenden
weidlich schor, und sofort auch erbötig war, den Käse zu
theilen nach bestem Vermeinen als Kenner des Rechts. Der-
selbige Affe nahm nun unter allerlei Citaten eine Wage zur
Hand, brach den Käse in zwei Theile, legte in jede Schale
einen Theil und stellte bei jeder Schale eine Katze auf. Aber
da begab es sich, daß ein Theil Käse schwerer gebrochen war,
denn der andere, weshalb, dem abzuhelfen, der Affe ein gut
Stücklein von: schweren Theile abbiß, was jedoch, als zu viel,
sofort die andere Schale abwärts neigen ließ. Nun biß der
Affe vom finkenden Theile wieder ein Stücklein ab, und, da
das Gleichgewicht nochmals und abermals haperte, so fort
und fort. Machten jedoch die Katzen, da sie die Wage oben
und den Affen unten so fort und fort züngeln sahen, Augen
voll Starrens und Staunens und wollten endlich sich über
den noch restirenden Käse in Frieden vergleichen. Hatte auch
der Affe nichts dagegen, fraß aber flugs das Ncstlein vom
Käse vollends auf und zwar für die gehabte Mühe." C. T.
Schwur auf den Zopf. — Wenn im Mittelalter deutsche
Frauen vor Gericht einen Eid abzulegen hatten, so mußten
sie auf ihren Zopf schwören. So leistete, wie der Historiker
Sakler berichtet, noch im Jahre 1403 die Gräfin Verona von
Zollern einen solchen Eid. Sie mußte ihren langen, schönen
Haarzopf, nachdem festgestellt worden, daß derselbe echt war,
um die linke Hand wickeln und dieselbe dann aus die Brust
legen, die rechte Hand aber hatte sie auf den Amtsstab des
Richters zu legen, der ihr den Eid abnahm. Auch im Oester-
reichischen war diese eigenthümliche Eidesleistung gebräuchlich;
nur mußten die Frauen dort nicht auf einen, sondern sogar
auf zwei Zöpfe schwören, wie das Wiener Stadtrecht von:
Jahre 1351 vorschreibt. Vermuthlich rührte dieser Unterschied
nur von der abweichenden Mode her, daß die schwäbischen
Frauen im Mittelalter sich mit einem Zopf begnügten, wäh-
rend die österreichischen Edeldamen sich mit zwei Zöpfen zu
schmücken pflegten. E. K.
Gin merkwürdiges Konzert. — Jin Jahre 1835 machte
Liszt eine europäische Konzertreise und kam auch nach Douai,
einer kleinen Stadt in Nordfrankreich, wo zu dem von ihm
angekündigten Konzert aber nur sieben Personen erschienen
waren.
Ohne eine Miene zu verziehen, trat Liszt an die Rampe
und hielt dem Publikum folgende Rede: „Meine Damen und
Herren! Ich danke Ihnen herzlich für Ihr Erscheinen, aber
dieser Saal erscheint mir nicht besonders bequem. Wenn es
Ihnen recht ist, lasse ich das Piano nach dem Hotel, in den:
ich abgestiegen bin, transportiren und spiele Ihnen dort in
meinem gemüthlicheren Zimmer das augetündigte Programm."
Der Vorschlag wurde angenommen, und Liszt bewirthete
seine Zuhörer nicht nur mit Musik, sondern auch mit einen:
ausgezeichneten Abendessen.
Am nächsten Tage verkündeten die Anschlagzettel ein zweites
Konzert, und diesmal war der Saal ausverkauft. Aber die
Scene hatte sich verändert; Liszt trat auf die Bühne, spielte
mit verächtlicher Miene zwei Stücke und verschwand. Man
hat ihn in Douai nie wiedergesehen. L—n.
Kurz und bündig. — Fürst Talleprand war kein Freund
vom Briefschreiben, und wenn er einmal welche schrieb, so
waren dieselben immer im Depeschenstyl abgefaßt; so wurden
neulich in Paris zwei Autographen von ihm verkauft, welche
beide an eine Wittwe, die sich später wieder verheirathet
hatte, gerichtet waren. Auf den ersten Brief, in den: ihn:
die Dame von dem Tode ihres Mannes Mittheilung machte,
hatte er geantwortet:
„Verehrte Frau — bedaure lebhaft. Ihr ergebener
Talleprand."
Und als dis Wittwe ihn: von ihrer Wiederverheirathung
Mittheilung machte, schrieb er:
„Verehrte Frau — bravo. Ihr ergebener Talleyrand."
L-n.
Im Erscheinen ist begriffen:
sQ rutsch er Kaiser-^aal.
Geschichte der öeulschen Kaiser in DAiographien non Brnnv Gebhardt.
Mit oUnItvotionen noci) Gvnnrnrlen ljevvovvogendcv UnnMev.
Vollständig in 25 vierzehntägigen Lieferungen ff 50 Pfennig. Jede Lieferung enthält 52 Seiten Text und 2 Vollbilder.
Das vorliegende Werk bietet in anziehender, geineinverständlicher Darstellung die Biographien der deutschen Kaiser von Kart dem Großen bis zur Wegründnng
des neuen deutschen Weiches und stellt sich als ein Hausbuch edelster Art für jede deutsche Familie dar.
Ain Schluß des Werkes wird den Abonnenten eine nach künstlerischem Entwurf hergestellte Einbanddecke zu mäßigem Preis zur Verfügung stehen.
Die meisten Buchhandlungen nehmen Bestellungen an; wo der Bezug auf Hindernisse stößt, wende man sich direkt an die Verlagshandlung.
—Union Dentsche UeotogsgeseUPcl)crft irr Stnttgcrot, Keotin, Zerpzig. —
Das B ii ch für All e.
668
pflanzte Knochenstück vollständig nut dem Schienbein
verwachsen.
Durch die Verpflanzungen von Körperbestandtheilen
wirkt die ärztliche Kunst nicht nur heilend, sondern auch
verschönernd. Und gerade dieser letzte Umstand ist von
der allerhöchsten Bedeutung. Denn ebenso sehr uns
unter den Nachtheilen einer nicht vernarbenden Wunde,
eines sich nicht wieder ergänzenden Knochens oder einer
Sehne in gesundheitlicher Hinsicht, leiden die Kranken
an den Entstellungen, die sich daran anschließen, und
die oft so schwer empfunden werden, daß jede Lebens-
freude erloschen ist. Wir haben in dem hier kurz ge-
schilderten Verfahren somit einen großen und freudig
zu begrüßenden Fortschritt der chirurgischen Wissenschaft
und Kunst zu verzeichnen.
(Nachdruck Verbote!!.)
Gill Aprilscherz. — Im Jahre 1860 wurde von dem
Humoristen Artemus Ward in Cleveland, Ohio, ein April-
scherz in Scene gesetzt, dem fast die gejammte Bevölkerung
der Stadt zum Opfer fiel. Ain 31. März jenes Jahres er-
schien in einer dortigen, sehr verbreiteten Zeitung die be-
geisterte Schilderung eines wenige Meilen von Clevelnnd auf-
geschlagenen Zigeunerlagers. Es hieß darin u. A.: „König
und Königin find direkte Nachkommen der Pharaonen. Sie
haben schon die ganze Welt durchzogen, und die auf ihren
Reisen erworbenen Kuriositäten bilden eine durch ihre Selt-
samkeit und orientalische Färbung so eigenartige und malerische
Sammlung, daß es in keinem Theile der Welt eine ähnliche
geben kann. Die Wahrsngekunst des bejahrten Königspaares
grenzt an das Wunderbare. Es wird behauptet, daß sie sich
schon verschiedene Male verjüngt haben und eigentlich gar
nicht wissen, wie alt sie sind; sie waren seit Jahrhunderten
Augenzeugen aller großen Weltereigniffe und sind im Besitze
der Geheimnisse verlorener Künste und Fertigkeiten. Der
Zigeunerkönig macht mit seinem bis auf die Erde hinab-
wallenden weißen Barte einen unbeschreiblich ehrwürdigen
Eindruck. Die Tochter ist an einen anderen Nachkommen der
Pharaonen vermählt — an ein Ideal männlicher Schönheit.
So passen sie gut zusammen, denn die junge Frau, eine
zweite Kleopatra, ist von traumhafter Lieblichkeit: erst beim
Anblick dieser dunklen Schönheit wird die Verzauberung des
Antonius klar und begreiflich.
Groß ist ihr Reichthum an edlen Pferden, viele find von
rein arabischer Rasse, darunter ein milchweißes Roß, für das
dem Stamme schon fabelhafte Summen geboten wurden, aber
ohne Erfolg, da ein Aberglaube herrscht, daß eine Trennung
von dem Wunderthiere dem Stamme Unglück bringen würde."
Die Bewohner von Cleveland und Umgebung wurden
dringend ermahnt, den Besuch des Lagers am nächsten Tage
nicht zu versäumen, da die Zigeuner am 2. April schon ihre
Zelte abzubrechen und weiter zu ziehen gedächten.
Der 1. April sah denn auch ganz Cleveland in Bewegung.
Schaarenweise zogen die Einwohner hinaus, zu Wagen, zu
Pferde, die Mehrzahl aus Schusters Rappen. Da nun aber
weit und breit von einein Zigeunerlager nichts zu sehen war,
so dämmerte in schlaueren Gemüthern endlich die Erkenntniß
aus, daß sie angeführt seien; natürlich war rasch der Entschluß
gefaßt, davon die guten Freunde und Nachbarn nichts merken
zu lassen Die Zurückkehrenden erzählten den ihnen entgegen-
kommenden Schaaren, es wäre in der That etwas Wunder-
volles und nicht um Alles in der Welt hätten sie diesen
Anblick versäumen mögen. Andere gingen in der Stadt von
Haus zu Haus und ermunterten die weniger Neugierigen zum
Hinausgehen. So ging das lustige Treiben bis zum späten
Abend und bis fast Niemand mehr in Cleveland war, der
nicht dem Scherz zum Opfer gefallen wäre. Das Beste war,
daß Niemand dem Attentäter den Streich übel nahm, man
erinnerte sich sogar noch monatelang mit Vergnügen an den-
selben. O. v. B.
Der Waler und seine Schülerin. — Amerling, der be-
rühmte Wiener Maler, welcher in: Jahre 1886 starb, hatte
eine entschiedene Abneigung dagegen, Schüler anzunehmen.
Eines Tages sprach eine einfach gekleidete, ältliche Dame bei
ihm vor und bat ihn, ihrer Tochter, welche sie begleitete,
Unterricht zu ertheilen. Der Künstler erklärte: „Ich spiele
nicht gern den Lehrer. Talentvolle Leute erreichen ihren
Zweck auch ohne fremde Hilfe, und bei Anderen hat die Sache
keinen Werth. Will Ihre Tochter trotzdem meine Kunst-
! ausfasfung kennen lernen und sich selbst ein wenig üben, so
mag sie jeden Tag Herkommen und sich dort in jener Ecke
eine Staffelei Herrichten."
Trotz dieses kühlen Empfanges kam die Mutter jeden Tag
mit ihrer Tochter in das Arbeitszimmer des Künstlers; Beide
sprachen nie ein Wort, sondern setzten sich still in die Ecke,
wo das junge Mädchen eifrig zeichnete und aufmerksam die
Arbeit Amerling's verfolgte. Eines Tages trat der Maler
zu der alten Dame und sagte: „Entschuldigen Sie, Madame,
daß ich mich noch nicht erkundigt habe, mit wem ich die Ehre
habe. Sind Sie verheirathet?"
„Nein, ich bin Wittwe."
„Haben Sie Familie?"
„Nur einen Sohn und eine Tochter."
„Ist Ihr Sohn Kaufmann oder Handwerker?"
„Weder das eine noch das andere."
„Beamter?"
„So etwas ähnliches."
„Soldat?"
„Nicht immer."
„Aber mein Gott, was ist er denn?"
„König!"
Amerling glaubte, die Dame sei nicht recht bei Sinnen.
In demselben Moment aber trat die Mutter des Kaisers von
Oesterreich, die Erzherzogin Sophie, welche den Künstler häufig
besuchte, in das Atelier, und umarmte die alte Dame, die
sie dem erstaunten Maler als die Prinzessin Christine von
Sachsen, die Mutter des Königs Karl Albert von Sardinien
vorstellte. W. L-n.
Das Werhäktnis; der Wergeshöhen und Wecrestiefen
zum Grdkörper. — Wenn wir von einem höheren Punkt
eines Gebirges, beispielsweise dem Brocken, dessen Höhe be-
kanntlich etwas über 1100 Meter beträgt, die unter uns
liegende Landschaft überblicken, so taucht in uns bei der
weiten Fernsicht, die wir von diesem erhöhten Standpunkt
aus haben, unwillkürlich die Ansicht auf, daß die Gebirge
! durch ihre Erhebungen die Kugelgestalt unserer Erde doch
! wesentlich verändern müßten. Und in dieser Annahme können
wir leicht bestärkt werden, wenn wir bedenken, daß der Harz
mit dem Brocken eines der niedrigsten Gebirge ist, und daß
der höchste Punkt der Erdoberfläche, der Gaurisankar, mehr
als achtmal so hoch wie der Brocken ist und 8839 Meter mißt.
Ebenso leicht können wir eine falsche Anschauung von der
Bedeutung der Tiefenverhältnisfe der Meere für die Kugel-
gestalt unseres Erdkörpers bekommen, wenn wir Horen, daß
die größte Tiefe der Oceane 8513 Meter beträgt. Das Aus-
maß der bis jetzt bekannten Niveauunterschiede an der Ober-
fläche unseres Planeten beläuft sich daher auf 17,352 Meter
oder fast Nft geographische Meilen. Es ist dies also das
Maß für den höchsten und tiefsten Punkt der Erdoberfläche.
Ganz erheblich schrumpft diese Zahl schon zusammen, wenn
man versucht, das Durchschnittsmaß für die Höhen und Tiefen
der Erde zu berechnen. In dieser Beziehung sind bereits
vielfache Berechnungen angestellt worden, in jüngster Zeit
van Krümmel, der die mittlere Höhe der Festländer auf
440 Meter, die mittlere Tiefe der Meere auf 3440 Meter
schätzt. Danach ergeben sich für das mittlere Maß der vor-
handenen Unebenheiten rund 3900 Meter oder etwas über
eine halbe geographische Meile.
Wie gering nun in Wirklichkeit diese Zahl im Verhältnis;
zu der Größe unserer Erde ist, wird sofort klar, wenn man
den Durchmesser derselben auf 12,734,645 Meter angegeben
findet. Einen noch besseren Ueberblick wird inan aber ge-
winnen, wenn man sich die Erdkugel in verkleinertem Maß-
stabe hergestellt denkt und im Verhältnis; dazu die in Betracht
kommenden Maße aufträgt. Stellen wir uns die Erde als
eine Kugel vor, die einen Umfang von 90,5 Metern und einen
Durchmesser von 28,8 Metern hat, so nimmt aus ihr das
Himalapagebirge, zwischen Indus und Brahmaputra, eine
Länge von 4,7 Metern, mit einer mittleren Höhe von nur
etwa 1 Centimeter ein. Seine höchsten Gipfel, der Gaurisankar,
Dhawalagiri und Kantschindschinga, messen zwischen 1,5 und
2 Centimeter::. Die Alpen, vom Genfersee bis zu der großen
Einsenkung bei Wiener Neustadt, nehmen 2 Meter Länge ein,
und ihr höchster Gipfel, der Mont. Blanc, erhebt sich nur
1,1 Centimeter. Ein Querschnitt durch den Stillen Ocean,
zwischen Japan und Puget Sound im westlichen Nordamerika,
würde 23 Meter messen, und seine tiefste Stelle östlich von
der Insel Nipon würde als eine Vertiefung von nur 1,6 Centi-
meter erscheinen. Der Atlantische Ocean, von Westindien bis
zur afrikanischen Küste gemessen, würde auf der gedachten
Kugel 14 Meter lang sein und seine größte Vertiefung, nördlich
von der Insel St. Thomas, 8340 Meter, durch 1,5 Centimeter
ausgedrückt werden müssen.
Veranschaulicht man sich aber die Erde durch eine Kugel
von 1 Meter Durchmesser, so muß man auf ihr den Gauri-
sankar als Erhabenheit von 0,0006 Meter, d. h. 0,6 Milli-
ureter, zur Darstellung bringen, wenn das Verhältnis; richtig
bleiben soll. Das größte Maß der bekannten Unebenheiten,
also der Unterschied zwischen der größten Meerestiefe und dem
höchsten Berge wäre dann durch eine Linie von etwa 1 Milli-
meter, genauer 1,36 Millimeter, darzustellen! Wie wir sehen,
sind alle Unebenheiten gegen die Masse des Erdkörpers ver-
schwindend klein und sie bedeuten nichts mehr als die kaum
bemerkbaren Erhabenheiten und Vertiefungen auf einer Kegel-
kugel. Th. S.
Gin Spiegel für Iftozeßwüthige wird von einer alten
Münchener Chronik in folgender launiger Fabel gegeben:
„Hatten einst zwei Katzen einen Käse zu theilen, was schwer
fiel, von wegen des Mein und Dein. Deshalb einten sich
die beiden, die Sache dem Affen vorzutragen, der als ein in
den Rechtspraktiken wohlerfahrener Advokat die Streitenden
weidlich schor, und sofort auch erbötig war, den Käse zu
theilen nach bestem Vermeinen als Kenner des Rechts. Der-
selbige Affe nahm nun unter allerlei Citaten eine Wage zur
Hand, brach den Käse in zwei Theile, legte in jede Schale
einen Theil und stellte bei jeder Schale eine Katze auf. Aber
da begab es sich, daß ein Theil Käse schwerer gebrochen war,
denn der andere, weshalb, dem abzuhelfen, der Affe ein gut
Stücklein von: schweren Theile abbiß, was jedoch, als zu viel,
sofort die andere Schale abwärts neigen ließ. Nun biß der
Affe vom finkenden Theile wieder ein Stücklein ab, und, da
das Gleichgewicht nochmals und abermals haperte, so fort
und fort. Machten jedoch die Katzen, da sie die Wage oben
und den Affen unten so fort und fort züngeln sahen, Augen
voll Starrens und Staunens und wollten endlich sich über
den noch restirenden Käse in Frieden vergleichen. Hatte auch
der Affe nichts dagegen, fraß aber flugs das Ncstlein vom
Käse vollends auf und zwar für die gehabte Mühe." C. T.
Schwur auf den Zopf. — Wenn im Mittelalter deutsche
Frauen vor Gericht einen Eid abzulegen hatten, so mußten
sie auf ihren Zopf schwören. So leistete, wie der Historiker
Sakler berichtet, noch im Jahre 1403 die Gräfin Verona von
Zollern einen solchen Eid. Sie mußte ihren langen, schönen
Haarzopf, nachdem festgestellt worden, daß derselbe echt war,
um die linke Hand wickeln und dieselbe dann aus die Brust
legen, die rechte Hand aber hatte sie auf den Amtsstab des
Richters zu legen, der ihr den Eid abnahm. Auch im Oester-
reichischen war diese eigenthümliche Eidesleistung gebräuchlich;
nur mußten die Frauen dort nicht auf einen, sondern sogar
auf zwei Zöpfe schwören, wie das Wiener Stadtrecht von:
Jahre 1351 vorschreibt. Vermuthlich rührte dieser Unterschied
nur von der abweichenden Mode her, daß die schwäbischen
Frauen im Mittelalter sich mit einem Zopf begnügten, wäh-
rend die österreichischen Edeldamen sich mit zwei Zöpfen zu
schmücken pflegten. E. K.
Gin merkwürdiges Konzert. — Jin Jahre 1835 machte
Liszt eine europäische Konzertreise und kam auch nach Douai,
einer kleinen Stadt in Nordfrankreich, wo zu dem von ihm
angekündigten Konzert aber nur sieben Personen erschienen
waren.
Ohne eine Miene zu verziehen, trat Liszt an die Rampe
und hielt dem Publikum folgende Rede: „Meine Damen und
Herren! Ich danke Ihnen herzlich für Ihr Erscheinen, aber
dieser Saal erscheint mir nicht besonders bequem. Wenn es
Ihnen recht ist, lasse ich das Piano nach dem Hotel, in den:
ich abgestiegen bin, transportiren und spiele Ihnen dort in
meinem gemüthlicheren Zimmer das augetündigte Programm."
Der Vorschlag wurde angenommen, und Liszt bewirthete
seine Zuhörer nicht nur mit Musik, sondern auch mit einen:
ausgezeichneten Abendessen.
Am nächsten Tage verkündeten die Anschlagzettel ein zweites
Konzert, und diesmal war der Saal ausverkauft. Aber die
Scene hatte sich verändert; Liszt trat auf die Bühne, spielte
mit verächtlicher Miene zwei Stücke und verschwand. Man
hat ihn in Douai nie wiedergesehen. L—n.
Kurz und bündig. — Fürst Talleprand war kein Freund
vom Briefschreiben, und wenn er einmal welche schrieb, so
waren dieselben immer im Depeschenstyl abgefaßt; so wurden
neulich in Paris zwei Autographen von ihm verkauft, welche
beide an eine Wittwe, die sich später wieder verheirathet
hatte, gerichtet waren. Auf den ersten Brief, in den: ihn:
die Dame von dem Tode ihres Mannes Mittheilung machte,
hatte er geantwortet:
„Verehrte Frau — bedaure lebhaft. Ihr ergebener
Talleprand."
Und als dis Wittwe ihn: von ihrer Wiederverheirathung
Mittheilung machte, schrieb er:
„Verehrte Frau — bravo. Ihr ergebener Talleyrand."
L-n.
Im Erscheinen ist begriffen:
sQ rutsch er Kaiser-^aal.
Geschichte der öeulschen Kaiser in DAiographien non Brnnv Gebhardt.
Mit oUnItvotionen noci) Gvnnrnrlen ljevvovvogendcv UnnMev.
Vollständig in 25 vierzehntägigen Lieferungen ff 50 Pfennig. Jede Lieferung enthält 52 Seiten Text und 2 Vollbilder.
Das vorliegende Werk bietet in anziehender, geineinverständlicher Darstellung die Biographien der deutschen Kaiser von Kart dem Großen bis zur Wegründnng
des neuen deutschen Weiches und stellt sich als ein Hausbuch edelster Art für jede deutsche Familie dar.
Ain Schluß des Werkes wird den Abonnenten eine nach künstlerischem Entwurf hergestellte Einbanddecke zu mäßigem Preis zur Verfügung stehen.
Die meisten Buchhandlungen nehmen Bestellungen an; wo der Bezug auf Hindernisse stößt, wende man sich direkt an die Verlagshandlung.
—Union Dentsche UeotogsgeseUPcl)crft irr Stnttgcrot, Keotin, Zerpzig. —