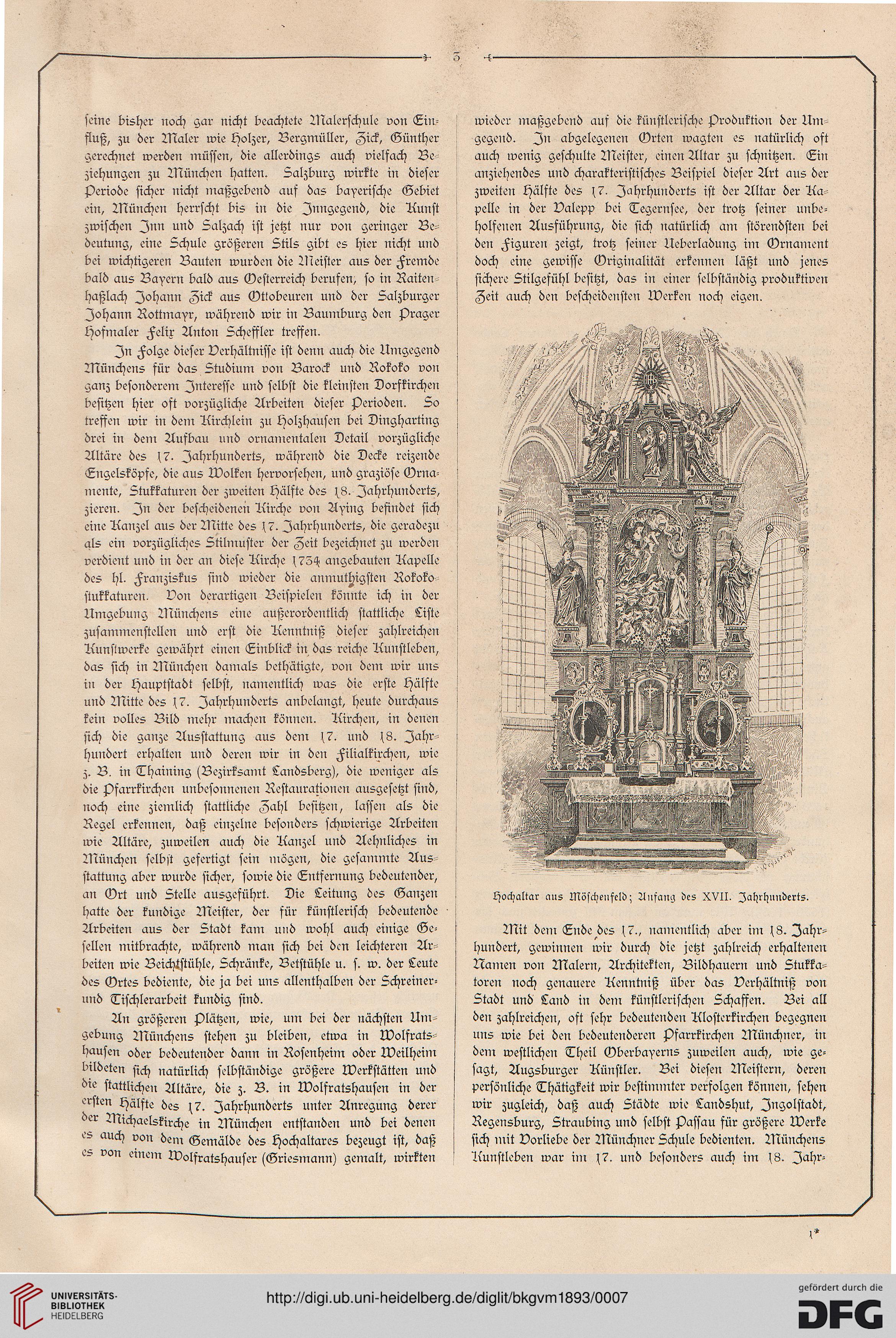seine bisher noch gar nicht beachtete Malerschule von Ein-
fluß, zu der Maler wie bsolzer, Bergmüller, Aick, Günther
gerechnet werden müssen, die allerdings auch vielfach Be-
ziehungen zu München hatten. Salzburg wirkte in dieser
Periode sicher nicht maßgebend auf das bayerische Gebiet
ein, München herrscht bis in die Inngegend, die Runst
zwischen Inn und Salzach ist jetzt nur von geringer Be-
deutung, eine Schule größeren Stils gibt es hier nicht und
bei wichtigeren Bauten wurden die Meister aus der Fremde
bald aus Bayern bald aus Oesterreich berufen, so in Raiten
haßlach Johann Zick aus Ottobeuren und der Salzburger-
Johann Rottnrayr, während wir in Bauinburg den Prager
pofmaler Felix Anton Scheffler treffen.
In Folge dieser Verhältnisse ist beim auch die Amgegend
Münchens für das Studium von Barock und Rokoko von
ganz besonderem Interesse und selbst die kleinsten Dorfkirchen
besitzen hier oft vorzügliche Arbeiten dieser Perioden. So
treffen wir in dem Rirchlein zu polzhausen bei Dingharting
drei in denr Ausbau und ornamentalen Detail vorzügliche
Altäre des \7. Jahrhunderts, während die Decke reizende
Engelsköpfe, die aus Molken hervorsehen, und graziöse Orna-
mente, Stukkaturen der zweiten chälfte des H8. Jahrhunderts,
zieren. In der bescheidenen Rirche von Aying befindet sich
eine Ranzel aus der Mitte des l". Jahrhunderts, die geradezu !
als ein vorzügliches Stilmuster der Zeit bezeichnet zu werden j
verdient und in der an diese Rirche (75H angebauten Rapelle
des hl. Franziskus sind wieder die anmutigsten Rokoko
stukkaturen. Bon derartigen Beispielen könnte ich in der
Umgebung Münchens eine außerordentlich stattliche Liste
zusammcnstellcn und erst die Renntniß dieser zahlreichen
Runslwerke gewährt einen Einblick in das reiche Runstleben,
das sich in München damals bethätigte, von dem wir uns
in der Hauptstadt selbst, namentlich was die erste Hälfte
und Mitte des {7. Jahrhunderts anbelangt, heute durchaus
kein volles Bild mehr machen können. Rirchen, in denen
sich die ganze Ausstattung aus denr \7. und (8. Jahr j
hundert erhalten und deren wir in den Filialkirchen, wie
z. B. in Thaining (Bezirksamt Landsberg), die weniger als
die Pfarrkirchen unbesonnenen Restaurationen ausgesetzt sind,
noch eine ziemlich stattliche Zahl besitzen, lassen als die
Regel erkennen, daß einzelne besonders schwierige Arbeiten !
wie Altäre, zuweilen auch die Ranzel und Aehnliches in
München selbst gefertigt sein mögen, die gesummte Aus
stattung aber wurde sicher, sowie die Entfernung bedeutender,
an Vrt und Stelle ausgeführt. Die Leitung des Ganzen
hatte der kundige Meister, der für künstlerisch bedeutende
Arbeiten aus der Stadt kam und wohl auch einige Ge-
sellen mitbrachte, während man sich bei den leichteren Ar-
beiten wie Beichtstühle, Schränke, Betstühle u. s. w. der Leute
des Ortes bediente, die ja bei uns allenthalben der Schreiner-
und Tischlerarbeit kundig sind.
An größeren Plätzen, wie, um bei der nächsten Um
gcbung Münchens stehen zu bleiben, etwa in Wolfrats-
hausen oder bedeutender dann in Rosenheim oder Weilheim
bildeten sich natürlich selbständige größere Werkstätten und
die stattlichen Altäre, die z. B. in Wolfratshausen in der
ersten Hälfte des \7. Jahrhunderts unter Anregung derer
d>-r Michaelskirche in München entstanden und bei denen
^ au<^ Don dem Gemälde des Hochaltarcs bezeugt ist, daß
es von einem Wolfratshauser (Griesmann) gemalt, wirkten
wieder maßgebend auf die künstlerische Produktion der Am
gegend. In abgelegenen Orten wagten es natürlich oft
auch wenig geschulte Meister, einen Altar zu schnitzen. Ein
anziehendes und charakteristisches Beispiel dieser Art aus der
zweiten Hälfte des \7. Jahrhunderts ist der Altar der Ra
pelle in der Balepp bei Tegernsee, der trotz seiner unbe-
holfenen Ausführung, die sich natürlich am störendsten bei
den Figuren zeigt, trotz seiner Aeberladung im Ornament
doch eine gewisse Originalität erkennen läßt und jenes
sichere Stilgefühl besitzt, das in einer selbständig produktiven
Zeit auch den bescheidensten Werken noch eigen.
Hochaltar aus Möschenfeld; Anfang des XVII. Jahrhunderts.
Mit dem Ende des (7., namentlich aber im H8. Jahr-
hundert, gewinnen wir durch die jetzt zahlreich erhaltenen
Namen von Malern, Architekten, Bildhauern und Stukka-
toren noch genauere Renntniß über das Berhältniß von
Stadt und Land in dem künstlerischen Schaffen. Bei all
den zahlreichen, oft sehr bedeutenden Rlosterkirchen begegnen
uns wie bei den bedeutenderen Pfarrkirchen Münchner, in
dem westlichen Theil Oberbayerns zuweilen auch, wie ge-
sagt, Augsburger Rünstler. Bei diesen Meistern, deren
persönliche Thätigkeit wir bestimmter verfolgen können, sehen
wir zugleich, daß auch Städte wie Landshut, Ingolstadt,
Regensburg, Straubing und selbst passau für größere Werke
sich mit Borliebe der Münchner Schule bedienten. Münchens
Runstleben war im I?. und besonders auch im (8. Jahr-
fluß, zu der Maler wie bsolzer, Bergmüller, Aick, Günther
gerechnet werden müssen, die allerdings auch vielfach Be-
ziehungen zu München hatten. Salzburg wirkte in dieser
Periode sicher nicht maßgebend auf das bayerische Gebiet
ein, München herrscht bis in die Inngegend, die Runst
zwischen Inn und Salzach ist jetzt nur von geringer Be-
deutung, eine Schule größeren Stils gibt es hier nicht und
bei wichtigeren Bauten wurden die Meister aus der Fremde
bald aus Bayern bald aus Oesterreich berufen, so in Raiten
haßlach Johann Zick aus Ottobeuren und der Salzburger-
Johann Rottnrayr, während wir in Bauinburg den Prager
pofmaler Felix Anton Scheffler treffen.
In Folge dieser Verhältnisse ist beim auch die Amgegend
Münchens für das Studium von Barock und Rokoko von
ganz besonderem Interesse und selbst die kleinsten Dorfkirchen
besitzen hier oft vorzügliche Arbeiten dieser Perioden. So
treffen wir in dem Rirchlein zu polzhausen bei Dingharting
drei in denr Ausbau und ornamentalen Detail vorzügliche
Altäre des \7. Jahrhunderts, während die Decke reizende
Engelsköpfe, die aus Molken hervorsehen, und graziöse Orna-
mente, Stukkaturen der zweiten chälfte des H8. Jahrhunderts,
zieren. In der bescheidenen Rirche von Aying befindet sich
eine Ranzel aus der Mitte des l". Jahrhunderts, die geradezu !
als ein vorzügliches Stilmuster der Zeit bezeichnet zu werden j
verdient und in der an diese Rirche (75H angebauten Rapelle
des hl. Franziskus sind wieder die anmutigsten Rokoko
stukkaturen. Bon derartigen Beispielen könnte ich in der
Umgebung Münchens eine außerordentlich stattliche Liste
zusammcnstellcn und erst die Renntniß dieser zahlreichen
Runslwerke gewährt einen Einblick in das reiche Runstleben,
das sich in München damals bethätigte, von dem wir uns
in der Hauptstadt selbst, namentlich was die erste Hälfte
und Mitte des {7. Jahrhunderts anbelangt, heute durchaus
kein volles Bild mehr machen können. Rirchen, in denen
sich die ganze Ausstattung aus denr \7. und (8. Jahr j
hundert erhalten und deren wir in den Filialkirchen, wie
z. B. in Thaining (Bezirksamt Landsberg), die weniger als
die Pfarrkirchen unbesonnenen Restaurationen ausgesetzt sind,
noch eine ziemlich stattliche Zahl besitzen, lassen als die
Regel erkennen, daß einzelne besonders schwierige Arbeiten !
wie Altäre, zuweilen auch die Ranzel und Aehnliches in
München selbst gefertigt sein mögen, die gesummte Aus
stattung aber wurde sicher, sowie die Entfernung bedeutender,
an Vrt und Stelle ausgeführt. Die Leitung des Ganzen
hatte der kundige Meister, der für künstlerisch bedeutende
Arbeiten aus der Stadt kam und wohl auch einige Ge-
sellen mitbrachte, während man sich bei den leichteren Ar-
beiten wie Beichtstühle, Schränke, Betstühle u. s. w. der Leute
des Ortes bediente, die ja bei uns allenthalben der Schreiner-
und Tischlerarbeit kundig sind.
An größeren Plätzen, wie, um bei der nächsten Um
gcbung Münchens stehen zu bleiben, etwa in Wolfrats-
hausen oder bedeutender dann in Rosenheim oder Weilheim
bildeten sich natürlich selbständige größere Werkstätten und
die stattlichen Altäre, die z. B. in Wolfratshausen in der
ersten Hälfte des \7. Jahrhunderts unter Anregung derer
d>-r Michaelskirche in München entstanden und bei denen
^ au<^ Don dem Gemälde des Hochaltarcs bezeugt ist, daß
es von einem Wolfratshauser (Griesmann) gemalt, wirkten
wieder maßgebend auf die künstlerische Produktion der Am
gegend. In abgelegenen Orten wagten es natürlich oft
auch wenig geschulte Meister, einen Altar zu schnitzen. Ein
anziehendes und charakteristisches Beispiel dieser Art aus der
zweiten Hälfte des \7. Jahrhunderts ist der Altar der Ra
pelle in der Balepp bei Tegernsee, der trotz seiner unbe-
holfenen Ausführung, die sich natürlich am störendsten bei
den Figuren zeigt, trotz seiner Aeberladung im Ornament
doch eine gewisse Originalität erkennen läßt und jenes
sichere Stilgefühl besitzt, das in einer selbständig produktiven
Zeit auch den bescheidensten Werken noch eigen.
Hochaltar aus Möschenfeld; Anfang des XVII. Jahrhunderts.
Mit dem Ende des (7., namentlich aber im H8. Jahr-
hundert, gewinnen wir durch die jetzt zahlreich erhaltenen
Namen von Malern, Architekten, Bildhauern und Stukka-
toren noch genauere Renntniß über das Berhältniß von
Stadt und Land in dem künstlerischen Schaffen. Bei all
den zahlreichen, oft sehr bedeutenden Rlosterkirchen begegnen
uns wie bei den bedeutenderen Pfarrkirchen Münchner, in
dem westlichen Theil Oberbayerns zuweilen auch, wie ge-
sagt, Augsburger Rünstler. Bei diesen Meistern, deren
persönliche Thätigkeit wir bestimmter verfolgen können, sehen
wir zugleich, daß auch Städte wie Landshut, Ingolstadt,
Regensburg, Straubing und selbst passau für größere Werke
sich mit Borliebe der Münchner Schule bedienten. Münchens
Runstleben war im I?. und besonders auch im (8. Jahr-