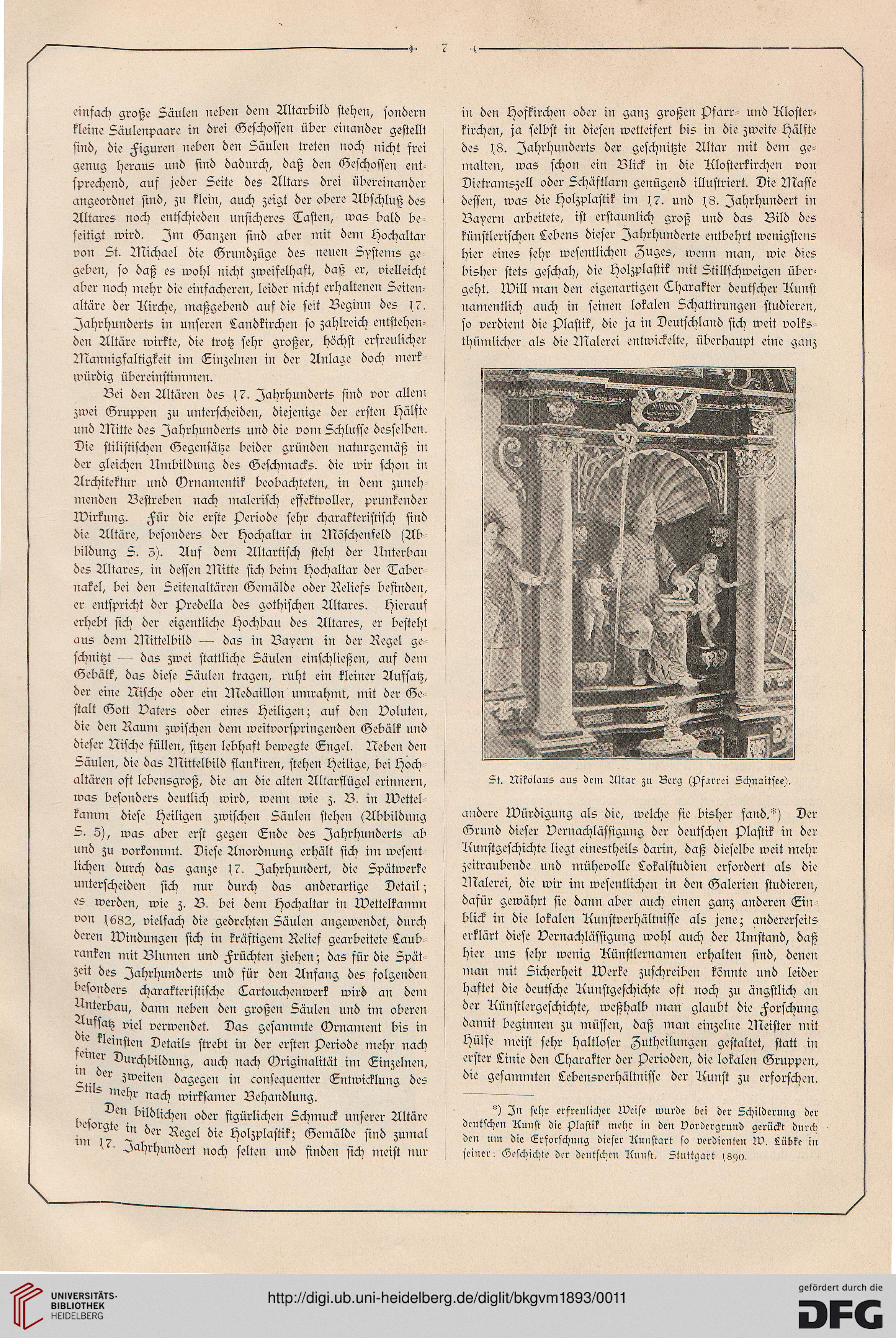einfach große Säulen neben dein Altarbild stehen, sondern
kleine Säulenpaare in drei Geschossen über einander gestellt
sind, die Figuren neben den Säulen treten noch nicht frei
genug heraus und ftnb dadurch, daß den Geschossen ent-
sprechend, auf jeder Seite des Altars drei übereinander
angeordnet sind, zu klein, auch zeigt der obere Abschluß des
Altares noch entschieden unsicheres Tasten, was bald be
seitigt wird. Zm Ganzen sind aber mit dem Hochaltar
von St. Michael die Grundzüge des neuen Systems ge
geben, so daß es wohl nicht zweifelhaft, daß er, vielleicht
aber noch mehr die einfacheren, leider nicht erhaltenen Seiten-
altäre der Kirche, maßgebend auf die seit Beginn des (7.
Jahrhunderts in unseren Landkirchen so zahlreich entstehen-
den Altäre wirkte, die trotz sehr großer, höchst erfreulicher
Mannigfaltigkeit im Einzelnen in der Anlage doch merk
würdig Übereinstiminen.
Bei den Altären des (7. Jahrhunderts sind vor allem
zwei Gruppen zu unterscheiden, diejenige der ersten Hälfte
und Mitte des Jahrhunderts und die voin Schluffe desselben.
Die stilistischen Gegensätze beider gründen naturgemäß in
der gleichen Umbildung des Geschinacks. die wir schon in
Architektur und Ornamentik beobachteten, in dem zuneh
menden Bestreben nach malerisch effektvoller, prunkender
Wirkung. Für die erste Periode sehr charakteristisch sind
die Altäre, besonders der Hochaltar in Möschenfeld (Ab
bildung S. 3). Auf dem Altartisch steht der Unterbau
des Altares, in dessen Mitte sich beim Hochaltar der Taber-
nakel, bei den Seitenaltären Gemälde oder Reliefs befinden,
er entspricht der Predella des gothischcn Altares. Hierauf
erhebt sich der eigentliche Hochbau des Altares, er besteht
aus dein Mittelbild -— das in Bayer» in der Regel ge-
schnitzt — das zwei stattliche Säulen einschließen, auf dem
Gebälk, das diese Säulen tragen, ruht ein kleiner Aufsatz,
der eine Nische oder ein Medaillon umrahmt, mit der Ge
stalt Gott Vaters oder eines Heiligen; auf den Voluten,
die den Raum zwischen dem weitvorspringenden Gebälk und
dieser Nische füllen, sitzen lebhaft bewegte Engel. Neben den
Säulen, die das Mittelbild flankiren, stehen Heilige, bei Hoch
altären oft lebensgroß, die an die alten Altarflügel erinnern,
was besonders deutlich wird, wenn wie z. B. in Mettel
kämm diese Heiligen zwischen Säulen stehen (Abbildung
B. 5), was aber erst gegen Ende des Jahrhunderts ab
und zu vorkommt. Diese Anordnung erhält sich im wesent
lichen durch das ganze (7. Jahrhundert, die Spätwerke
unterscheiden sich nur durch das anderartige Detail;
es werden, wie z. B. bei dem Hochaltar in Mettelkamm
von (682, vielfach die gedrehten Säulen angewendet, durch
deren Windungen sich in kräftigem Relief gearbeitete Laub
ranken mit Blumen und Früchten ziehen; das für die Spät
Zeit des Jahrhunderts und für den Anfang des folgenden
besonders charakteristische Tartouchenwcrk wird an dem
Unterbau, dann neben den großen Säulen und inr oberen
Aufsatz viel verwendet. Das gesammte Ornament bis in
kleinsten Details strebt in der ersten Periode mehr nach
!uncr Durchbildung, auch nach Originalität im Einzelnen,
Zweiten dagegen in consequenter Entwicklung des
^ 1' '"ehr nach wirksamer Behandlung.
. , ,^Cn üblichen oder figürlichen Schmuck unserer Altäre
/ °l1" k°1' Regel die Holzplastik; Gemälde sind zumal
Bahrhundert noch selten und finden sich meist nur
i» den Hoskirchen oder in ganz großen pfarr und 'Kloster-
kirchen, ja selbst in diesen wetteifert bis in die zweite Hälfte
des (8. Jahrhunderts der geschnitzte Altar mit dem ge-
malten, was schon ein Blick in die Klosterkirchen von
Dietramszell oder Schäftlarn genügend illustriert. Die Blasse
dessen, was die Holzplastik im (7. und (8. Jahrhundert in
Bayern arbeitete, ist erstaunlich groß und das Bild des
künstlerischen Lebens dieser Jahrhunderte entbehrt wenigstens
hier eines sehr wesentlichen Zuges, wenn inan, wie dies
bisher stets geschah, die Holzplastik mit Stillschweigen über-
geht. Will man den eigenartigen Lharakter deutscher Kunst
namentlich auch in seinen lokalen Schattirungen studieren,
so verdient die Plastik, die ja in Deutschland sich weit volks
thümlicher als die Malerei entwickelte, überhaupt eine ganz
St. Nikolaus aus dein Altar zu Berg (Pfarrei Schnaitsee).
andere Würdigung als die, welche sie bisher fand.*) Der
Grund dieser Vernachlässigung der deutschen Plastik in der
Kunstgeschichte liegt einestheils darin, daß dieselbe weit mehr
zeitraubende uitd mühevolle Lokalstudien erfordert als die
Malerei, die wir in: wesentlichen in den Galerien studieren,
dafür gewährt sie dann aber auch einen ganz anderen Ein
blick in die lokalen Kunstverhältnisse als jene; andererseits
erklärt diese Vernachlässigung wohl auch der Umstand, daß
hier uns sehr wenig Künstlernamen erhalten sind, denen
man mit Sicherheit Werke zuschreiben könnte und leider
haftet die deutsche Kunstgeschichte oft noch zu ängstlich an
der Künstlergeschichte, weßhalb man glaubt die Forschung
damit beginnen zu inüssen, daß man einzelne Meister mit
Hülfe meist sehr haltloser Zutheilungen gestaltet, statt in
erster Linie den Lharakter der Perioden, die lokalen Gruppen,
die gcsammten Lebensverhältnisse der Kunst zu erforschen.
*) In sehr erfreulicher Meise wurde bei der Schilderung der
deutschen Kuitft die Plastik mehr in den Vordergrund gerückt durch
den um die Erforschung dieser Kunstart so verdienten !v. Lübke in
seiner: Geschichte der deutschen Kunst. Stuttgart ;sqo.
kleine Säulenpaare in drei Geschossen über einander gestellt
sind, die Figuren neben den Säulen treten noch nicht frei
genug heraus und ftnb dadurch, daß den Geschossen ent-
sprechend, auf jeder Seite des Altars drei übereinander
angeordnet sind, zu klein, auch zeigt der obere Abschluß des
Altares noch entschieden unsicheres Tasten, was bald be
seitigt wird. Zm Ganzen sind aber mit dem Hochaltar
von St. Michael die Grundzüge des neuen Systems ge
geben, so daß es wohl nicht zweifelhaft, daß er, vielleicht
aber noch mehr die einfacheren, leider nicht erhaltenen Seiten-
altäre der Kirche, maßgebend auf die seit Beginn des (7.
Jahrhunderts in unseren Landkirchen so zahlreich entstehen-
den Altäre wirkte, die trotz sehr großer, höchst erfreulicher
Mannigfaltigkeit im Einzelnen in der Anlage doch merk
würdig Übereinstiminen.
Bei den Altären des (7. Jahrhunderts sind vor allem
zwei Gruppen zu unterscheiden, diejenige der ersten Hälfte
und Mitte des Jahrhunderts und die voin Schluffe desselben.
Die stilistischen Gegensätze beider gründen naturgemäß in
der gleichen Umbildung des Geschinacks. die wir schon in
Architektur und Ornamentik beobachteten, in dem zuneh
menden Bestreben nach malerisch effektvoller, prunkender
Wirkung. Für die erste Periode sehr charakteristisch sind
die Altäre, besonders der Hochaltar in Möschenfeld (Ab
bildung S. 3). Auf dem Altartisch steht der Unterbau
des Altares, in dessen Mitte sich beim Hochaltar der Taber-
nakel, bei den Seitenaltären Gemälde oder Reliefs befinden,
er entspricht der Predella des gothischcn Altares. Hierauf
erhebt sich der eigentliche Hochbau des Altares, er besteht
aus dein Mittelbild -— das in Bayer» in der Regel ge-
schnitzt — das zwei stattliche Säulen einschließen, auf dem
Gebälk, das diese Säulen tragen, ruht ein kleiner Aufsatz,
der eine Nische oder ein Medaillon umrahmt, mit der Ge
stalt Gott Vaters oder eines Heiligen; auf den Voluten,
die den Raum zwischen dem weitvorspringenden Gebälk und
dieser Nische füllen, sitzen lebhaft bewegte Engel. Neben den
Säulen, die das Mittelbild flankiren, stehen Heilige, bei Hoch
altären oft lebensgroß, die an die alten Altarflügel erinnern,
was besonders deutlich wird, wenn wie z. B. in Mettel
kämm diese Heiligen zwischen Säulen stehen (Abbildung
B. 5), was aber erst gegen Ende des Jahrhunderts ab
und zu vorkommt. Diese Anordnung erhält sich im wesent
lichen durch das ganze (7. Jahrhundert, die Spätwerke
unterscheiden sich nur durch das anderartige Detail;
es werden, wie z. B. bei dem Hochaltar in Mettelkamm
von (682, vielfach die gedrehten Säulen angewendet, durch
deren Windungen sich in kräftigem Relief gearbeitete Laub
ranken mit Blumen und Früchten ziehen; das für die Spät
Zeit des Jahrhunderts und für den Anfang des folgenden
besonders charakteristische Tartouchenwcrk wird an dem
Unterbau, dann neben den großen Säulen und inr oberen
Aufsatz viel verwendet. Das gesammte Ornament bis in
kleinsten Details strebt in der ersten Periode mehr nach
!uncr Durchbildung, auch nach Originalität im Einzelnen,
Zweiten dagegen in consequenter Entwicklung des
^ 1' '"ehr nach wirksamer Behandlung.
. , ,^Cn üblichen oder figürlichen Schmuck unserer Altäre
/ °l1" k°1' Regel die Holzplastik; Gemälde sind zumal
Bahrhundert noch selten und finden sich meist nur
i» den Hoskirchen oder in ganz großen pfarr und 'Kloster-
kirchen, ja selbst in diesen wetteifert bis in die zweite Hälfte
des (8. Jahrhunderts der geschnitzte Altar mit dem ge-
malten, was schon ein Blick in die Klosterkirchen von
Dietramszell oder Schäftlarn genügend illustriert. Die Blasse
dessen, was die Holzplastik im (7. und (8. Jahrhundert in
Bayern arbeitete, ist erstaunlich groß und das Bild des
künstlerischen Lebens dieser Jahrhunderte entbehrt wenigstens
hier eines sehr wesentlichen Zuges, wenn inan, wie dies
bisher stets geschah, die Holzplastik mit Stillschweigen über-
geht. Will man den eigenartigen Lharakter deutscher Kunst
namentlich auch in seinen lokalen Schattirungen studieren,
so verdient die Plastik, die ja in Deutschland sich weit volks
thümlicher als die Malerei entwickelte, überhaupt eine ganz
St. Nikolaus aus dein Altar zu Berg (Pfarrei Schnaitsee).
andere Würdigung als die, welche sie bisher fand.*) Der
Grund dieser Vernachlässigung der deutschen Plastik in der
Kunstgeschichte liegt einestheils darin, daß dieselbe weit mehr
zeitraubende uitd mühevolle Lokalstudien erfordert als die
Malerei, die wir in: wesentlichen in den Galerien studieren,
dafür gewährt sie dann aber auch einen ganz anderen Ein
blick in die lokalen Kunstverhältnisse als jene; andererseits
erklärt diese Vernachlässigung wohl auch der Umstand, daß
hier uns sehr wenig Künstlernamen erhalten sind, denen
man mit Sicherheit Werke zuschreiben könnte und leider
haftet die deutsche Kunstgeschichte oft noch zu ängstlich an
der Künstlergeschichte, weßhalb man glaubt die Forschung
damit beginnen zu inüssen, daß man einzelne Meister mit
Hülfe meist sehr haltloser Zutheilungen gestaltet, statt in
erster Linie den Lharakter der Perioden, die lokalen Gruppen,
die gcsammten Lebensverhältnisse der Kunst zu erforschen.
*) In sehr erfreulicher Meise wurde bei der Schilderung der
deutschen Kuitft die Plastik mehr in den Vordergrund gerückt durch
den um die Erforschung dieser Kunstart so verdienten !v. Lübke in
seiner: Geschichte der deutschen Kunst. Stuttgart ;sqo.