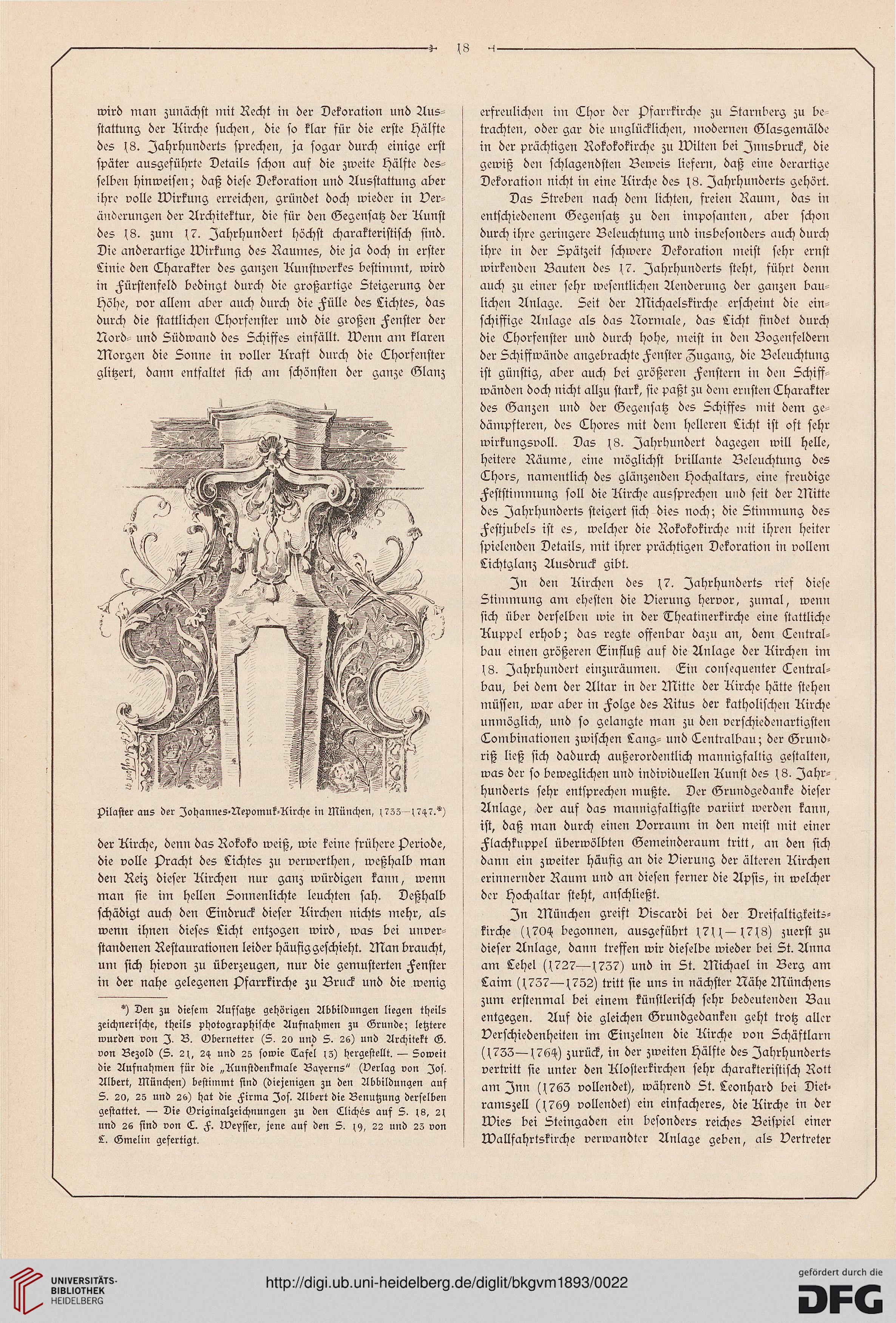wird man zunächst mit Recht in der Dekoration und Aus-
stattung der Kirche suchen, die so klar für die erste pälste
des (8. Jahrhunderts sprechen, ja sogar durch einige erst
später ausgeführte Details schon auf die zweite Hälfte des-
selben Hinweisen; daß diese Dekoration und Ausstattung aber
ihre volle Wirkung erreichen, gründet doch wieder in Ver-
änderungen der Architektur, die für den Gegensatz der Kunst
des (8. zum (7. Jahrhundert höchst charakteristisch sind.
Die anderartige Wirkung des Raumes, die ja doch in erster
Linie den Charakter des ganzen Kunstwerkes bestimmt, wird
in Fürstenseld bedingt durch die großartige Steigerung der
pöhe, vor allem aber auch durch die Fülle des Lichtes, das
durch die stattlichen Chorfenster und die großen Fenster der
Nord- und Südwand des Schiffes einfällt. Wenn am klaren
Morgen die Sonne in voller 'Kraft durch die Chorfenster
glitzert, dann entfaltet sich am schönsten der ganze Glanz
Pilaster aus der Jotzannes-Nepomuk-Airche in München, (735--( 7't".*)
der Kirche, denn das Rokoko weiß, wie keine frühere Periode,
die volle Pracht des Lichtes zu verwerthen, weßhalb man
den Reiz dieser Kirchen nur ganz würdigen kann, wenn
man sie iin Hellen Sonnenlichte leuchten sah. Deßhalb
schädigt auch den Eindruck dieser Kirchen nichts inehr, als
wenn ihnen dieses Licht entzogen wird, was bei unver-
standenen Restaurationen leider häufig geschieht. Man braucht,
uni sich hievon zu überzeugen, nur die gemusterten Fenster
in der nahe gelegenen Pfarrkirche zu Bruck und die wenig *)
*) Den zu diesem Aufsatze gehörigen Abbildungen liegen theils
zeichnerische, theils photographische Aufnahmen zu Grunde; letztere
wurden von I. B. Gbernetter (5. 20 und S. 26) und Architekt G.
von Bezold (S. 2\, 2H und 25 sowie Tafel (3) hcrgestellt. — Soweit
die Aufnahmen für die „Uunstdenkmale Bayerns" (Verlag von Jof.
Albert, München) bestimmt sind (diejenigen zu den Abbildungen auf
S. 20, 25 und 26) hat die Firma Jos. Albert die Benutzung derselben
gestattet. — Die Griginalzeichnungen zu den Llichds auf S. (8, 2\
und 26 sind von £. F. weyffer, jene auf den S. (y, 22 und 25 von
£. Gmelin gefertigt.
erfreulichen im Chor der Pfarrkirche zu Starnberg zu be
trachten, oder gar die unglücklichen, modernen Glasgemälde
in der prächtigen Rokokokirche zu Willen bei Innsbruck, die
gewiß den schlagendsten Beweis liefern, daß eine derartige
Dekoration nicht in eine Kirche des (8. Jahrhunderts gehört.
Das Streben nach dem lichten, freien Raum, das in
entschiedenem Gegensatz zu den imposanten, aber schon
durch ihre geringere Beleuchtung und insbesonders auch durch
ihre in der Spätzeit schwere Dekoration meist sehr ernst
wirkenden Bauten des (7. Jahrhunderts steht, führt denn
auch zu einer sehr wesentlichen Aenderung der ganzen bau-
lichen Anlage. Seit der Michaelskirche erscheint die ein-
schiffige Anlage als das Normale, das Licht findet durch
die Chorfenster und durch hohe, meist in den Bogenfeldern
der Schiffwände angebrachte Fenster Zugang, die Beleuchtung
ist günstig, aber auch bei größeren Fenstern in den Schiff-
wänden doch nicht allzu stark, sie paßt zu dem ernsten Charakter
des Ganzen und der Gegensatz des Schiffes mit dem ge-
dämpfteren, des Chores mit dem helleren Licht ist oft sehr
wirkungsvoll. Das (8. Jahrhundert dagegen will Helle,
heitere Räume, eine möglichst brillante Beleuchtung des
Chors, namentlich des glänzenden Pochaltars, eine freudige
Feststimmung soll die Kirche aussprechen und seit der Mitte
des Jahrhunderts steigert sich dies noch; die Stimmung des
Festjubels ist es, welcher die Rokokokirche mit ihren heiter
spielenden Details, mit ihrer prächtigen Dekoration in vollem
Lichtglanz Ausdruck gibt.
In den Kirchen des \7. Jahrhunderts rief diese
Stimmung am ehesten die Vierung hervor, zumal, wenn
sich über derselben wie in der Theatinerkirche eine stattliche
Kuppel erhob; das regte offenbar dazu an, dem Central-
bau einen größeren Einfluß auf die Anlage der Kirchen im
(8. Jahrhundert einzuräumen. Ein confequenter Central-
bau, bei dem der Altar in der Mitte der Kirche hätte stehen
müssen, war aber in Folge des Ritus der katholischen Kirche
unmöglich, und so gelangte man zu den verschiedenartigsten
Lombinationen zwischen Lang- und Lentralbau; der Grund-
riß ließ sich dadurch außerordentlich mannigfaltig gestalten,
was der so beweglichen und individuellen Kunst des (8. Jahr-
hunderts sehr entsprechen mußte. Der Grundgedanke dieser
Anlage, der auf das mannigfaltigste variirt werden kann,
ist, daß man durch einen Vorraum in den meist mit einer
Flachkuppel überwölbten Gemeinderaum tritt, an den sich
dann ein zweiter häufig an die Vierung der älteren Kirchen
erinnernder Raum uud an diesen ferner die Apsis, in welcher
der Pochaltar steht, anschließt.
In München greift Viscardi bei der Dreifaltigkeits-
kirche ((704 begonnen, ausgeführt (7( ( — (7(8) zuerst zu
dieser Anlage, dann treffen wir dieselbe wieder bei St. Anna
am Lehel ((727— (737) und in St. Michael in Berg am
Laim ((737—(752) tritt sie uns in nächster Nähe Münchens
zuni erstennial bei einem künstlerisch sehr bedeutenden Bau
entgegen. Auf die gleichen Grundgedanken geht trotz aller
Verschiedenheiten im Einzelnen die Kirche von Schäftlarn
((733—(764;) zurück, in der zweiten pälfte des Jahrhunderts
vertritt sie unter den Klosterkirchen sehr charakteristisch Rott
am Inn ((763 vollendet), während St. Leonhard bei Diet-
ramszell ((76ß vollendet) ein einfacheres, die Kirche in der
Wies bei Steingaden ein besonders reiches Beispiel einer
Wallfahrtskirche verwandter Anlage geben, als Vertreter
stattung der Kirche suchen, die so klar für die erste pälste
des (8. Jahrhunderts sprechen, ja sogar durch einige erst
später ausgeführte Details schon auf die zweite Hälfte des-
selben Hinweisen; daß diese Dekoration und Ausstattung aber
ihre volle Wirkung erreichen, gründet doch wieder in Ver-
änderungen der Architektur, die für den Gegensatz der Kunst
des (8. zum (7. Jahrhundert höchst charakteristisch sind.
Die anderartige Wirkung des Raumes, die ja doch in erster
Linie den Charakter des ganzen Kunstwerkes bestimmt, wird
in Fürstenseld bedingt durch die großartige Steigerung der
pöhe, vor allem aber auch durch die Fülle des Lichtes, das
durch die stattlichen Chorfenster und die großen Fenster der
Nord- und Südwand des Schiffes einfällt. Wenn am klaren
Morgen die Sonne in voller 'Kraft durch die Chorfenster
glitzert, dann entfaltet sich am schönsten der ganze Glanz
Pilaster aus der Jotzannes-Nepomuk-Airche in München, (735--( 7't".*)
der Kirche, denn das Rokoko weiß, wie keine frühere Periode,
die volle Pracht des Lichtes zu verwerthen, weßhalb man
den Reiz dieser Kirchen nur ganz würdigen kann, wenn
man sie iin Hellen Sonnenlichte leuchten sah. Deßhalb
schädigt auch den Eindruck dieser Kirchen nichts inehr, als
wenn ihnen dieses Licht entzogen wird, was bei unver-
standenen Restaurationen leider häufig geschieht. Man braucht,
uni sich hievon zu überzeugen, nur die gemusterten Fenster
in der nahe gelegenen Pfarrkirche zu Bruck und die wenig *)
*) Den zu diesem Aufsatze gehörigen Abbildungen liegen theils
zeichnerische, theils photographische Aufnahmen zu Grunde; letztere
wurden von I. B. Gbernetter (5. 20 und S. 26) und Architekt G.
von Bezold (S. 2\, 2H und 25 sowie Tafel (3) hcrgestellt. — Soweit
die Aufnahmen für die „Uunstdenkmale Bayerns" (Verlag von Jof.
Albert, München) bestimmt sind (diejenigen zu den Abbildungen auf
S. 20, 25 und 26) hat die Firma Jos. Albert die Benutzung derselben
gestattet. — Die Griginalzeichnungen zu den Llichds auf S. (8, 2\
und 26 sind von £. F. weyffer, jene auf den S. (y, 22 und 25 von
£. Gmelin gefertigt.
erfreulichen im Chor der Pfarrkirche zu Starnberg zu be
trachten, oder gar die unglücklichen, modernen Glasgemälde
in der prächtigen Rokokokirche zu Willen bei Innsbruck, die
gewiß den schlagendsten Beweis liefern, daß eine derartige
Dekoration nicht in eine Kirche des (8. Jahrhunderts gehört.
Das Streben nach dem lichten, freien Raum, das in
entschiedenem Gegensatz zu den imposanten, aber schon
durch ihre geringere Beleuchtung und insbesonders auch durch
ihre in der Spätzeit schwere Dekoration meist sehr ernst
wirkenden Bauten des (7. Jahrhunderts steht, führt denn
auch zu einer sehr wesentlichen Aenderung der ganzen bau-
lichen Anlage. Seit der Michaelskirche erscheint die ein-
schiffige Anlage als das Normale, das Licht findet durch
die Chorfenster und durch hohe, meist in den Bogenfeldern
der Schiffwände angebrachte Fenster Zugang, die Beleuchtung
ist günstig, aber auch bei größeren Fenstern in den Schiff-
wänden doch nicht allzu stark, sie paßt zu dem ernsten Charakter
des Ganzen und der Gegensatz des Schiffes mit dem ge-
dämpfteren, des Chores mit dem helleren Licht ist oft sehr
wirkungsvoll. Das (8. Jahrhundert dagegen will Helle,
heitere Räume, eine möglichst brillante Beleuchtung des
Chors, namentlich des glänzenden Pochaltars, eine freudige
Feststimmung soll die Kirche aussprechen und seit der Mitte
des Jahrhunderts steigert sich dies noch; die Stimmung des
Festjubels ist es, welcher die Rokokokirche mit ihren heiter
spielenden Details, mit ihrer prächtigen Dekoration in vollem
Lichtglanz Ausdruck gibt.
In den Kirchen des \7. Jahrhunderts rief diese
Stimmung am ehesten die Vierung hervor, zumal, wenn
sich über derselben wie in der Theatinerkirche eine stattliche
Kuppel erhob; das regte offenbar dazu an, dem Central-
bau einen größeren Einfluß auf die Anlage der Kirchen im
(8. Jahrhundert einzuräumen. Ein confequenter Central-
bau, bei dem der Altar in der Mitte der Kirche hätte stehen
müssen, war aber in Folge des Ritus der katholischen Kirche
unmöglich, und so gelangte man zu den verschiedenartigsten
Lombinationen zwischen Lang- und Lentralbau; der Grund-
riß ließ sich dadurch außerordentlich mannigfaltig gestalten,
was der so beweglichen und individuellen Kunst des (8. Jahr-
hunderts sehr entsprechen mußte. Der Grundgedanke dieser
Anlage, der auf das mannigfaltigste variirt werden kann,
ist, daß man durch einen Vorraum in den meist mit einer
Flachkuppel überwölbten Gemeinderaum tritt, an den sich
dann ein zweiter häufig an die Vierung der älteren Kirchen
erinnernder Raum uud an diesen ferner die Apsis, in welcher
der Pochaltar steht, anschließt.
In München greift Viscardi bei der Dreifaltigkeits-
kirche ((704 begonnen, ausgeführt (7( ( — (7(8) zuerst zu
dieser Anlage, dann treffen wir dieselbe wieder bei St. Anna
am Lehel ((727— (737) und in St. Michael in Berg am
Laim ((737—(752) tritt sie uns in nächster Nähe Münchens
zuni erstennial bei einem künstlerisch sehr bedeutenden Bau
entgegen. Auf die gleichen Grundgedanken geht trotz aller
Verschiedenheiten im Einzelnen die Kirche von Schäftlarn
((733—(764;) zurück, in der zweiten pälfte des Jahrhunderts
vertritt sie unter den Klosterkirchen sehr charakteristisch Rott
am Inn ((763 vollendet), während St. Leonhard bei Diet-
ramszell ((76ß vollendet) ein einfacheres, die Kirche in der
Wies bei Steingaden ein besonders reiches Beispiel einer
Wallfahrtskirche verwandter Anlage geben, als Vertreter