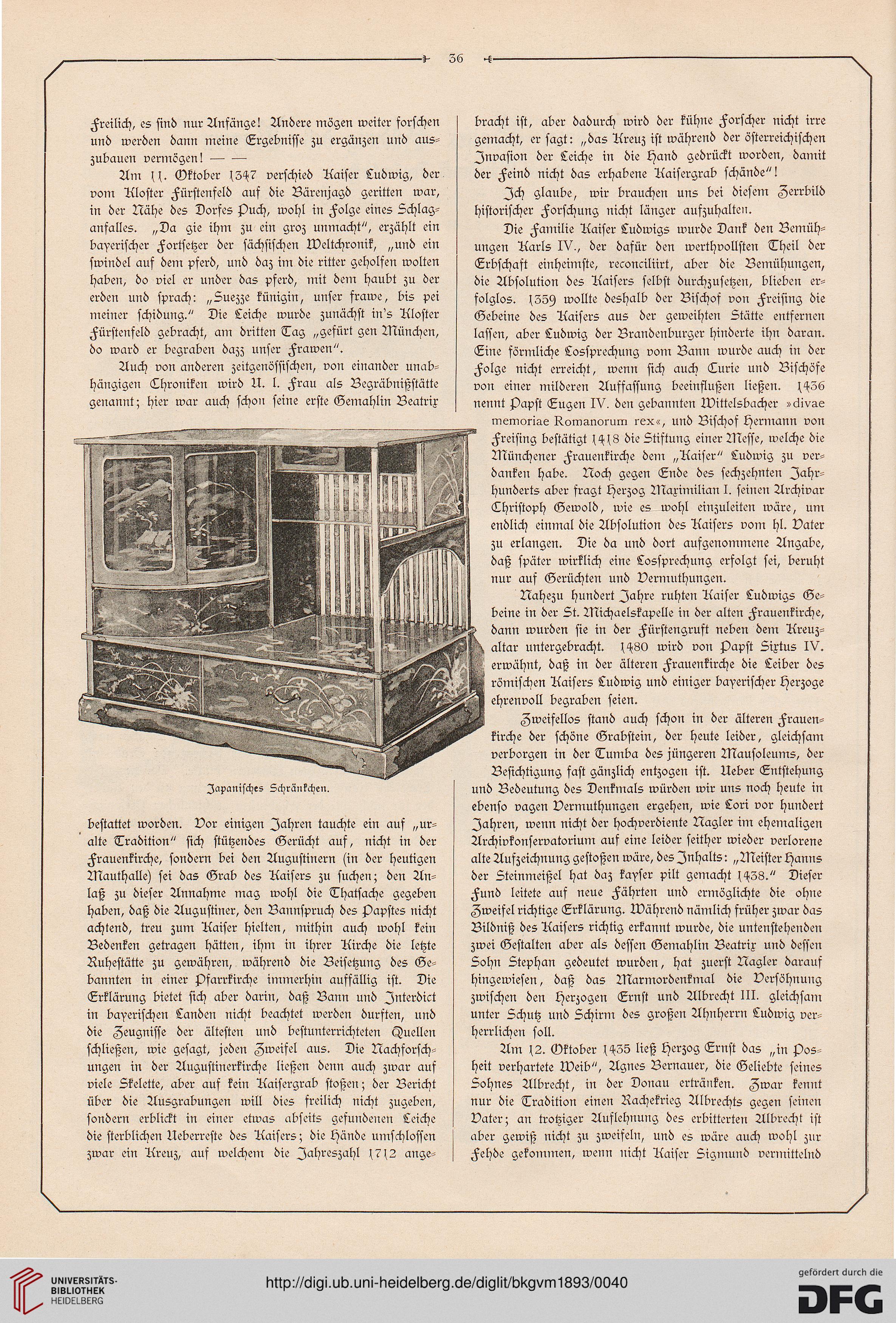■h 36 -k>
Freilich, es find nur Anfänge! Andere mögen weiter forschen
und werden dann meine Ergebnisse zu ergänzen und aus-
zubauen vermögen!-
Am i l- Oktober f3^7 verschied Baiser Ludwig, der
vom Bloster Fürstenfeld auf die Bärenjagd geritten war,
in der Nähe des Dorfes Puch, wohl in Folge eines Schlag-
anfalles. „Da gie ihm zu ein groz unmacht", erzählt ein
bayerischer Fortsetzer der sächsischen Meltchronik, „und ein
swindel auf dem pferd, und daz im die ritter geholfen wollen
haben, do viel er under das pferd, mit dem haubt zu der
erden und sprach: „Suezze künigin, unser frawe, bis pei
meiner schidung." Die Leiche wurde zunächst in's Bloster
Fürstenfeld gebracht, am dritten Tag „gefürt gen München,
do ward er begraben dazz unser Frawen".
Auch von anderen zeitgenössischen, von einander unab-
hängigen Throniken wird B. l. Frau als Begräbnißstätte
genannt; hier war auch schon seine erste Gemahlin Beatrix
Japanisches Schränkchen.
bestattet worden. Bor einigen fahren tauchte ein auf „ur-
alte Tradition" sich stützendes Gerücht auf, nicht in der
Frauenkirche, sondern bei den Augustinern sin der heutigen
Mauthalle) sei das Grab des Baisers zu suchen; den An-
laß zu dieser Annahme mag wohl die Thatsache gegeben
haben, daß die Augustiner, den Bannspruch des Papstes nicht
achtend, treu zum Baiser hielten, inithin auch wohl kein
Bedenken getragen hätten, ihm in ihrer Birche die letzte
Ruhestätte zu gewähren, während die Beisetzung des Ge-
bannten in einer Pfarrkirche immerhin auffällig ist. Die
Erklärung bietet sich aber darin, daß Bann und Interdict
in bayerischeil Landen nicht beachtet werden dursten, und
die Zeugnisse der ältesten und bestunterrichteten Quellen
schließen, wie gesagt, jeden Zweifel aus. Die Nachforsch-
ungen in der Augustinerkirche ließen denn auch zwar auf
viele Skelette, aber auf kein Baisergrab stoßen; der Bericht
über die Ausgrabungen will dies freilich nicht zugeben,
sondern erblickt in einer etwas abseits gefundenen Leiche
die sterblichen Neberreste des Baisers; die pände umschlossen
zwar ein Breuz, auf welchem die Jahreszahl \7\2 ange-
bracht ist, aber dadurch wird der kühne Forscher nicht irre
genlacht, er sagt: „das Breuz ist während der österreichischen
Invasion der Leiche in die pand gedrückt worden, damit
der Feind nicht das erhabene Baisergrab schände"!
Ich glaube, wir brauchen uns bei diesen: Zerrbild
historischer Forschung nicht länger aufzuhalten.
Die Familie Baiser Ludwigs wurde Dank den Bemüh-
ungen Barls IV., der dafür den werthvollsten Theil der
Erbschaft einheimste, reconeiliirt, aber die Bemühungen,
die Absolution des Baisers selbst durchzusetzen, blieben er-
folglos. s33ß wollte deshalb der Bischof von Freising die
Gebeins des Baisers aus der geweihten Stätte entfernen
lasten, aber Ludwig der Brandenburger hinderte ihn daran.
Eine förinliche Lossprechung von: Bann wurde auch in der
Folge nicht erreicht, wenn sich auch Turie und Bischöfe
voll einer milderen Auffassung beeinflußen ließen. s^56
nenilt Papst Eugen IV. den gebannten Mittelsbacher »divae
memoriae Romanorum rex«, und Bischof Permann von
Freising bestätigt \ % {8 die Stiftung einer Messe, welche die
Münchener Frauenkirche dem „Baiser" Ludwig zu ver-
danken habe. Noch gegen Ende des sechzehnten Jahr-
hunderts aber fragt Perzog Maximilian l. seinen Archivar
Thristoph Gewold, wie es wohl einzuleiten wäre, mu
endlich einmal die Absolution des Baisers von: hl. Bater
zu erlangen. Die da und dort aufgenonlinene Angabe,
daß später wirklich eine Lossprechung erfolgt sei, beruht
nur auf Gerüchten und Beniluthungen.
Nahezu hundert Jahre ruhten Baiser Ludwigs Ge-
beine in der St. Michaelskapelle in der alten Frauenkirche,
dann wurden sie in der Fürstengruft neben den: Breuz-
altar untergebracht, sq.80 wird von Papst Sixtus IV.
erwähnt, daß in der älteren Frauenkirche die Leiber des
römischen Baisers Ludwig und einiger bayerischer perzoge
ehrenvoll begraben seien.
Zweifellos stand auch schon in der älteren Frauen-
kirche der schöne Grabstein, der heute leider, gleichsam
verborgen in der Tunlba des jüngeren Mausoleums, der
Besichtigung fast gänzlich entzogen ist. lieber Entstehung
und Bedeutung des Denkmals würden wir uns noch heute in
ebenso vagen Bermuthungen ergehen, wie Lori vor hundert
Jahren, wenn nicht der hochverdiente Nagler im ehemaligen
Archivkonservatorium auf eine leider seither wieder verlorene
alte Aufzeichnung gestoßen wäre, des Inhalts: „Meister panns
der Steinmeißel hat daz kayser pilt gemacht sq.58." Dieser
Fund leitete aus neue Fährten und ernlöglichte die ohile
Zweifel richtige Erklärung. Mährend nänrlich früher zwar das
Bildniß des Baisers richtig erkannt wurde, die untenstehenden
zwei Gestalten aber als dessen Genrahlin Beatrix und dessen
Sohn Stephan gedeutet wurden, hat zuerst Nagler daraus
hingewiesen, daß das Marnrordenkmal die Versöhnung
zwischen den perzogen Ernst und Albrecht III. gleichsam
unter Schutz und Schirm des große,: Ahnherrn Ludwig ver-
herrlichen soll.
Am \2. Oktober ^35 ließ perzog Ernst das „in pos-
heit verhärtete Meib", Agnes Bernauer, die Geliebte seines
Sohnes Albrecht, in der Donau ertränken. Zwar kennt
nur die Tradition einen Rachekrieg Albrechts gegen seinen
Vater; an trotziger Auflehnung des erbitterten Albrecht ist
aber gewiß nicht zu zweifeln, und es wäre auch wohl zur
Fehde gekoininen, wenn nicht Baiser Sigmund vermittelnd
Freilich, es find nur Anfänge! Andere mögen weiter forschen
und werden dann meine Ergebnisse zu ergänzen und aus-
zubauen vermögen!-
Am i l- Oktober f3^7 verschied Baiser Ludwig, der
vom Bloster Fürstenfeld auf die Bärenjagd geritten war,
in der Nähe des Dorfes Puch, wohl in Folge eines Schlag-
anfalles. „Da gie ihm zu ein groz unmacht", erzählt ein
bayerischer Fortsetzer der sächsischen Meltchronik, „und ein
swindel auf dem pferd, und daz im die ritter geholfen wollen
haben, do viel er under das pferd, mit dem haubt zu der
erden und sprach: „Suezze künigin, unser frawe, bis pei
meiner schidung." Die Leiche wurde zunächst in's Bloster
Fürstenfeld gebracht, am dritten Tag „gefürt gen München,
do ward er begraben dazz unser Frawen".
Auch von anderen zeitgenössischen, von einander unab-
hängigen Throniken wird B. l. Frau als Begräbnißstätte
genannt; hier war auch schon seine erste Gemahlin Beatrix
Japanisches Schränkchen.
bestattet worden. Bor einigen fahren tauchte ein auf „ur-
alte Tradition" sich stützendes Gerücht auf, nicht in der
Frauenkirche, sondern bei den Augustinern sin der heutigen
Mauthalle) sei das Grab des Baisers zu suchen; den An-
laß zu dieser Annahme mag wohl die Thatsache gegeben
haben, daß die Augustiner, den Bannspruch des Papstes nicht
achtend, treu zum Baiser hielten, inithin auch wohl kein
Bedenken getragen hätten, ihm in ihrer Birche die letzte
Ruhestätte zu gewähren, während die Beisetzung des Ge-
bannten in einer Pfarrkirche immerhin auffällig ist. Die
Erklärung bietet sich aber darin, daß Bann und Interdict
in bayerischeil Landen nicht beachtet werden dursten, und
die Zeugnisse der ältesten und bestunterrichteten Quellen
schließen, wie gesagt, jeden Zweifel aus. Die Nachforsch-
ungen in der Augustinerkirche ließen denn auch zwar auf
viele Skelette, aber auf kein Baisergrab stoßen; der Bericht
über die Ausgrabungen will dies freilich nicht zugeben,
sondern erblickt in einer etwas abseits gefundenen Leiche
die sterblichen Neberreste des Baisers; die pände umschlossen
zwar ein Breuz, auf welchem die Jahreszahl \7\2 ange-
bracht ist, aber dadurch wird der kühne Forscher nicht irre
genlacht, er sagt: „das Breuz ist während der österreichischen
Invasion der Leiche in die pand gedrückt worden, damit
der Feind nicht das erhabene Baisergrab schände"!
Ich glaube, wir brauchen uns bei diesen: Zerrbild
historischer Forschung nicht länger aufzuhalten.
Die Familie Baiser Ludwigs wurde Dank den Bemüh-
ungen Barls IV., der dafür den werthvollsten Theil der
Erbschaft einheimste, reconeiliirt, aber die Bemühungen,
die Absolution des Baisers selbst durchzusetzen, blieben er-
folglos. s33ß wollte deshalb der Bischof von Freising die
Gebeins des Baisers aus der geweihten Stätte entfernen
lasten, aber Ludwig der Brandenburger hinderte ihn daran.
Eine förinliche Lossprechung von: Bann wurde auch in der
Folge nicht erreicht, wenn sich auch Turie und Bischöfe
voll einer milderen Auffassung beeinflußen ließen. s^56
nenilt Papst Eugen IV. den gebannten Mittelsbacher »divae
memoriae Romanorum rex«, und Bischof Permann von
Freising bestätigt \ % {8 die Stiftung einer Messe, welche die
Münchener Frauenkirche dem „Baiser" Ludwig zu ver-
danken habe. Noch gegen Ende des sechzehnten Jahr-
hunderts aber fragt Perzog Maximilian l. seinen Archivar
Thristoph Gewold, wie es wohl einzuleiten wäre, mu
endlich einmal die Absolution des Baisers von: hl. Bater
zu erlangen. Die da und dort aufgenonlinene Angabe,
daß später wirklich eine Lossprechung erfolgt sei, beruht
nur auf Gerüchten und Beniluthungen.
Nahezu hundert Jahre ruhten Baiser Ludwigs Ge-
beine in der St. Michaelskapelle in der alten Frauenkirche,
dann wurden sie in der Fürstengruft neben den: Breuz-
altar untergebracht, sq.80 wird von Papst Sixtus IV.
erwähnt, daß in der älteren Frauenkirche die Leiber des
römischen Baisers Ludwig und einiger bayerischer perzoge
ehrenvoll begraben seien.
Zweifellos stand auch schon in der älteren Frauen-
kirche der schöne Grabstein, der heute leider, gleichsam
verborgen in der Tunlba des jüngeren Mausoleums, der
Besichtigung fast gänzlich entzogen ist. lieber Entstehung
und Bedeutung des Denkmals würden wir uns noch heute in
ebenso vagen Bermuthungen ergehen, wie Lori vor hundert
Jahren, wenn nicht der hochverdiente Nagler im ehemaligen
Archivkonservatorium auf eine leider seither wieder verlorene
alte Aufzeichnung gestoßen wäre, des Inhalts: „Meister panns
der Steinmeißel hat daz kayser pilt gemacht sq.58." Dieser
Fund leitete aus neue Fährten und ernlöglichte die ohile
Zweifel richtige Erklärung. Mährend nänrlich früher zwar das
Bildniß des Baisers richtig erkannt wurde, die untenstehenden
zwei Gestalten aber als dessen Genrahlin Beatrix und dessen
Sohn Stephan gedeutet wurden, hat zuerst Nagler daraus
hingewiesen, daß das Marnrordenkmal die Versöhnung
zwischen den perzogen Ernst und Albrecht III. gleichsam
unter Schutz und Schirm des große,: Ahnherrn Ludwig ver-
herrlichen soll.
Am \2. Oktober ^35 ließ perzog Ernst das „in pos-
heit verhärtete Meib", Agnes Bernauer, die Geliebte seines
Sohnes Albrecht, in der Donau ertränken. Zwar kennt
nur die Tradition einen Rachekrieg Albrechts gegen seinen
Vater; an trotziger Auflehnung des erbitterten Albrecht ist
aber gewiß nicht zu zweifeln, und es wäre auch wohl zur
Fehde gekoininen, wenn nicht Baiser Sigmund vermittelnd