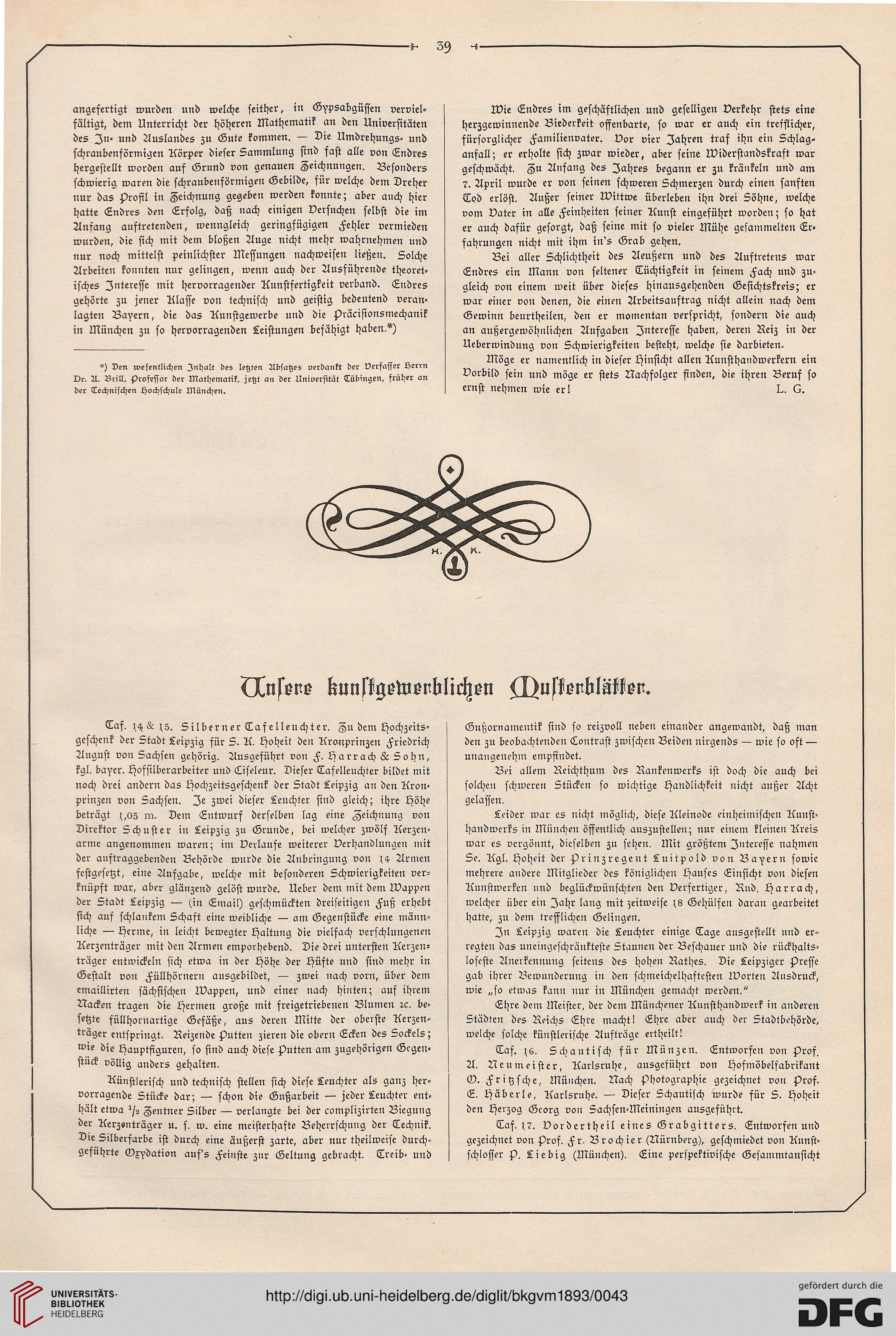'3- 59 “*
angefertigt wurden und welche seither, in Gypsabgüssen verviel-
fältigt, dem Unterricht der höheren Mathematik an den Universitäten
des In- und Auslandes zu Gute kommen. — Die Umdrehungs- und
schraubenförmigen Körper dieser Sammlung sind fast alle von Endres
hergestellt worden auf Grund von genauen Zeichnungen. Besonders
schwierig waren die schraubenförmigen Gebilde, für welche dem Dreher
nur das Profil in Zeichnung gegeben werden konnte; aber auch hier
hatte Lndres den Erfolg, daß nach einigen versuchen selbst die im
Anfang auftretenden, wenngleich geringfügigen Fehler vermieden
wurden, die sich mit dem bloßen Auge nicht mehr wahrnehmen und
nur noch mittelst peinlichster Messungen nachweifen ließe». Solche
Arbeiten konnten nur gelingen, wenn auch der Ausführende theoret-
isches Interesse mit hervorragender Kunstfertigkeit verband. Endres
gehörte zu jener Klaffe von technisch und geistig bedeutend veran-
lagten Bayern, die das Kunstgewerbe und die Präcisionsmechanik
in München zu so hervorragenden Leistungen befähigt haben.*)
*) Den wesentlichen Inhalt des letzten Absatzes verdankt der Verfasser Herrn
Dr. A. Brill, Professor der Mathematik, jetzt an der Universität Tübingen, früher an
der Technischen Hochschule München.
Wie Lndres im geschäftlichen und geselligen Verkehr stets eine
herzgewinnende Biederkeit offenbarte, so war er auch ein trefflicher,
fürsorglicher Familienvater, vor vier Jahren traf ihn ein Schlag-
anfall; er erholte sich zwar wieder, aber seine Widerstandskraft war
geschwächt. Zu Anfang des Jahres begann er zu kränkeln und am
7. April wurde er von feinen schweren Schmerzen durch einen sanften
Tod erlöst. Außer seiner lvittwe überleben ihn drei Söhne, welche
vom Vater in alle Feinheiten seiner Kunst eingeführt worden; so hat
er auch dafür gesorgt, daß seine mit so vieler Mühe gesammelten Er-
fahrungen nicht mit ihm in's Grab gehen.
Bei aller Schlichtheit des Aeußern und des Auftretens war
Lndres ein Mann von seltener Tüchtigkeit in seinem Fach und zu-
gleich von einem weit über dieses hinausgehenden Gesichtskreis; er
war einer von denen, die einen Arbeitsauftrag nicht allein nach dem
Gewinn beurtheilen, den er momentan verspricht, sondern die auch
an außergewöhnlichen Ausgaben Interesse haben, deren Reiz in der
Ueberwindung von Schwierigkeiten besteht, welche sie darbieten.
Möge er namentlich in dieser Hinsicht allen Kunsthandwerkern ein
Vorbild sein und möge er stets Nachfolger finden, die ihren Beruf so
ernst nehmen wie er I L. G.
OCnfWü kunstgewerblichen (DusterblAter.
Eaf. Silberner Tafelleuchter. Zu dem Hochzeits-
gefchenk der Stadt Leipzig für S. K. Hoheit den Kronprinzen Friedrich
August von Sachsen gehörig. Ausgeführt von F. Harr ach & Sohn,
kgl. bayer. Hofsilberarbeiter und Lifeleur. Dieser Tafelleuchter bildet mit
noch drei andern das Hochzeitsgeschenk der Stadt Leipzig an den Kron-
prinzen von Sachsen. Je zwei dieser Leuchter sind gleich; ihre Höhe
beträgt ;,05 m. Dem Entwurf derselben lag eine Zeichnung von
Direktor Schuster in Leipzig zu Grunde, bei welcher zwölf Kerzen-
arme angenommen waren; im verlause weiterer Verhandlungen mit
der austraggebeuden Behörde wurde die Anbringung von (4 Arnien
festgesetzt, eine Ausgabe, welche mit besonderen Schwierigkeiten ver-
knüpft war, aber glänzend gelöst wurde. Ueber dem mit dem Wappen
der Stadt Leipzig — (in Email) geschmückten dreiseitigen Fuß erhebt
sich aus schlankem Schaft eine weibliche — am Gegenstücke eine männ-
liche — Herme, in leicht bewegter Haltung die vielfach verschlungenen
Kerzenträger mit den Arme» emxorhebend. Die drei untersten Kerzen-
träger entwickeln sich etwa in der Höhe der Hüfte und sind mehr in
Gestalt von Füllhörnern ausgebildet, — zwei nach vorn, über dem
emaillirten sächsischen Wappen, und einer nach hinten; auf ihrem
Nacken tragen die Hermen große mit freigetriebenen Blumen rc. be-
setzte füllhornartige Gefäße, aus deren Mitte der oberste Kerzen-
träger entspringt. Reizende Putten zieren die ober» Ecken des Sockels;
wie die Hauptfiguren, so sind auch diese Putten am zugehörigen Gegen-
stück völlig anders gehalten.
Künstlerisch und technisch stellen sich diese Leuchter als ganz her-
vorragende Stücke dar; — schon die Gußarbeit — jeder Leuchter ent-
hält etwa 1jv Zentner Silber — verlangte bei der complizirten Biegung
der Kerzsnträger u. f. w. eine meisterhafte Beherrschung der Technik.
Die Silberfarbe ist durch eine äußerst zarte, aber nur theilweise durch-
geführte Gxydation auf's Feinste znr Geltung gebracht. Treib- und
Gußornamentik sind so reizvoll neben einander angewandt, daß man
den zu beobachtenden Tontrast zwischen Beiden nirgends — wie so oft —
unangenehm empfindet.
Bei allem Reichthum des Rankenwerks ist doch die auch bei
solchen schweren Stücken so wichtige Handlichkeit nicht außer Acht
gelassen.
Leider war es nicht möglich, diese Kleinode einheimischen Knnst-
handwerks in München öffentlich auszustellen; nur einem kleinen Kreis
war es vergönnt, dieselben zu sehen. Mit größtem Interesse nahmen
Se. Kgl. Hoheit der Prinzregent Luitpold von Bayern sowie
mehrere andere Mitglieder des königlichen Hauses Einsicht von diesen
Kunstwerken und beglückwünschten den Verfertiger, Rnd. Harrach,
welcher über ein Jahr lang mit zeitweise (8 Gehülfen daran gearbeitet
hatte, zu dem trefflichen Gelingen.
In Leipzig waren die Leuchter einige Tage ausgestellt nnd er-
regten das uneingeschränkteste Staunen der Beschauer und die rückhalts-
loseste Anerkennung seitens des hohen Rathes. Die Leipziger Presse
gab ihrer Bewunderung in den schmeichelhaftesten Worten Ausdruck,
wie „so etwas kann nur in München gemacht werden."
Ehre dem Meister, der dem Münchener Kunsthandwerk in anderen
Städten des Reichs Ehre macht! Ehre aber auch der Stadtbehörde,
welche solche künstlerische Aufträge ertheilt!
Taf. ;s. Schautisch für Münzen. Entworfen von Prof.
A. Ne»Meister, Karlsruhe, ausgeführt von Hofmöbelfabrikant
G. Fritzfche, München. Nach Photographie gezeichnet von Prof.
E. Häberle, Karlsruhe. — Dieser Schautisch wurde für S. Hoheit
den Herzog Georg von Sachsen-Meiningen ausgeführt.
Taf. (7. vordertheil eines Grabgitters. Entworfen und
gezeichnet von Prof. Fr. Brochier (Nürnberg), geschmiedet von Kunst-
schlosser P. Liebig (München). Eine perspektivische Gesammtansicht
angefertigt wurden und welche seither, in Gypsabgüssen verviel-
fältigt, dem Unterricht der höheren Mathematik an den Universitäten
des In- und Auslandes zu Gute kommen. — Die Umdrehungs- und
schraubenförmigen Körper dieser Sammlung sind fast alle von Endres
hergestellt worden auf Grund von genauen Zeichnungen. Besonders
schwierig waren die schraubenförmigen Gebilde, für welche dem Dreher
nur das Profil in Zeichnung gegeben werden konnte; aber auch hier
hatte Lndres den Erfolg, daß nach einigen versuchen selbst die im
Anfang auftretenden, wenngleich geringfügigen Fehler vermieden
wurden, die sich mit dem bloßen Auge nicht mehr wahrnehmen und
nur noch mittelst peinlichster Messungen nachweifen ließe». Solche
Arbeiten konnten nur gelingen, wenn auch der Ausführende theoret-
isches Interesse mit hervorragender Kunstfertigkeit verband. Endres
gehörte zu jener Klaffe von technisch und geistig bedeutend veran-
lagten Bayern, die das Kunstgewerbe und die Präcisionsmechanik
in München zu so hervorragenden Leistungen befähigt haben.*)
*) Den wesentlichen Inhalt des letzten Absatzes verdankt der Verfasser Herrn
Dr. A. Brill, Professor der Mathematik, jetzt an der Universität Tübingen, früher an
der Technischen Hochschule München.
Wie Lndres im geschäftlichen und geselligen Verkehr stets eine
herzgewinnende Biederkeit offenbarte, so war er auch ein trefflicher,
fürsorglicher Familienvater, vor vier Jahren traf ihn ein Schlag-
anfall; er erholte sich zwar wieder, aber seine Widerstandskraft war
geschwächt. Zu Anfang des Jahres begann er zu kränkeln und am
7. April wurde er von feinen schweren Schmerzen durch einen sanften
Tod erlöst. Außer seiner lvittwe überleben ihn drei Söhne, welche
vom Vater in alle Feinheiten seiner Kunst eingeführt worden; so hat
er auch dafür gesorgt, daß seine mit so vieler Mühe gesammelten Er-
fahrungen nicht mit ihm in's Grab gehen.
Bei aller Schlichtheit des Aeußern und des Auftretens war
Lndres ein Mann von seltener Tüchtigkeit in seinem Fach und zu-
gleich von einem weit über dieses hinausgehenden Gesichtskreis; er
war einer von denen, die einen Arbeitsauftrag nicht allein nach dem
Gewinn beurtheilen, den er momentan verspricht, sondern die auch
an außergewöhnlichen Ausgaben Interesse haben, deren Reiz in der
Ueberwindung von Schwierigkeiten besteht, welche sie darbieten.
Möge er namentlich in dieser Hinsicht allen Kunsthandwerkern ein
Vorbild sein und möge er stets Nachfolger finden, die ihren Beruf so
ernst nehmen wie er I L. G.
OCnfWü kunstgewerblichen (DusterblAter.
Eaf. Silberner Tafelleuchter. Zu dem Hochzeits-
gefchenk der Stadt Leipzig für S. K. Hoheit den Kronprinzen Friedrich
August von Sachsen gehörig. Ausgeführt von F. Harr ach & Sohn,
kgl. bayer. Hofsilberarbeiter und Lifeleur. Dieser Tafelleuchter bildet mit
noch drei andern das Hochzeitsgeschenk der Stadt Leipzig an den Kron-
prinzen von Sachsen. Je zwei dieser Leuchter sind gleich; ihre Höhe
beträgt ;,05 m. Dem Entwurf derselben lag eine Zeichnung von
Direktor Schuster in Leipzig zu Grunde, bei welcher zwölf Kerzen-
arme angenommen waren; im verlause weiterer Verhandlungen mit
der austraggebeuden Behörde wurde die Anbringung von (4 Arnien
festgesetzt, eine Ausgabe, welche mit besonderen Schwierigkeiten ver-
knüpft war, aber glänzend gelöst wurde. Ueber dem mit dem Wappen
der Stadt Leipzig — (in Email) geschmückten dreiseitigen Fuß erhebt
sich aus schlankem Schaft eine weibliche — am Gegenstücke eine männ-
liche — Herme, in leicht bewegter Haltung die vielfach verschlungenen
Kerzenträger mit den Arme» emxorhebend. Die drei untersten Kerzen-
träger entwickeln sich etwa in der Höhe der Hüfte und sind mehr in
Gestalt von Füllhörnern ausgebildet, — zwei nach vorn, über dem
emaillirten sächsischen Wappen, und einer nach hinten; auf ihrem
Nacken tragen die Hermen große mit freigetriebenen Blumen rc. be-
setzte füllhornartige Gefäße, aus deren Mitte der oberste Kerzen-
träger entspringt. Reizende Putten zieren die ober» Ecken des Sockels;
wie die Hauptfiguren, so sind auch diese Putten am zugehörigen Gegen-
stück völlig anders gehalten.
Künstlerisch und technisch stellen sich diese Leuchter als ganz her-
vorragende Stücke dar; — schon die Gußarbeit — jeder Leuchter ent-
hält etwa 1jv Zentner Silber — verlangte bei der complizirten Biegung
der Kerzsnträger u. f. w. eine meisterhafte Beherrschung der Technik.
Die Silberfarbe ist durch eine äußerst zarte, aber nur theilweise durch-
geführte Gxydation auf's Feinste znr Geltung gebracht. Treib- und
Gußornamentik sind so reizvoll neben einander angewandt, daß man
den zu beobachtenden Tontrast zwischen Beiden nirgends — wie so oft —
unangenehm empfindet.
Bei allem Reichthum des Rankenwerks ist doch die auch bei
solchen schweren Stücken so wichtige Handlichkeit nicht außer Acht
gelassen.
Leider war es nicht möglich, diese Kleinode einheimischen Knnst-
handwerks in München öffentlich auszustellen; nur einem kleinen Kreis
war es vergönnt, dieselben zu sehen. Mit größtem Interesse nahmen
Se. Kgl. Hoheit der Prinzregent Luitpold von Bayern sowie
mehrere andere Mitglieder des königlichen Hauses Einsicht von diesen
Kunstwerken und beglückwünschten den Verfertiger, Rnd. Harrach,
welcher über ein Jahr lang mit zeitweise (8 Gehülfen daran gearbeitet
hatte, zu dem trefflichen Gelingen.
In Leipzig waren die Leuchter einige Tage ausgestellt nnd er-
regten das uneingeschränkteste Staunen der Beschauer und die rückhalts-
loseste Anerkennung seitens des hohen Rathes. Die Leipziger Presse
gab ihrer Bewunderung in den schmeichelhaftesten Worten Ausdruck,
wie „so etwas kann nur in München gemacht werden."
Ehre dem Meister, der dem Münchener Kunsthandwerk in anderen
Städten des Reichs Ehre macht! Ehre aber auch der Stadtbehörde,
welche solche künstlerische Aufträge ertheilt!
Taf. ;s. Schautisch für Münzen. Entworfen von Prof.
A. Ne»Meister, Karlsruhe, ausgeführt von Hofmöbelfabrikant
G. Fritzfche, München. Nach Photographie gezeichnet von Prof.
E. Häberle, Karlsruhe. — Dieser Schautisch wurde für S. Hoheit
den Herzog Georg von Sachsen-Meiningen ausgeführt.
Taf. (7. vordertheil eines Grabgitters. Entworfen und
gezeichnet von Prof. Fr. Brochier (Nürnberg), geschmiedet von Kunst-
schlosser P. Liebig (München). Eine perspektivische Gesammtansicht