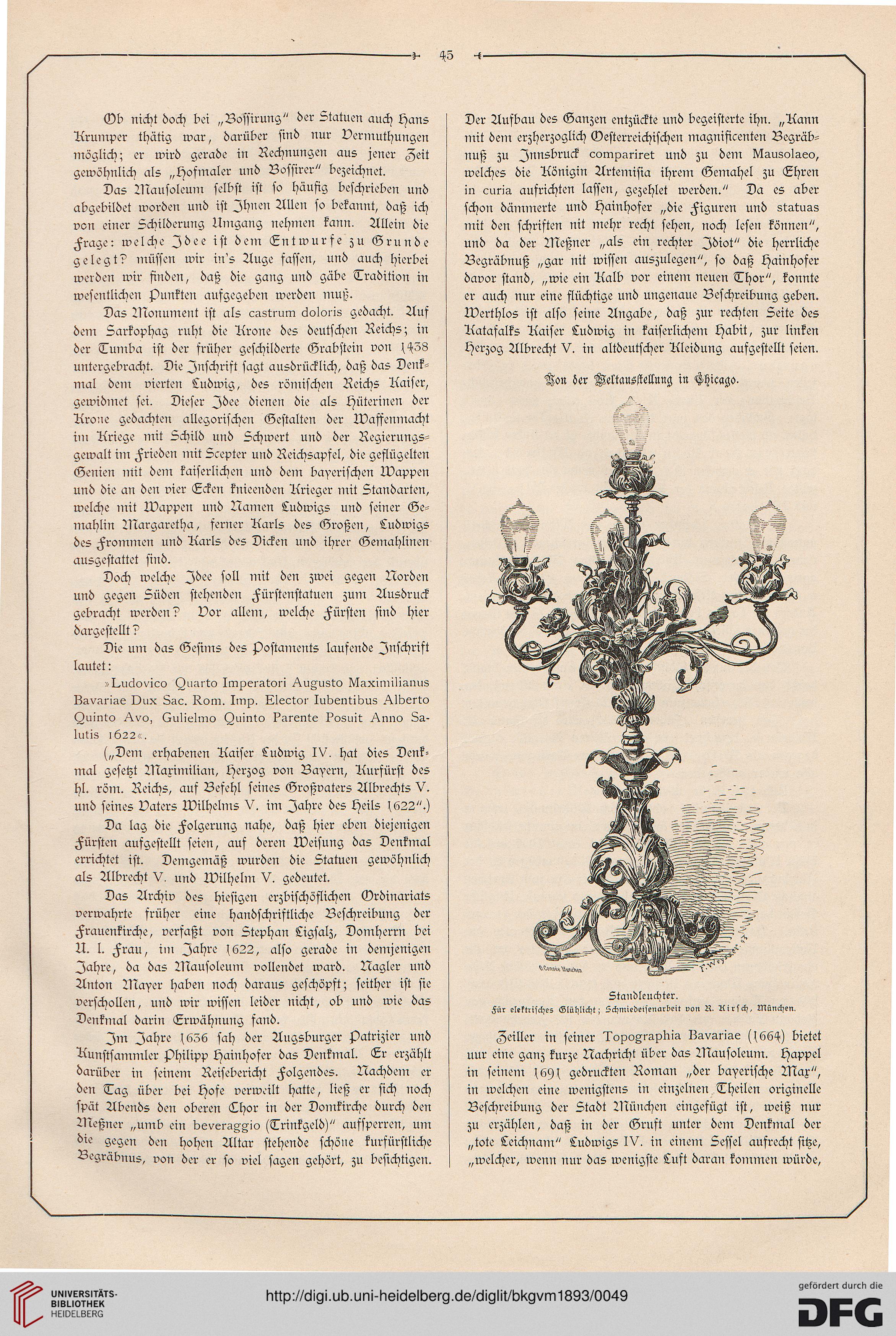(Db nicht doch bei „Bossirung" der Statuen auch pans
Krümper Ihätig war, darüber sind nur Vermuthungen
möglich; er wird gerade in Rechnungen aus jener Aeit
gewöhnlich als „Hofmaler und Bofsirer" bezeichnet.
Das Mausoleum selbst ist so häufig beschrieben und
abgebildet worden und ist sahnen Allen so bekannt, daß ich
von einer Schilderung Umgang nehmen kann. Allein die
Frage: welche Idee ist dem Entwürfe zu Grunde
gelegt? müssen wir in's Auge fassen, und auch hierbei
werden wir finden, daß die gang und gäbe Tradition in
wesentlichen Punkten aufgegeben werden muß.
Das Monument ist als castrum doloris gedacht. Auf
dem Sarkophag ruht die Krone des deutschen Reichs; in
der Tumba ist der früher geschilderte Grabstein von f^38
untergebracht. Die Inschrift sagt ausdrücklich, daß das Denk-
mal dem vierten Ludwig, des römischen Reichs Kaiser,
gewidmet sei. Dieser Idee dienen die als Püterinen der
Krone gedachten allegorischen Gestalten der Waffenmacht
im Kriege mit Schild und Schwert und der Regierungs-
gewalt im Frieden mit Scepter und Reichsapfel, die geflügelten
Genien mit dem kaiserlichen und dem bayerischen Wappen
und die an den vier Ecken knieenden Krieger mit Standarten,
welche mit Wappen und Namen Ludwigs und feiner Ge-
mahlin Margaretha, ferner Karls des Großen, Ludwigs
des Frommen und Karls des Dicken und ihrer Gemahlinen
ausgestattet sind.
Doch welche Idee soll mit den zwei gegen Norden
und gegen Süden stehenden Fürstenstatuen zum Ausdruck
gebracht werden? Nor allem, welche Fürsten sind hier
dargestellt?
Die um das Gesims des Postaments laufende Inschrift
lautet:
»Ludovico Quarto Imperatori Augusto Maximilianus
Bavariae Dux Sac. Rom. Imp. Elector Iubentibus Alberto
Quinto Avo, Gulielmo Quinto Parente Posuit Anno Sa-
lutis 1622«,
(„Dem erhabenen Kaiser Ludwig IV. hat dies Denk-
mal gesetzt Maxintilian, Perzog von Bayern, Kurfürst des
hl. rönt. Reichs, auf Befehl seines Großvaters Albrechts V.
und feines Vaters Wilhelms V. int Jahre des Peils 1622".)
Da lag die Folgerung nahe, daß hier eben diejenigen
Fürsten aufgestellt seien, auf deren Weisung das Denkmal
errichtet ist. Demgemäß wurden die Statuen gewöhnlich
als Albrecht V. und Wilhelm V. gedeutet.
Das Archiv des hiesigen erzbischöflichen Grdinariats
verwahrte früher eine handschriftliche Beschreibung der
Frauenkirche, verfaßt von Stephan Ligsalz, Domherrn bei
U. l. Frau, im Jahre 1622, also gerade in demjenigen
Jahre, da das Mausoleum vollendet ward. Nagler und
Anton Mayer haben noch daraus geschöpft; seither ist sie
verschollen, und wir wissen leider nicht, ob und wie das
Denkmal darin Erwähnung fand.
Im Jahre f636 sah der Augsburger Patrizier und
Kunstsammler Philipp Painhofer das Denkmal. Er erzählt
darüber in seinem Reisebericht Folgendes. Nachdem er
den Tag über bei Pose verweilt hatte, ließ er sich noch
spät Abends den oberen Thor in der Domkirche durch den
Nießner „umb ein beveraggio (Trinkgeld)" aufsperren, um
die gegen den hohen Altar stehende schöne kurfürstliche
Begräbnus, von der er so viel sagen gehört, zu besichtigen.
Der Aufbau des Ganzen entzückte und begeisterte ihn. „Kann
mit dem erzherzoglich Gesterreichifchen magnificenten Begräb-
nuß zu Innsbruck comparii-et und zu dem Mausolaeo,
welches die Königin Artemisia ihrem Gemahel zu Ehren
in curia aufrichten lassen, gezehlet werden." Da es aber
fchoir dämmerte und Painhofer „die Figuren und skatuas
mit den fchriften nit mehr recht sehen, noch leseir können",
und da der Meßner „als ein rechter Idiot" die herrliche
Begräbnuß „gar nit wissen auszulegen", so daß Painhofer
davor stand, „wie ein Kalb vor einem neuen Thor", konnte
er auch nur eine flüchtige und ungenaue Beschreibung geben.
Werthlos ist also seine Angabe, daß zur rechten Seite des
Katafalks Kaiser Ludwig in kaiserlichem Pabit, zur lnrken
Perzog Albrecht V. in altdeutscher Kleidung aufgestellt seien.
Jsii 6er Keltausstelluirg in chhicago.
Stcmdlcuchter.
Für elektrisches Glühiicht; Schmiedeise,rarbeit von H. Airsch, München.
Zeiller in seiner Topographia Bavariae (f66^) bietet
uur eine ganz kurze Nachricht über das Mausoleum. Pappel
in seinem lbstf gedruckten Roman „der bayerische Nlax",
in welchen eine wenigstens in einzelnen Theilen originelle
Beschreibung der Stadt München eingefügt ist, weiß nur
zu erzählen, daß in der Gruft unter dem Denkmal der
„tote Leichnam" Ludwigs IV. in einem Sessel aufrecht sitze,
„welcher, wenn nur das wenigste Luft daran kommen würde,
Krümper Ihätig war, darüber sind nur Vermuthungen
möglich; er wird gerade in Rechnungen aus jener Aeit
gewöhnlich als „Hofmaler und Bofsirer" bezeichnet.
Das Mausoleum selbst ist so häufig beschrieben und
abgebildet worden und ist sahnen Allen so bekannt, daß ich
von einer Schilderung Umgang nehmen kann. Allein die
Frage: welche Idee ist dem Entwürfe zu Grunde
gelegt? müssen wir in's Auge fassen, und auch hierbei
werden wir finden, daß die gang und gäbe Tradition in
wesentlichen Punkten aufgegeben werden muß.
Das Monument ist als castrum doloris gedacht. Auf
dem Sarkophag ruht die Krone des deutschen Reichs; in
der Tumba ist der früher geschilderte Grabstein von f^38
untergebracht. Die Inschrift sagt ausdrücklich, daß das Denk-
mal dem vierten Ludwig, des römischen Reichs Kaiser,
gewidmet sei. Dieser Idee dienen die als Püterinen der
Krone gedachten allegorischen Gestalten der Waffenmacht
im Kriege mit Schild und Schwert und der Regierungs-
gewalt im Frieden mit Scepter und Reichsapfel, die geflügelten
Genien mit dem kaiserlichen und dem bayerischen Wappen
und die an den vier Ecken knieenden Krieger mit Standarten,
welche mit Wappen und Namen Ludwigs und feiner Ge-
mahlin Margaretha, ferner Karls des Großen, Ludwigs
des Frommen und Karls des Dicken und ihrer Gemahlinen
ausgestattet sind.
Doch welche Idee soll mit den zwei gegen Norden
und gegen Süden stehenden Fürstenstatuen zum Ausdruck
gebracht werden? Nor allem, welche Fürsten sind hier
dargestellt?
Die um das Gesims des Postaments laufende Inschrift
lautet:
»Ludovico Quarto Imperatori Augusto Maximilianus
Bavariae Dux Sac. Rom. Imp. Elector Iubentibus Alberto
Quinto Avo, Gulielmo Quinto Parente Posuit Anno Sa-
lutis 1622«,
(„Dem erhabenen Kaiser Ludwig IV. hat dies Denk-
mal gesetzt Maxintilian, Perzog von Bayern, Kurfürst des
hl. rönt. Reichs, auf Befehl seines Großvaters Albrechts V.
und feines Vaters Wilhelms V. int Jahre des Peils 1622".)
Da lag die Folgerung nahe, daß hier eben diejenigen
Fürsten aufgestellt seien, auf deren Weisung das Denkmal
errichtet ist. Demgemäß wurden die Statuen gewöhnlich
als Albrecht V. und Wilhelm V. gedeutet.
Das Archiv des hiesigen erzbischöflichen Grdinariats
verwahrte früher eine handschriftliche Beschreibung der
Frauenkirche, verfaßt von Stephan Ligsalz, Domherrn bei
U. l. Frau, im Jahre 1622, also gerade in demjenigen
Jahre, da das Mausoleum vollendet ward. Nagler und
Anton Mayer haben noch daraus geschöpft; seither ist sie
verschollen, und wir wissen leider nicht, ob und wie das
Denkmal darin Erwähnung fand.
Im Jahre f636 sah der Augsburger Patrizier und
Kunstsammler Philipp Painhofer das Denkmal. Er erzählt
darüber in seinem Reisebericht Folgendes. Nachdem er
den Tag über bei Pose verweilt hatte, ließ er sich noch
spät Abends den oberen Thor in der Domkirche durch den
Nießner „umb ein beveraggio (Trinkgeld)" aufsperren, um
die gegen den hohen Altar stehende schöne kurfürstliche
Begräbnus, von der er so viel sagen gehört, zu besichtigen.
Der Aufbau des Ganzen entzückte und begeisterte ihn. „Kann
mit dem erzherzoglich Gesterreichifchen magnificenten Begräb-
nuß zu Innsbruck comparii-et und zu dem Mausolaeo,
welches die Königin Artemisia ihrem Gemahel zu Ehren
in curia aufrichten lassen, gezehlet werden." Da es aber
fchoir dämmerte und Painhofer „die Figuren und skatuas
mit den fchriften nit mehr recht sehen, noch leseir können",
und da der Meßner „als ein rechter Idiot" die herrliche
Begräbnuß „gar nit wissen auszulegen", so daß Painhofer
davor stand, „wie ein Kalb vor einem neuen Thor", konnte
er auch nur eine flüchtige und ungenaue Beschreibung geben.
Werthlos ist also seine Angabe, daß zur rechten Seite des
Katafalks Kaiser Ludwig in kaiserlichem Pabit, zur lnrken
Perzog Albrecht V. in altdeutscher Kleidung aufgestellt seien.
Jsii 6er Keltausstelluirg in chhicago.
Stcmdlcuchter.
Für elektrisches Glühiicht; Schmiedeise,rarbeit von H. Airsch, München.
Zeiller in seiner Topographia Bavariae (f66^) bietet
uur eine ganz kurze Nachricht über das Mausoleum. Pappel
in seinem lbstf gedruckten Roman „der bayerische Nlax",
in welchen eine wenigstens in einzelnen Theilen originelle
Beschreibung der Stadt München eingefügt ist, weiß nur
zu erzählen, daß in der Gruft unter dem Denkmal der
„tote Leichnam" Ludwigs IV. in einem Sessel aufrecht sitze,
„welcher, wenn nur das wenigste Luft daran kommen würde,