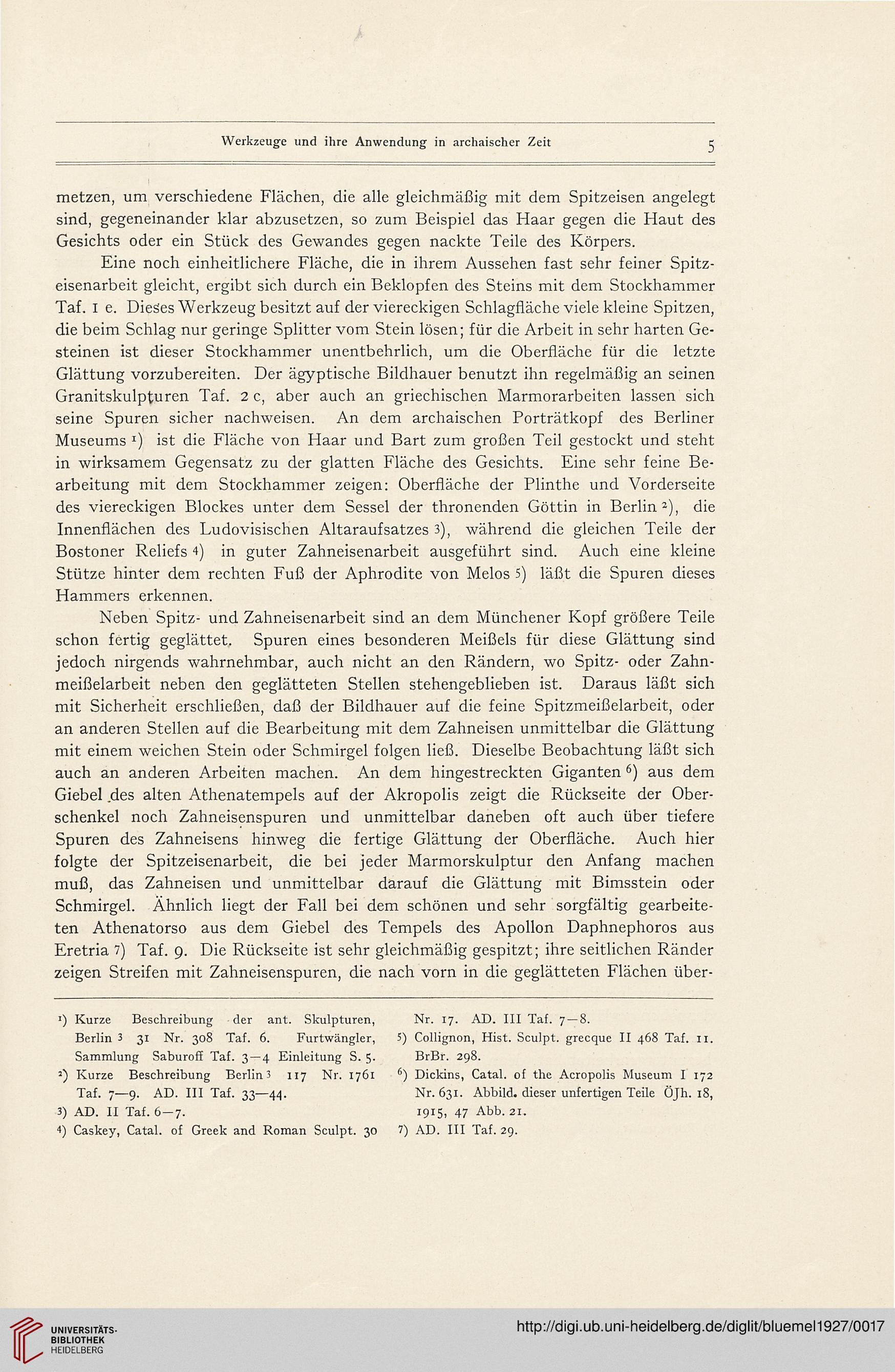Werkzeuge und ihre Anwendung in archaischer Zeit
metzen, um verschiedene Flächen, die alle gleichmäßig mit dem Spitzeisen angelegt
sind, gegeneinander klar abzusetzen, so zum Beispiel das Haar gegen die Haut des
Gesichts oder ein Stück des Gewandes gegen nackte Teile des Körpers.
Eine noch einheitlichere Fläche, die in ihrem Aussehen fast sehr feiner Spitz-
eisenarbeit gleicht, ergibt sich durch ein Beklopfen des Steins mit dem Stockhammer
Taf. i e. Dieses Werkzeug besitzt auf der viereckigen Schlagfläche viele kleine Spitzen,
die beim Schlag nur geringe Splitter vom Stein lösen; für die Arbeit in sehr harten Ge-
steinen ist dieser Stockhammer unentbehrlich, um die Oberfläche für die letzte
Glättung vorzubereiten. Der ägyptische Bildhauer benutzt ihn regelmäßig an seinen
Granitskulpturen Taf. 2 c, aber auch an griechischen Marmorarbeiten lassen sich
seine Spuren sicher nachweisen. An dem archaischen Porträtkopf des Berliner
Museums *) ist die Fläche von Haar und Bart zum großen Teil gestockt und steht
in wirksamem Gegensatz zu der glatten Fläche des Gesichts. Eine sehr feine Be-
arbeitung mit dem Stockhammer zeigen: Oberfläche der Plinthe und Vorderseite
des viereckigen Blockes unter dem Sessel der thronenden Göttin in Berlin2), die
Innenflächen des Ludovisischen Altaraufsatzes 3), während die gleichen Teile der
Bostoner Reliefs 4) in guter Zahneisenarbeit ausgeführt sind. Auch eine kleine
Stütze hinter dem rechten Fuß der Aphrodite von Melos 5) läßt die Spuren dieses
Hammers erkennen.
Neben Spitz- und Zahneisenarbeit sind an dem Münchener Kopf größere Teile
schon fertig geglättet. Spuren eines besonderen Meißels für diese Glättung sind
jedoch nirgends wahrnehmbar, auch nicht an den Rändern, wo Spitz- oder Zahn-
meißelarbeit neben den geglätteten Stellen stehengeblieben ist. Daraus läßt sich
mit Sicherheit erschließen, daß der Bildhauer auf die feine Spitzmeißelarbeit, oder
an anderen Stellen auf die Bearbeitung mit dem Zahneisen unmittelbar die Glättung
mit einem weichen Stein oder Schmirgel folgen ließ. Dieselbe Beobachtung läßt sich
auch an anderen Arbeiten machen. An dem hingestreckten Giganten 6) aus dem
Giebel des alten Athenatempels auf der Akropolis zeigt die Rückseite der Ober-
schenkel noch Zahneisenspuren und unmittelbar daneben oft auch über tiefere
Spuren des Zahneisens hinweg die fertige Glättung der Oberfläche. Auch hier
folgte der Spitzeisenarbeit, die bei jeder Marmorskulptur den Anfang machen
muß, das Zahneisen und unmittelbar darauf die Glättung mit Bimsstein oder
Schmirgel. Ähnlich liegt der Fall bei dem schönen und sehr sorgfältig gearbeite-
ten Athenatorso aus dem Giebel des Tempels des Apollon Daphnephoros aus
Eretria 7) Taf. 9. Die Rückseite ist sehr gleichmäßig gespitzt; ihre seitlichen Ränder
zeigen Streifen mit Zahneisenspuren, die nach vorn in die geglätteten Flächen über-
■) Kurze Beschreibung der ant. Skulpturen,
Berlin 3 31 Nr. 308 Taf. 6. Furtwängler,
Sammlung Saburoff Taf. 3—4 Einleitung S. 5.
2) Kurze Beschreibung Berlin 3 117 Nr. 1761
Taf. 7—9. AD. III Taf. 33—44.
3) AD. II Taf. 6-7.
4) Caskey, Catal. of Greek and Roman Sculpt. 30
Nr. 17. AD. III Taf. 7-8.
5) Collignon, Hist. Sculpt. grecque II 468 Taf. 11.
BrBr. 298.
6) Dickins, Catal. of the Acropolis Museum I 172
Nr. 631. Abbild, dieser unfertigen Teile ÖJh. 18,
191:5, 47 Abb. 21.
7) AD. III Taf. 29.
metzen, um verschiedene Flächen, die alle gleichmäßig mit dem Spitzeisen angelegt
sind, gegeneinander klar abzusetzen, so zum Beispiel das Haar gegen die Haut des
Gesichts oder ein Stück des Gewandes gegen nackte Teile des Körpers.
Eine noch einheitlichere Fläche, die in ihrem Aussehen fast sehr feiner Spitz-
eisenarbeit gleicht, ergibt sich durch ein Beklopfen des Steins mit dem Stockhammer
Taf. i e. Dieses Werkzeug besitzt auf der viereckigen Schlagfläche viele kleine Spitzen,
die beim Schlag nur geringe Splitter vom Stein lösen; für die Arbeit in sehr harten Ge-
steinen ist dieser Stockhammer unentbehrlich, um die Oberfläche für die letzte
Glättung vorzubereiten. Der ägyptische Bildhauer benutzt ihn regelmäßig an seinen
Granitskulpturen Taf. 2 c, aber auch an griechischen Marmorarbeiten lassen sich
seine Spuren sicher nachweisen. An dem archaischen Porträtkopf des Berliner
Museums *) ist die Fläche von Haar und Bart zum großen Teil gestockt und steht
in wirksamem Gegensatz zu der glatten Fläche des Gesichts. Eine sehr feine Be-
arbeitung mit dem Stockhammer zeigen: Oberfläche der Plinthe und Vorderseite
des viereckigen Blockes unter dem Sessel der thronenden Göttin in Berlin2), die
Innenflächen des Ludovisischen Altaraufsatzes 3), während die gleichen Teile der
Bostoner Reliefs 4) in guter Zahneisenarbeit ausgeführt sind. Auch eine kleine
Stütze hinter dem rechten Fuß der Aphrodite von Melos 5) läßt die Spuren dieses
Hammers erkennen.
Neben Spitz- und Zahneisenarbeit sind an dem Münchener Kopf größere Teile
schon fertig geglättet. Spuren eines besonderen Meißels für diese Glättung sind
jedoch nirgends wahrnehmbar, auch nicht an den Rändern, wo Spitz- oder Zahn-
meißelarbeit neben den geglätteten Stellen stehengeblieben ist. Daraus läßt sich
mit Sicherheit erschließen, daß der Bildhauer auf die feine Spitzmeißelarbeit, oder
an anderen Stellen auf die Bearbeitung mit dem Zahneisen unmittelbar die Glättung
mit einem weichen Stein oder Schmirgel folgen ließ. Dieselbe Beobachtung läßt sich
auch an anderen Arbeiten machen. An dem hingestreckten Giganten 6) aus dem
Giebel des alten Athenatempels auf der Akropolis zeigt die Rückseite der Ober-
schenkel noch Zahneisenspuren und unmittelbar daneben oft auch über tiefere
Spuren des Zahneisens hinweg die fertige Glättung der Oberfläche. Auch hier
folgte der Spitzeisenarbeit, die bei jeder Marmorskulptur den Anfang machen
muß, das Zahneisen und unmittelbar darauf die Glättung mit Bimsstein oder
Schmirgel. Ähnlich liegt der Fall bei dem schönen und sehr sorgfältig gearbeite-
ten Athenatorso aus dem Giebel des Tempels des Apollon Daphnephoros aus
Eretria 7) Taf. 9. Die Rückseite ist sehr gleichmäßig gespitzt; ihre seitlichen Ränder
zeigen Streifen mit Zahneisenspuren, die nach vorn in die geglätteten Flächen über-
■) Kurze Beschreibung der ant. Skulpturen,
Berlin 3 31 Nr. 308 Taf. 6. Furtwängler,
Sammlung Saburoff Taf. 3—4 Einleitung S. 5.
2) Kurze Beschreibung Berlin 3 117 Nr. 1761
Taf. 7—9. AD. III Taf. 33—44.
3) AD. II Taf. 6-7.
4) Caskey, Catal. of Greek and Roman Sculpt. 30
Nr. 17. AD. III Taf. 7-8.
5) Collignon, Hist. Sculpt. grecque II 468 Taf. 11.
BrBr. 298.
6) Dickins, Catal. of the Acropolis Museum I 172
Nr. 631. Abbild, dieser unfertigen Teile ÖJh. 18,
191:5, 47 Abb. 21.
7) AD. III Taf. 29.