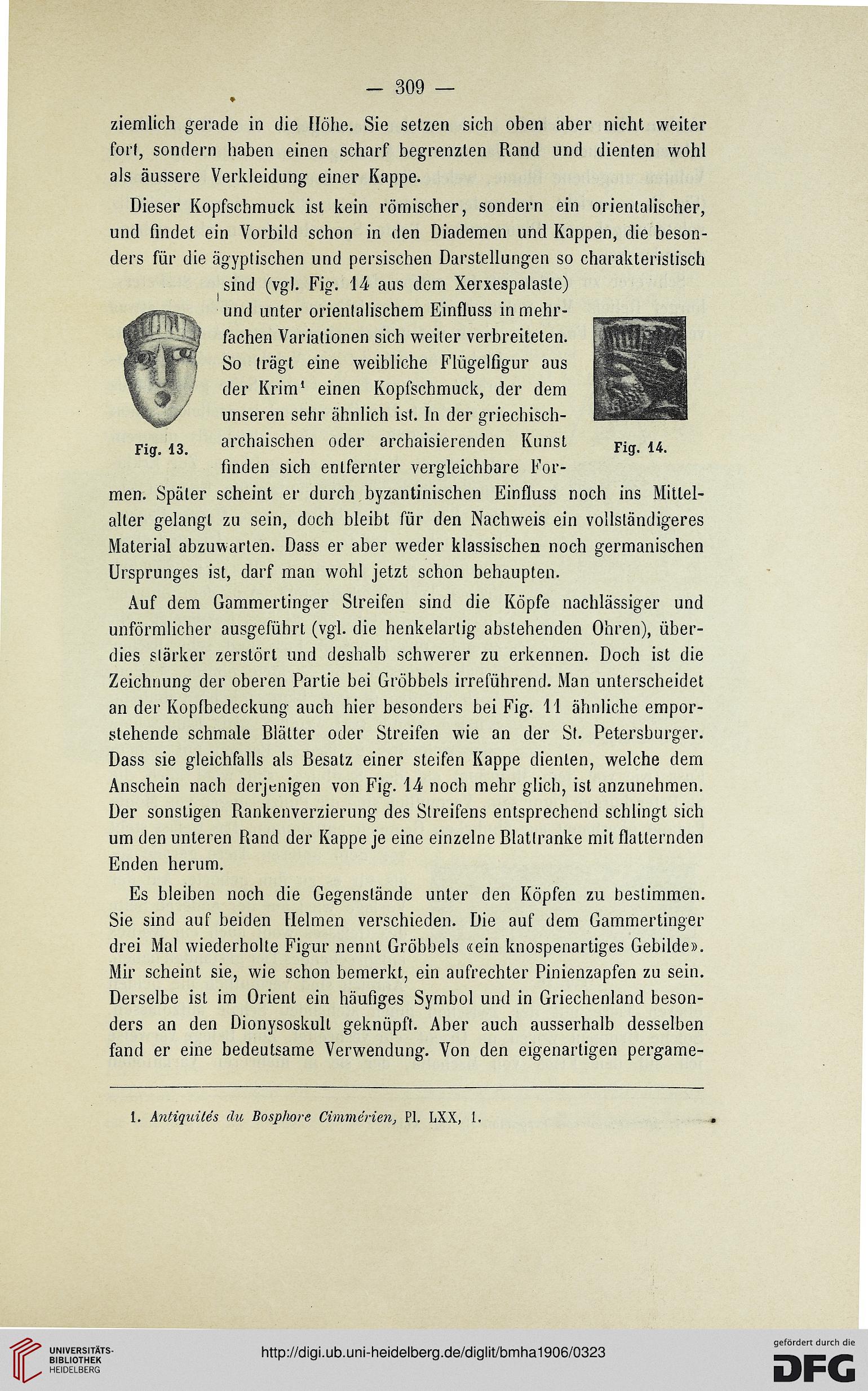- 309 —
Fig. 13.
Fig. 14.
ziemlich gerade in die Ilôhe. Sie setzen sich oben aber nicht weiter
fort, sondern haben einen scharf begrenzlen Rand und dienten wohl
als àussere Verkleidung einer Kappe.
Dieser Kopfscbmuck ist kein rômischer, sondern ein orientalischer,
und frndet ein Vorbild schon in den Diademen und Kappen, die beson-
ders für die âgyptischen und persischen Darstellungen so charakterislisch
sind (vg). Fig. 14 aus dem Xerxespalasle)
und tinter orientalischem Einfluss in mehr-
fachen Varialionen sich weiter verbreiteten.
So trâgt eine weibliche Flügelfigur aus
der Krim1 einen Kopfschmuck, der dem
unseren sehr ahnlich ist. In der griechisch-
archaischen oder archaisierenden Kunst
finden sich enlfernter vergleichbare For-
men. Spiiler scheint er durch byzantinischen Einfluss noch ins Mittel-
alter gelangl zu sein, doch bleibt für den Nachweis ein vollstëndigeres
Material abzuwarten. Dass er aber weder klassischen noch germanischen
Ursprunges ist, darf man wohl jetzt schon behaupten.
Auf dem Gammertinger Streifen sind die Kôpfe nachlâssiger und
unfôrmlicher ausgeführt (vgl. die henkelarlig abslehenden Ohren), über-
dies slarker zerstôrt und desbalb schwerer zu erkennen. Doch ist die
Zeichnung der oberen Partie bei Grobbels irreführend. Man unterscheidet
an der Kopfbedeckung auch hier besonders bei Fig. 11 ahnliche empor-
stehende schmale Blatter oder Streifen wie an der St. Petersburger.
Dass sie gleichfalls als Besatz einer steifen Kappe dienten, welche dem
Anschein nach derjenigen von Fig. 14 noch mehr glich, ist anzunehmen.
Der sonstigen Rankenverzierung des Streifens entsprechend schlingt sich
um den unteren Rand der Kappe je eine einzelne Blattranke mit flatlernden
Enden herum.
Es bleiben noch die Gegenstande unter den Kôpfen zu bestimmen.
Sie sind auf beiden Helmen verschieden. Die auf dem Gammertinger
drei Mal wiederholte Figur nennt Grobbels «ein knospenartiges Gebilde».
Mir scheint sie, wie schon bemerkt, ein aufrechter Pinienzapfen zu sein.
Derselbe ist im Orient ein haufiges Symbol und in Griechenland beson-
ders an den Dionysoskult geknüpft. Aber auch ausserhalb desselben
fand er eine bedeutsame Verwendung. Von den eigenartigen pergame-
1. Antiquités du Bosphore Cimmérien} PL LXX, 1.
Fig. 13.
Fig. 14.
ziemlich gerade in die Ilôhe. Sie setzen sich oben aber nicht weiter
fort, sondern haben einen scharf begrenzlen Rand und dienten wohl
als àussere Verkleidung einer Kappe.
Dieser Kopfscbmuck ist kein rômischer, sondern ein orientalischer,
und frndet ein Vorbild schon in den Diademen und Kappen, die beson-
ders für die âgyptischen und persischen Darstellungen so charakterislisch
sind (vg). Fig. 14 aus dem Xerxespalasle)
und tinter orientalischem Einfluss in mehr-
fachen Varialionen sich weiter verbreiteten.
So trâgt eine weibliche Flügelfigur aus
der Krim1 einen Kopfschmuck, der dem
unseren sehr ahnlich ist. In der griechisch-
archaischen oder archaisierenden Kunst
finden sich enlfernter vergleichbare For-
men. Spiiler scheint er durch byzantinischen Einfluss noch ins Mittel-
alter gelangl zu sein, doch bleibt für den Nachweis ein vollstëndigeres
Material abzuwarten. Dass er aber weder klassischen noch germanischen
Ursprunges ist, darf man wohl jetzt schon behaupten.
Auf dem Gammertinger Streifen sind die Kôpfe nachlâssiger und
unfôrmlicher ausgeführt (vgl. die henkelarlig abslehenden Ohren), über-
dies slarker zerstôrt und desbalb schwerer zu erkennen. Doch ist die
Zeichnung der oberen Partie bei Grobbels irreführend. Man unterscheidet
an der Kopfbedeckung auch hier besonders bei Fig. 11 ahnliche empor-
stehende schmale Blatter oder Streifen wie an der St. Petersburger.
Dass sie gleichfalls als Besatz einer steifen Kappe dienten, welche dem
Anschein nach derjenigen von Fig. 14 noch mehr glich, ist anzunehmen.
Der sonstigen Rankenverzierung des Streifens entsprechend schlingt sich
um den unteren Rand der Kappe je eine einzelne Blattranke mit flatlernden
Enden herum.
Es bleiben noch die Gegenstande unter den Kôpfen zu bestimmen.
Sie sind auf beiden Helmen verschieden. Die auf dem Gammertinger
drei Mal wiederholte Figur nennt Grobbels «ein knospenartiges Gebilde».
Mir scheint sie, wie schon bemerkt, ein aufrechter Pinienzapfen zu sein.
Derselbe ist im Orient ein haufiges Symbol und in Griechenland beson-
ders an den Dionysoskult geknüpft. Aber auch ausserhalb desselben
fand er eine bedeutsame Verwendung. Von den eigenartigen pergame-
1. Antiquités du Bosphore Cimmérien} PL LXX, 1.