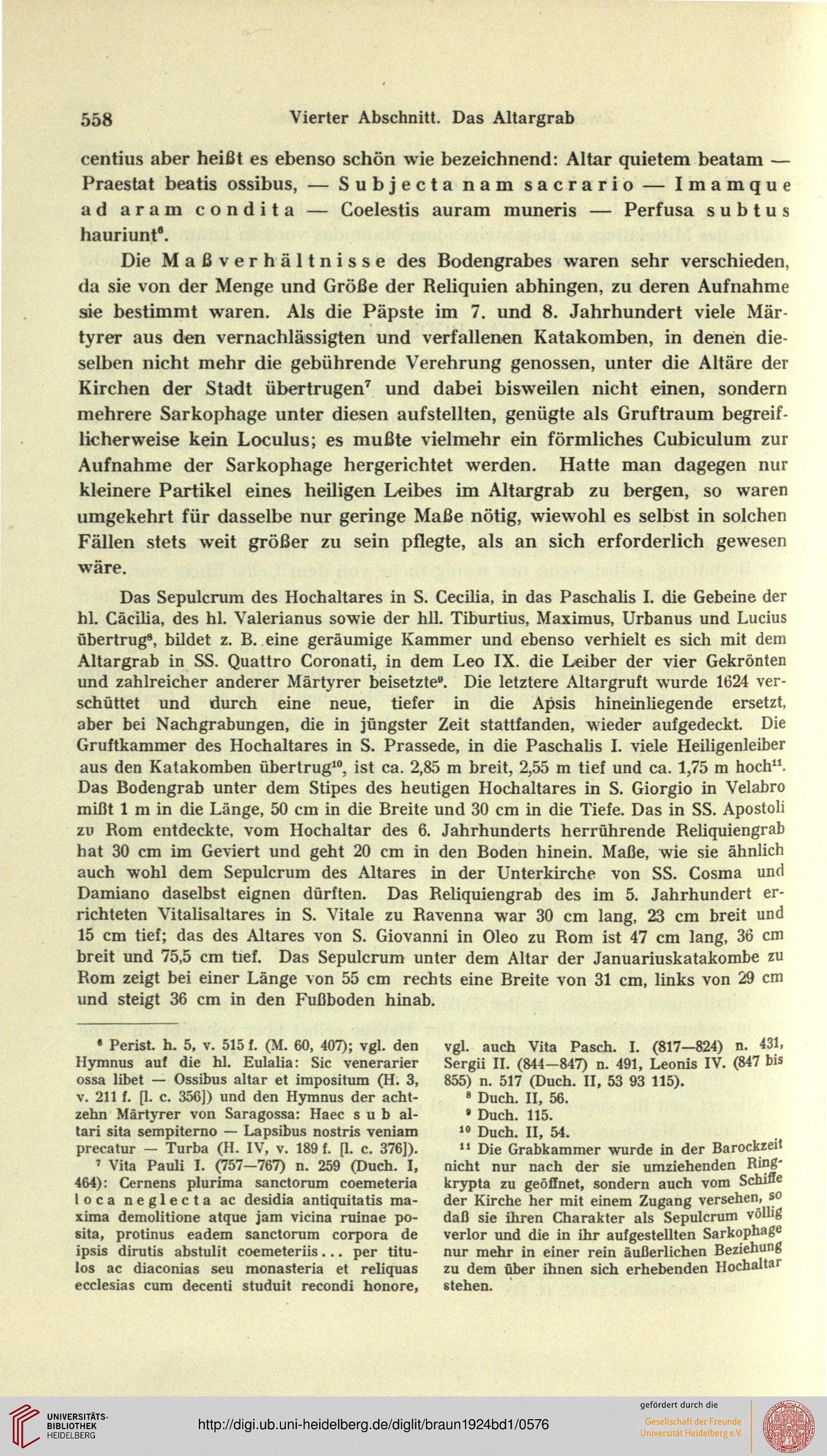558 Vierter Abschnitt. Das Altargrab
centius aber heißt es ebenso schön wie bezeichnend: Altar quietem beatam —
Praestat beatis ossibus, — Subjecta nam sacrario — Imamque
ad aram condita — Coelestis auram muneris — Perfusa s u b t u s
hauriunt*.
Die Maßverhältnisse des Bodengrabes waren sehr verschieden,
da sie von der Menge und Größe der Reliquien abhingen, zu deren Aufnahme
sie bestimmt waren. Als die Päpste im 7. und 8. Jahrhundert viele Mär-
tyrer aus den vernachlässigten und verfallenen Katakomben, in denen die-
selben nicht mehr die gebührende Verehrung genossen, unter die Altäre der
Kirchen der Stadt übertrugen7 und dabei bisweilen nicht einen, sondern
mehrere Sarkophage unter diesen aufstellten, genügte als Gruftraum begreif-
licherweise kein Loculus; es mußte vielmehr ein förmliches Cubiculum zur
Aufnahme der Sarkophage hergerichtet werden. Hatte man dagegen nur
kleinere Partikel eines heiligen Leibes im Altargrab zu bergen, so waren
umgekehrt für dasselbe nur geringe Maße nötig, wiewohl es selbst in solchen
Fällen stets weit größer zu sein pflegte, als an sich erforderlich gewesen
wäre.
Das Sepulcrum des Hochaltares in S. Cecilia, in das Paschalis I. die Gebeine der
hl. Cäcilia, des hl. Valerianus sowie der hll. Tiburtius, Maximus, Urbanus und Lucius
übertrug8, bildet z. B. eine geräumige Kammer und ebenso verhielt es sich mit dem
Altargrab in SS. Quattro Coronati, in dem Leo IX. die Leiber der vier Gekrönten
und zahlreicher anderer Märtyrer beisetzte". Die letztere Altargruft wurde 1624 ver-
schüttet und durch eine neue, tiefer in die Apsis hineinliegende ersetzt,
aber bei Nachgrabungen, die in jüngster Zeit stattfanden, wieder aufgedeckt. Die
Gruftkammer des Hochaltares in S. Prassede, in die Paschabs I. viele Heiligenleiber
aus den Katakomben übertrug10, ist ca. 2,85 m breit, 2,55 m tief und ca. 1,75 m hoch11.
Das Bodengrab unter dem Stipes des heutigen Hochaltares in S. Giorgio in Velabro
mißt 1 m in die Länge, 50 cm in die Breite und 30 cm in die Tiefe. Das in SS. Apostoli
zu Rom entdeckte, vom Hochaltar des 6. Jahrhunderts herrührende Reliquiengrab
hat 30 cm im Geviert und geht 20 cm in den Boden hinein. Maße, wie sie ähnlich
auch wohl dem Sepulcrum des Altares in der Unterkirche von SS. Cosma und
Damiano daselbst eignen dürften. Das Reliquiengrab des im 5. Jahrhundert er-
richteten Vitalisaltares in S. Vitale zu Ravenna war 30 cm lang, 23 cm breit und
15 cm tief; das des Altares von S. Giovanni in Oleo zu Rom ist 47 cm lang, 36 cm
breit und 75,5 cm tief. Das Sepulcrum unter dem Altar der Januariuskatakombe zu
Born zeigt bei einer Länge von 55 cm rechts eine Breite von 31 cm, links von 29 cm
und steigt 36 cm in den Fußboden hinab.
• Perist. h. 5, v. 515 f. (M. 60, 407); vgl. den vgl. auch Vita Pasch. I. (817—824) n. 431,
Hymnus auf die hl. Eulalia: Sic venerarier Sergii II. (844—847) n. 491, Leonis IV. (847 bis
ossa libet — Ossibus altar et impositum (H. 3, 855) n. 517 (Duch. II, 53 93 115).
v. 211 f. [1. c. 356]) und den Hymnus der acht- 8 Duch. II, 56.
zehn Märtyrer von Saragossa: Haec s u b al- ' Duch. 115.
tari sita sempiterno — Lapsibus nostris veniam 10 Duch. II, 54.
precatur — Turba (H. IV, v. 189 f. [1. c. 376]). «' Die Grabkammer wurde in der Barockzeit
' Vita Pauli I. (757—767) n. 259 (Duch. I, nicht nur nach der sie umziehenden Ring'
464): Cernens plurima sanctorum coemeteria krypta zu geöffnet, sondern auch vom Schiffe
loca neglecta ac desidia antiquitatis ma- der Kirche her mit einem Zugang versehen, so
xima demolitione atque jam vicina ruinae po- daß sie ihren Charakter als Sepulcrum völlig
sita, protinus eadem sanctorum corpora de verlor und die in ihr aufgestellten Sarkophage
ipsis dirutis abstulit coemeterüs... per titu- nur mehr in einer rein äußerlichen Beziehung
los ac diaconias seu monasteria et reliquas zu dem über ihnen sich erhebenden Hochalta
ecclesias cum decenti studuit recondi honore, stehen.
centius aber heißt es ebenso schön wie bezeichnend: Altar quietem beatam —
Praestat beatis ossibus, — Subjecta nam sacrario — Imamque
ad aram condita — Coelestis auram muneris — Perfusa s u b t u s
hauriunt*.
Die Maßverhältnisse des Bodengrabes waren sehr verschieden,
da sie von der Menge und Größe der Reliquien abhingen, zu deren Aufnahme
sie bestimmt waren. Als die Päpste im 7. und 8. Jahrhundert viele Mär-
tyrer aus den vernachlässigten und verfallenen Katakomben, in denen die-
selben nicht mehr die gebührende Verehrung genossen, unter die Altäre der
Kirchen der Stadt übertrugen7 und dabei bisweilen nicht einen, sondern
mehrere Sarkophage unter diesen aufstellten, genügte als Gruftraum begreif-
licherweise kein Loculus; es mußte vielmehr ein förmliches Cubiculum zur
Aufnahme der Sarkophage hergerichtet werden. Hatte man dagegen nur
kleinere Partikel eines heiligen Leibes im Altargrab zu bergen, so waren
umgekehrt für dasselbe nur geringe Maße nötig, wiewohl es selbst in solchen
Fällen stets weit größer zu sein pflegte, als an sich erforderlich gewesen
wäre.
Das Sepulcrum des Hochaltares in S. Cecilia, in das Paschalis I. die Gebeine der
hl. Cäcilia, des hl. Valerianus sowie der hll. Tiburtius, Maximus, Urbanus und Lucius
übertrug8, bildet z. B. eine geräumige Kammer und ebenso verhielt es sich mit dem
Altargrab in SS. Quattro Coronati, in dem Leo IX. die Leiber der vier Gekrönten
und zahlreicher anderer Märtyrer beisetzte". Die letztere Altargruft wurde 1624 ver-
schüttet und durch eine neue, tiefer in die Apsis hineinliegende ersetzt,
aber bei Nachgrabungen, die in jüngster Zeit stattfanden, wieder aufgedeckt. Die
Gruftkammer des Hochaltares in S. Prassede, in die Paschabs I. viele Heiligenleiber
aus den Katakomben übertrug10, ist ca. 2,85 m breit, 2,55 m tief und ca. 1,75 m hoch11.
Das Bodengrab unter dem Stipes des heutigen Hochaltares in S. Giorgio in Velabro
mißt 1 m in die Länge, 50 cm in die Breite und 30 cm in die Tiefe. Das in SS. Apostoli
zu Rom entdeckte, vom Hochaltar des 6. Jahrhunderts herrührende Reliquiengrab
hat 30 cm im Geviert und geht 20 cm in den Boden hinein. Maße, wie sie ähnlich
auch wohl dem Sepulcrum des Altares in der Unterkirche von SS. Cosma und
Damiano daselbst eignen dürften. Das Reliquiengrab des im 5. Jahrhundert er-
richteten Vitalisaltares in S. Vitale zu Ravenna war 30 cm lang, 23 cm breit und
15 cm tief; das des Altares von S. Giovanni in Oleo zu Rom ist 47 cm lang, 36 cm
breit und 75,5 cm tief. Das Sepulcrum unter dem Altar der Januariuskatakombe zu
Born zeigt bei einer Länge von 55 cm rechts eine Breite von 31 cm, links von 29 cm
und steigt 36 cm in den Fußboden hinab.
• Perist. h. 5, v. 515 f. (M. 60, 407); vgl. den vgl. auch Vita Pasch. I. (817—824) n. 431,
Hymnus auf die hl. Eulalia: Sic venerarier Sergii II. (844—847) n. 491, Leonis IV. (847 bis
ossa libet — Ossibus altar et impositum (H. 3, 855) n. 517 (Duch. II, 53 93 115).
v. 211 f. [1. c. 356]) und den Hymnus der acht- 8 Duch. II, 56.
zehn Märtyrer von Saragossa: Haec s u b al- ' Duch. 115.
tari sita sempiterno — Lapsibus nostris veniam 10 Duch. II, 54.
precatur — Turba (H. IV, v. 189 f. [1. c. 376]). «' Die Grabkammer wurde in der Barockzeit
' Vita Pauli I. (757—767) n. 259 (Duch. I, nicht nur nach der sie umziehenden Ring'
464): Cernens plurima sanctorum coemeteria krypta zu geöffnet, sondern auch vom Schiffe
loca neglecta ac desidia antiquitatis ma- der Kirche her mit einem Zugang versehen, so
xima demolitione atque jam vicina ruinae po- daß sie ihren Charakter als Sepulcrum völlig
sita, protinus eadem sanctorum corpora de verlor und die in ihr aufgestellten Sarkophage
ipsis dirutis abstulit coemeterüs... per titu- nur mehr in einer rein äußerlichen Beziehung
los ac diaconias seu monasteria et reliquas zu dem über ihnen sich erhebenden Hochalta
ecclesias cum decenti studuit recondi honore, stehen.