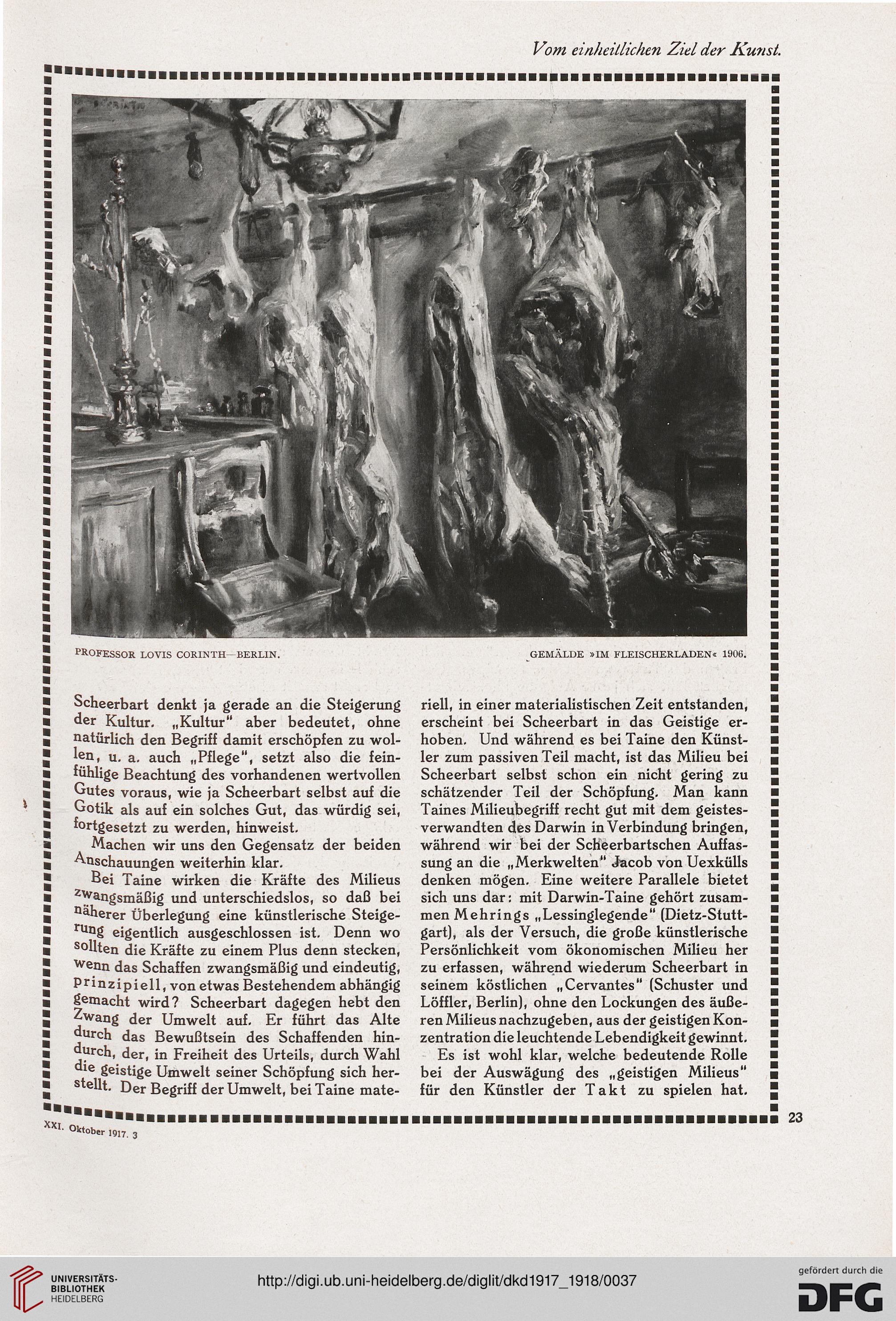Vom einheitlichen Ziel der Kunst.
PROFESSOR LOVIS CORINTH - BERLIN.
GEMÄLDE »IM FLEISCHERLADEN« 1906.
Scheerbart denkt ja gerade an die Steigerung
der Kultur. „Kultur" aber bedeutet, ohne
natürlich den Begriff damit erschöpfen zu wol-
len, u. a. auch „Pflege", setzt also die fein-
fühlige Beachtung des vorhandenen wertvollen
Gutes voraus, wie ja Scheerbart selbst auf die
Gotik als auf ein solches Gut, das würdig sei,
fortgesetzt zu werden, hinweist.
Machen wir uns den Gegensatz der beiden
Anschauungen weiterhin klar.
Bei Taine wirken die Kräfte des Milieus
zWangsmäßig und unterschiedslos, so daß bei
°äherer Überlegung eine künstlerische Steige-
rung eigentlich ausgeschlossen ist. Denn wo
sollten die Kräfte zu einem Plus denn stecken,
wenn das Schaffen zwangsmäßig und eindeutig,
Prinzipiell, von etwas Bestehendem abhängig
gemacht wird? Scheerbart dagegen hebt den
Zwang der Umwelt auf. Er führt das Alte
durch das Bewußtsein des Schaffenden hin-
durch, der, in Freiheit des Urteils, durch Wahl
aie geistige Umwelt seiner Schöpfung sich her-
stellt. Der Begriff der Umwelt, bei Taine mate-
riell, in einer materialistischen Zeit entstanden,
erscheint bei Scheerbart in das Geistige er-
hoben. Und während es bei Taine den Künst-
ler zum passiven Teil macht, ist das Milieu bei
Scheerbart selbst schon ein nicht gering zu
schätzender Teil der Schöpfung. Man kann
Taines Milieubegriff recht gut mit dem geistes-
verwandten des Darwin in Verbindung bringen,
während wir bei der Sch'eerbartschen Auffas-
sung an die „Merkwelten" Jacob von Uexkülls
denken mögen. Eine weitere Parallele bietet
sich uns dar: mit Darwin-Taine gehört zusam-
men Mehrings „Lessinglegende" (Dietz-Stutt-
gart), als der Versuch, die große künstlerische
Persönlichkeit vom ökonomischen Milieu her
zu erfassen, während wiederum Scheerbart in
seinem köstlichen „Cervantes" (Schuster und
Löffler, Berlin), ohne den Lockungen des äuße-
ren Milieus nachzugeben, aus der geistigen Kon-
zentration die leuchtende Lebendigkeit gewinnt.
Es ist wohl klar, welche bedeutende Rolle
bei der Auswägung des „geistigen Milieus"
für den Künstler der Takt zu spielen hat.
XXI.
Oktobi
•» 1917. 3
PROFESSOR LOVIS CORINTH - BERLIN.
GEMÄLDE »IM FLEISCHERLADEN« 1906.
Scheerbart denkt ja gerade an die Steigerung
der Kultur. „Kultur" aber bedeutet, ohne
natürlich den Begriff damit erschöpfen zu wol-
len, u. a. auch „Pflege", setzt also die fein-
fühlige Beachtung des vorhandenen wertvollen
Gutes voraus, wie ja Scheerbart selbst auf die
Gotik als auf ein solches Gut, das würdig sei,
fortgesetzt zu werden, hinweist.
Machen wir uns den Gegensatz der beiden
Anschauungen weiterhin klar.
Bei Taine wirken die Kräfte des Milieus
zWangsmäßig und unterschiedslos, so daß bei
°äherer Überlegung eine künstlerische Steige-
rung eigentlich ausgeschlossen ist. Denn wo
sollten die Kräfte zu einem Plus denn stecken,
wenn das Schaffen zwangsmäßig und eindeutig,
Prinzipiell, von etwas Bestehendem abhängig
gemacht wird? Scheerbart dagegen hebt den
Zwang der Umwelt auf. Er führt das Alte
durch das Bewußtsein des Schaffenden hin-
durch, der, in Freiheit des Urteils, durch Wahl
aie geistige Umwelt seiner Schöpfung sich her-
stellt. Der Begriff der Umwelt, bei Taine mate-
riell, in einer materialistischen Zeit entstanden,
erscheint bei Scheerbart in das Geistige er-
hoben. Und während es bei Taine den Künst-
ler zum passiven Teil macht, ist das Milieu bei
Scheerbart selbst schon ein nicht gering zu
schätzender Teil der Schöpfung. Man kann
Taines Milieubegriff recht gut mit dem geistes-
verwandten des Darwin in Verbindung bringen,
während wir bei der Sch'eerbartschen Auffas-
sung an die „Merkwelten" Jacob von Uexkülls
denken mögen. Eine weitere Parallele bietet
sich uns dar: mit Darwin-Taine gehört zusam-
men Mehrings „Lessinglegende" (Dietz-Stutt-
gart), als der Versuch, die große künstlerische
Persönlichkeit vom ökonomischen Milieu her
zu erfassen, während wiederum Scheerbart in
seinem köstlichen „Cervantes" (Schuster und
Löffler, Berlin), ohne den Lockungen des äuße-
ren Milieus nachzugeben, aus der geistigen Kon-
zentration die leuchtende Lebendigkeit gewinnt.
Es ist wohl klar, welche bedeutende Rolle
bei der Auswägung des „geistigen Milieus"
für den Künstler der Takt zu spielen hat.
XXI.
Oktobi
•» 1917. 3