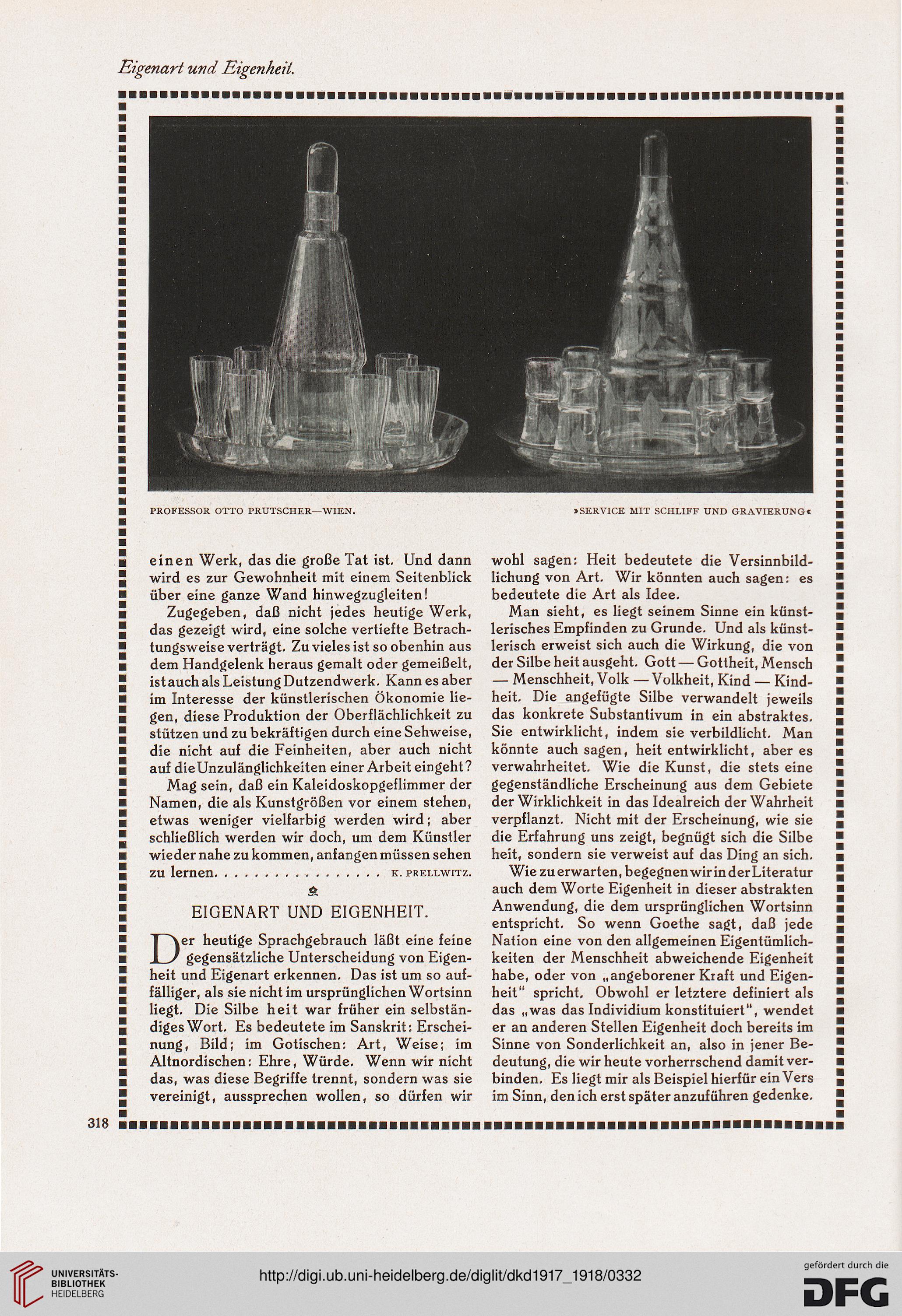Eigenart und Eigenheit.
professor otto prutscher—wien.
»service mit schliff UND GRAVIERUNGc
einen Werk, das die große Tat ist. Und dann
wird es zur Gewohnheit mit einem Seitenblick
über eine ganze Wand hinwegzugleiten!
Zugegeben, daß nicht jedes heutige Werk,
das gezeigt wird, eine solche vertiefte Betrach-
tungsweiseverträgt. Zu vieles ist so obenhin aus
dem Handgelenk heraus gemalt oder gemeißelt,
istauch als Leistung Dutzendwerk. Kann es aber
im Interesse der künstlerischen Ökonomie lie-
gen, diese Produktion der Oberflächlichkeit zu
stützen und zu bekräftigen durch eine Sehweise,
die nicht auf die Feinheiten, aber auch nicht
auf die Unzulänglichkeiten einer Arbeit eingeht?
Mag sein, daß ein Kaleidoskopgeflimmer der
Namen, die als Kunst großen vor einem stehen,
etwas weniger vielfarbig werden wird; aber
schließlich werden wir doch, um dem Künstler
wieder nahe zu kommen, anfangen müssen sehen
zu lernen.................k. prellwitz.
£
EIGENART UND EIGENHEIT.
Der heutige Sprachgebrauch läßt eine feine
gegensätzliche Unterscheidung von Eigen-
heit und Eigenart erkennen. Das ist um so auf-
fälliger, als sie nicht im ursprünglichen Wortsinn
liegt. Die Silbe heit war früher ein selbstän-
diges Wort. Es bedeutete im Sanskrit: Erschei-
nung, Bild; im Gotischen: Art, Weise; im
Altnordischen: Ehre, Würde. Wenn wir nicht
das, was diese Begriffe trennt, sondern was sie
vereinigt, aussprechen wollen, so dürfen wir
wohl sagen: Heit bedeutete die Versinnbild-
lichung von Art. Wir könnten auch sagen: es
bedeutete die Art als Idee.
Man sieht, es liegt seinem Sinne ein künst-
lerisches Empfinden zu Grunde. Und als künst-
lerisch erweist sich auch die Wirkung, die von
der Silbe heit ausgeht. Gott — Gottheit, Mensch
— Menschheit, Volk — Volkheit, Kind — Kind-
heit. Die angefügte Silbe verwandelt jeweils
das konkrete Substantivum in ein abstraktes.
Sie entwirklicht, indem sie verbildlicht. Man
könnte auch sagen, heit entwirklicht, aber es
verwahrheitet. Wie die Kunst, die stets eine
gegenständliche Erscheinung aus dem Gebiete
der Wirklichkeit in das Idealreich der Wahrheit
verpflanzt. Nicht mit der Erscheinung, wie sie
die Erfahrung uns zeigt, begnügt sich die Silbe
heit, sondern sie verweist auf das Ding an sich.
Wie zu erwarten, begegnen wir in der Literatur
auch dem Worte Eigenheit in dieser abstrakten
Anwendung, die dem ursprünglichen Wortsinn
entspricht. So wenn Goethe sagt, daß jede
Nation eine von den allgemeinen Eigentümlich-
keiten der Menschheit abweichende Eigenheit
habe, oder von „angeborener Kraft und Eigen-
heit" spricht. Obwohl er letztere definiert als
das „was das Individium konstituiert", wendet
er an anderen Stellen Eigenheit doch bereits im
Sinne von Sonderlichkeit an, also in jener Be-
deutung, die wir heute vorherrschend damit ver-
binden. Es liegt mir als Beispiel hierfür ein Vers
im Sinn, den ich erst später anzuführen gedenke.
professor otto prutscher—wien.
»service mit schliff UND GRAVIERUNGc
einen Werk, das die große Tat ist. Und dann
wird es zur Gewohnheit mit einem Seitenblick
über eine ganze Wand hinwegzugleiten!
Zugegeben, daß nicht jedes heutige Werk,
das gezeigt wird, eine solche vertiefte Betrach-
tungsweiseverträgt. Zu vieles ist so obenhin aus
dem Handgelenk heraus gemalt oder gemeißelt,
istauch als Leistung Dutzendwerk. Kann es aber
im Interesse der künstlerischen Ökonomie lie-
gen, diese Produktion der Oberflächlichkeit zu
stützen und zu bekräftigen durch eine Sehweise,
die nicht auf die Feinheiten, aber auch nicht
auf die Unzulänglichkeiten einer Arbeit eingeht?
Mag sein, daß ein Kaleidoskopgeflimmer der
Namen, die als Kunst großen vor einem stehen,
etwas weniger vielfarbig werden wird; aber
schließlich werden wir doch, um dem Künstler
wieder nahe zu kommen, anfangen müssen sehen
zu lernen.................k. prellwitz.
£
EIGENART UND EIGENHEIT.
Der heutige Sprachgebrauch läßt eine feine
gegensätzliche Unterscheidung von Eigen-
heit und Eigenart erkennen. Das ist um so auf-
fälliger, als sie nicht im ursprünglichen Wortsinn
liegt. Die Silbe heit war früher ein selbstän-
diges Wort. Es bedeutete im Sanskrit: Erschei-
nung, Bild; im Gotischen: Art, Weise; im
Altnordischen: Ehre, Würde. Wenn wir nicht
das, was diese Begriffe trennt, sondern was sie
vereinigt, aussprechen wollen, so dürfen wir
wohl sagen: Heit bedeutete die Versinnbild-
lichung von Art. Wir könnten auch sagen: es
bedeutete die Art als Idee.
Man sieht, es liegt seinem Sinne ein künst-
lerisches Empfinden zu Grunde. Und als künst-
lerisch erweist sich auch die Wirkung, die von
der Silbe heit ausgeht. Gott — Gottheit, Mensch
— Menschheit, Volk — Volkheit, Kind — Kind-
heit. Die angefügte Silbe verwandelt jeweils
das konkrete Substantivum in ein abstraktes.
Sie entwirklicht, indem sie verbildlicht. Man
könnte auch sagen, heit entwirklicht, aber es
verwahrheitet. Wie die Kunst, die stets eine
gegenständliche Erscheinung aus dem Gebiete
der Wirklichkeit in das Idealreich der Wahrheit
verpflanzt. Nicht mit der Erscheinung, wie sie
die Erfahrung uns zeigt, begnügt sich die Silbe
heit, sondern sie verweist auf das Ding an sich.
Wie zu erwarten, begegnen wir in der Literatur
auch dem Worte Eigenheit in dieser abstrakten
Anwendung, die dem ursprünglichen Wortsinn
entspricht. So wenn Goethe sagt, daß jede
Nation eine von den allgemeinen Eigentümlich-
keiten der Menschheit abweichende Eigenheit
habe, oder von „angeborener Kraft und Eigen-
heit" spricht. Obwohl er letztere definiert als
das „was das Individium konstituiert", wendet
er an anderen Stellen Eigenheit doch bereits im
Sinne von Sonderlichkeit an, also in jener Be-
deutung, die wir heute vorherrschend damit ver-
binden. Es liegt mir als Beispiel hierfür ein Vers
im Sinn, den ich erst später anzuführen gedenke.