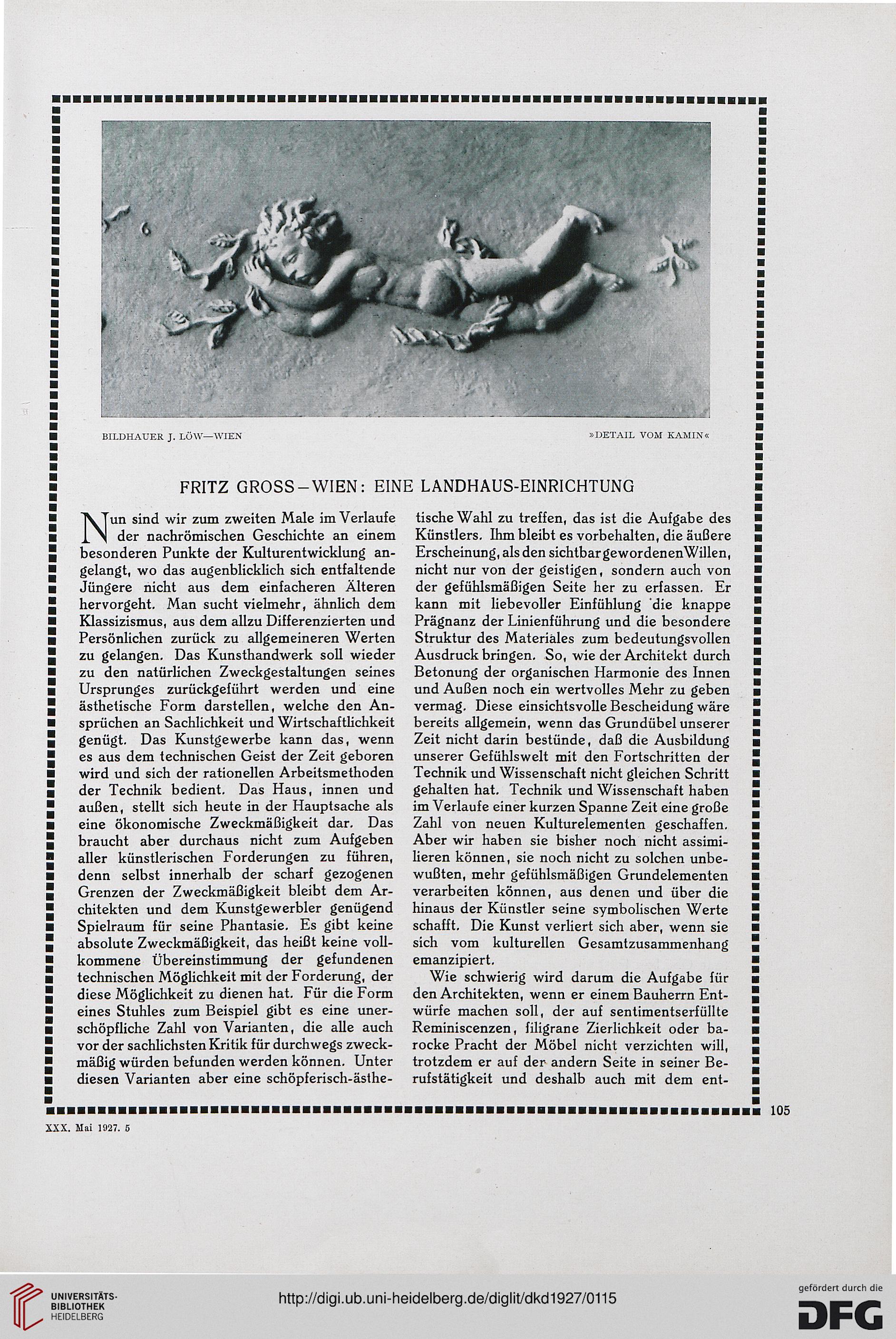BILDHAUER J. LOW—WIEN
»DETAIL VOM KAMIN«
FRITZ GROSS-WIEN: EINE LANDHAUS-EINRICHTUNG
Nun sind wir zum zweiten Male im Verlaufe
der nachrömischen Geschichte an einem
besonderen Punkte der Kulturentwicklung an-
gelangt, wo das augenblicklich sich entfaltende
Jüngere nicht aus dem einfacheren Älteren
hervorgeht. Man sucht vielmehr, ähnlich dem
Klassizismus, aus dem allzu Differenzierten und
Persönlichen zurück zu allgemeineren Werten
zu gelangen. Das Kunsthandwerk soll wieder
zu den natürlichen Zweckgestaltungen seines
Ursprunges zurückgeführt werden und eine
ästhetische Form darstellen, welche den An-
sprüchen an Sachlichkeit und Wirtschaftlichkeit
genügt. Das Kunstgewerbe kann das, wenn
es aus dem technischen Geist der Zeit geboren
wird und sich der rationellen Arbeitsmethoden
der Technik bedient. Das Haus, innen und
außen, stellt sich heute in der Hauptsache als
eine ökonomische Zweckmäßigkeit dar. Das
braucht aber durchaus nicht zum Aufgeben
aller künstlerischen Forderungen zu führen,
denn selbst innerhalb der scharf gezogenen
Grenzen der Zweckmäßigkeit bleibt dem Ar-
chitekten und dem Kunstgewerbler genügend
Spielraum für seine Phantasie. Es gibt keine
absolute Zweckmäßigkeit, das heißt keine voll-
kommene Übereinstimmung der gefundenen
technischen Möglichkeit mit der Forderung, der
diese Möglichkeit zu dienen hat. Für die Form
eines Stuhles zum Beispiel gibt es eine uner-
schöpfliche Zahl von Varianten, die alle auch
vor der sachlichsten Kritik für durchwegs zweck-
mäßig würden befunden werden können. Unter
diesen Varianten aber eine schöpferisch-ästhe-
tische Wahl zu treffen, das ist die Aufgabe des
Künstlers. Ihm bleibt es vorbehalten, die äußere
Erscheinung, als den sichtbargewordenenWillen,
nicht nur von der geistigen, sondern auch von
der gefühlsmäßigen Seite her zu erfassen. Er
kann mit liebevoller Einfühlung die knappe
Prägnanz der Linienführung und die besondere
Struktur des Materiäles zum bedeutungsvollen
Ausdruck bringen. So, wie der Architekt durch
Betonung der organischen Harmonie des Innen
und Außen noch ein wertvolles Mehr zu geben
vermag. Diese einsichtsvolle Bescheidung wäre
bereits allgemein, wenn das Grundübel unserer
Zeit nicht darin bestünde, daß die Ausbildung
unserer Gefühlswelt mit den Fortschritten der
Technik und Wissenschaft nicht gleichen Schritt
gehalten hat. Technik und Wissenschaft haben
im Verlaufe einer kurzen Spanne Zeit eine große
Zahl von neuen Kulturelementen geschaffen.
Aber wir haben sie bisher noch nicht assimi-
lieren können, sie noch nicht zu solchen unbe-
wußten, mehr gefühlsmäßigen Grundelementen
verarbeiten können, aus denen und über die
hinaus der Künstler seine symbolischen Werte
schafft. Die Kunst verliert sich aber, wenn sie
sich vom kulturellen Gesamtzusammenhang
emanzipiert.
Wie schwierig wird darum die Aufgabe für
den Architekten, wenn er einem Bauherrn Ent-
würfe machen soll, der auf sentimentserfüllte
Reminiscenzen, filigrane Zierlichkeit oder ba-
rocke Pracht der Möbel nicht verzichten will,
trotzdem er auf der andern Seite in seiner Be-
rufstätigkeit und deshalb auch mit dem ent-
XXX. Mai 1927. 5
»DETAIL VOM KAMIN«
FRITZ GROSS-WIEN: EINE LANDHAUS-EINRICHTUNG
Nun sind wir zum zweiten Male im Verlaufe
der nachrömischen Geschichte an einem
besonderen Punkte der Kulturentwicklung an-
gelangt, wo das augenblicklich sich entfaltende
Jüngere nicht aus dem einfacheren Älteren
hervorgeht. Man sucht vielmehr, ähnlich dem
Klassizismus, aus dem allzu Differenzierten und
Persönlichen zurück zu allgemeineren Werten
zu gelangen. Das Kunsthandwerk soll wieder
zu den natürlichen Zweckgestaltungen seines
Ursprunges zurückgeführt werden und eine
ästhetische Form darstellen, welche den An-
sprüchen an Sachlichkeit und Wirtschaftlichkeit
genügt. Das Kunstgewerbe kann das, wenn
es aus dem technischen Geist der Zeit geboren
wird und sich der rationellen Arbeitsmethoden
der Technik bedient. Das Haus, innen und
außen, stellt sich heute in der Hauptsache als
eine ökonomische Zweckmäßigkeit dar. Das
braucht aber durchaus nicht zum Aufgeben
aller künstlerischen Forderungen zu führen,
denn selbst innerhalb der scharf gezogenen
Grenzen der Zweckmäßigkeit bleibt dem Ar-
chitekten und dem Kunstgewerbler genügend
Spielraum für seine Phantasie. Es gibt keine
absolute Zweckmäßigkeit, das heißt keine voll-
kommene Übereinstimmung der gefundenen
technischen Möglichkeit mit der Forderung, der
diese Möglichkeit zu dienen hat. Für die Form
eines Stuhles zum Beispiel gibt es eine uner-
schöpfliche Zahl von Varianten, die alle auch
vor der sachlichsten Kritik für durchwegs zweck-
mäßig würden befunden werden können. Unter
diesen Varianten aber eine schöpferisch-ästhe-
tische Wahl zu treffen, das ist die Aufgabe des
Künstlers. Ihm bleibt es vorbehalten, die äußere
Erscheinung, als den sichtbargewordenenWillen,
nicht nur von der geistigen, sondern auch von
der gefühlsmäßigen Seite her zu erfassen. Er
kann mit liebevoller Einfühlung die knappe
Prägnanz der Linienführung und die besondere
Struktur des Materiäles zum bedeutungsvollen
Ausdruck bringen. So, wie der Architekt durch
Betonung der organischen Harmonie des Innen
und Außen noch ein wertvolles Mehr zu geben
vermag. Diese einsichtsvolle Bescheidung wäre
bereits allgemein, wenn das Grundübel unserer
Zeit nicht darin bestünde, daß die Ausbildung
unserer Gefühlswelt mit den Fortschritten der
Technik und Wissenschaft nicht gleichen Schritt
gehalten hat. Technik und Wissenschaft haben
im Verlaufe einer kurzen Spanne Zeit eine große
Zahl von neuen Kulturelementen geschaffen.
Aber wir haben sie bisher noch nicht assimi-
lieren können, sie noch nicht zu solchen unbe-
wußten, mehr gefühlsmäßigen Grundelementen
verarbeiten können, aus denen und über die
hinaus der Künstler seine symbolischen Werte
schafft. Die Kunst verliert sich aber, wenn sie
sich vom kulturellen Gesamtzusammenhang
emanzipiert.
Wie schwierig wird darum die Aufgabe für
den Architekten, wenn er einem Bauherrn Ent-
würfe machen soll, der auf sentimentserfüllte
Reminiscenzen, filigrane Zierlichkeit oder ba-
rocke Pracht der Möbel nicht verzichten will,
trotzdem er auf der andern Seite in seiner Be-
rufstätigkeit und deshalb auch mit dem ent-
XXX. Mai 1927. 5