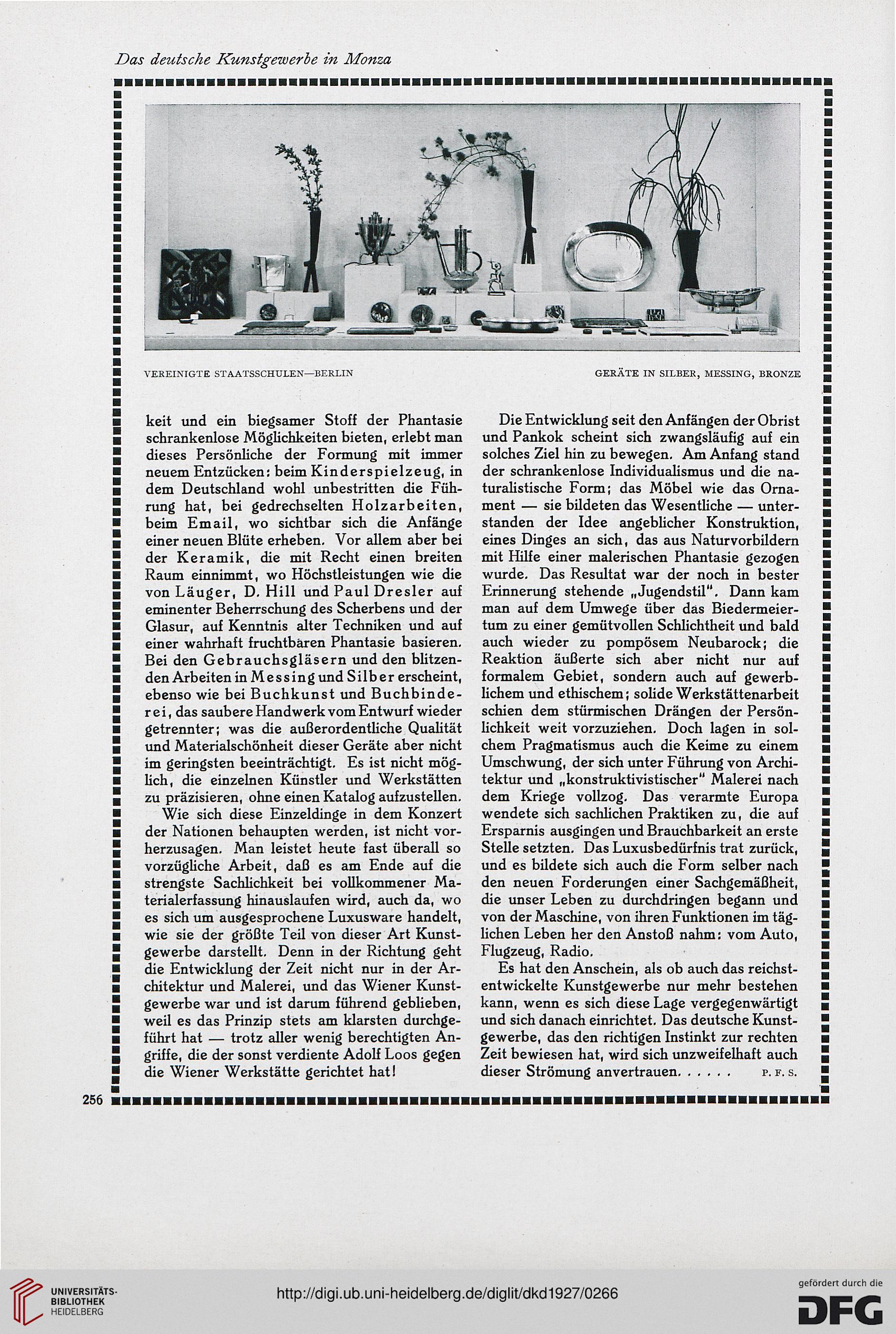Das deutsche Kunstgewerbe in Monza
VEREINIGTE STAATSSCHULEN—BERLIN
GERATE IN SILBER, MESSING, BRONZE
keit und ein biegsamer Stoff der Phantasie
schrankenlose Möglichkeiten bieten, erlebt man
dieses Persönliche der Formung mit immer
neuem Entzücken: beim Kinderspielzeug, in
dem Deutschland wohl unbestritten die Füh-
rung hat, bei gedrechselten Holzarbeiten,
beim Email, wo sichtbar sich die Anfänge
einer neuen Blüte erheben. Vor allem aber bei
der Keramik, die mit Recht einen breiten
Raum einnimmt, wo Höchstleistungen wie die
von Läuger, D. Hill und Paul Dresler auf
eminenter Beherrschung des Scherbens und der
Glasur, auf Kenntnis alter Techniken und auf
einer wahrhaft fruchtbaren Phantasie basieren.
Bei den Gebrauchsgläsern und den blitzen-
den Arbeiten in Messing und Silber erscheint,
ebenso wie bei Buchkunst und Buchbinde-
rei, das saubere Handwerk vom Entwurf wieder
getrennter; was die außerordentliche Qualität
und Materialschönheit dieser Geräte aber nicht
im geringsten beeinträchtigt. Es ist nicht mög-
lich, die einzelnen Künstler und Werkstätten
zu präzisieren, ohne einen Katalog aufzustellen.
Wie sich diese Einzeldinge in dem Konzert
der Nationen behaupten werden, ist nicht vor-
herzusagen. Man leistet heute fast überall so
vorzügliche Arbeit, daß es am Ende auf die
strengste Sachlichkeit bei vollkommener Ma-
terialerfassung hinauslaufen wird, auch da, wo
es sich um ausgesprochene Luxusware handelt,
wie sie der größte Teil von dieser Art Kunst-
gewerbe darstellt. Denn in der Richtung geht
die Entwicklung der Zeit nicht nur in der Ar-
chitektur und Malerei, und das Wiener Kunst-
gewerbe war und ist darum führend geblieben,
weil es das Prinzip stets am klarsten durchge-
führt hat — trotz aller wenig berechtigten An-
griffe, die der sonst verdiente Adolf Loos gegen
die Wiener Werkstätte gerichtet hat!
Die Entwicklung seit den Anfängen der Obrist
und Pankok scheint sich zwangsläufig auf ein
solches Ziel hin zu bewegen. Am Anfang stand
der schrankenlose Individualismus und die na-
turalistische Form; das Möbel wie das Orna-
ment — sie bildeten das Wesentliche — unter-
standen der Idee angeblicher Konstruktion,
eines Dinges an sich, das aus Naturvorbildern
mit Hilfe einer malerischen Phantasie gezogen
wurde. Das Resultat war der noch in bester
Erinnerung stehende „Jugendstil". Dann kam
man auf dem Umwege über das Biedermeier-
tum zu einer gemütvollen Schlichtheit und bald
auch wieder zu pompösem Neubarock; die
Reaktion äußerte sich aber nicht nur auf
formalem Gebiet, sondern auch auf gewerb-
lichem und ethischem; solide Werkstättenarbeit
schien dem stürmischen Drängen der Persön-
lichkeit weit vorzuziehen. Doch lagen in sol-
chem Pragmatismus auch die Keime zu einem
Umschwung, der sich unter Führung von Archi-
tektur und „konstruktivistischer" Malerei nach
dem Kriege vollzog. Das verarmte Europa
wendete sich sachlichen Praktiken zu, die auf
Ersparnis ausgingen und Brauchbarkeit an erste
Stelle setzten. Das Luxusbedürfnis trat zurück,
und es bildete sich auch die Form selber nach
den neuen Forderungen einer Sachgemäßheit,
die unser Leben zu durchdringen begann und
von der Maschine, von ihren Funktionen im täg-
lichen Leben her den Anstoß nahm: vom Auto,
Flugzeug, Radio.
Es hat den Anschein, als ob auch das reichst-
entwickelte Kunstgewerbe nur mehr bestehen
kann, wenn es sich diese Lage vergegenwärtigt
und sich danach einrichtet. Das deutsche Kunst-
gewerbe, das den richtigen Instinkt zur rechten
Zeit bewiesen hat, wird sich unzweifelhaft auch
dieser Strömung anvertrauen...... p. f. s.
VEREINIGTE STAATSSCHULEN—BERLIN
GERATE IN SILBER, MESSING, BRONZE
keit und ein biegsamer Stoff der Phantasie
schrankenlose Möglichkeiten bieten, erlebt man
dieses Persönliche der Formung mit immer
neuem Entzücken: beim Kinderspielzeug, in
dem Deutschland wohl unbestritten die Füh-
rung hat, bei gedrechselten Holzarbeiten,
beim Email, wo sichtbar sich die Anfänge
einer neuen Blüte erheben. Vor allem aber bei
der Keramik, die mit Recht einen breiten
Raum einnimmt, wo Höchstleistungen wie die
von Läuger, D. Hill und Paul Dresler auf
eminenter Beherrschung des Scherbens und der
Glasur, auf Kenntnis alter Techniken und auf
einer wahrhaft fruchtbaren Phantasie basieren.
Bei den Gebrauchsgläsern und den blitzen-
den Arbeiten in Messing und Silber erscheint,
ebenso wie bei Buchkunst und Buchbinde-
rei, das saubere Handwerk vom Entwurf wieder
getrennter; was die außerordentliche Qualität
und Materialschönheit dieser Geräte aber nicht
im geringsten beeinträchtigt. Es ist nicht mög-
lich, die einzelnen Künstler und Werkstätten
zu präzisieren, ohne einen Katalog aufzustellen.
Wie sich diese Einzeldinge in dem Konzert
der Nationen behaupten werden, ist nicht vor-
herzusagen. Man leistet heute fast überall so
vorzügliche Arbeit, daß es am Ende auf die
strengste Sachlichkeit bei vollkommener Ma-
terialerfassung hinauslaufen wird, auch da, wo
es sich um ausgesprochene Luxusware handelt,
wie sie der größte Teil von dieser Art Kunst-
gewerbe darstellt. Denn in der Richtung geht
die Entwicklung der Zeit nicht nur in der Ar-
chitektur und Malerei, und das Wiener Kunst-
gewerbe war und ist darum führend geblieben,
weil es das Prinzip stets am klarsten durchge-
führt hat — trotz aller wenig berechtigten An-
griffe, die der sonst verdiente Adolf Loos gegen
die Wiener Werkstätte gerichtet hat!
Die Entwicklung seit den Anfängen der Obrist
und Pankok scheint sich zwangsläufig auf ein
solches Ziel hin zu bewegen. Am Anfang stand
der schrankenlose Individualismus und die na-
turalistische Form; das Möbel wie das Orna-
ment — sie bildeten das Wesentliche — unter-
standen der Idee angeblicher Konstruktion,
eines Dinges an sich, das aus Naturvorbildern
mit Hilfe einer malerischen Phantasie gezogen
wurde. Das Resultat war der noch in bester
Erinnerung stehende „Jugendstil". Dann kam
man auf dem Umwege über das Biedermeier-
tum zu einer gemütvollen Schlichtheit und bald
auch wieder zu pompösem Neubarock; die
Reaktion äußerte sich aber nicht nur auf
formalem Gebiet, sondern auch auf gewerb-
lichem und ethischem; solide Werkstättenarbeit
schien dem stürmischen Drängen der Persön-
lichkeit weit vorzuziehen. Doch lagen in sol-
chem Pragmatismus auch die Keime zu einem
Umschwung, der sich unter Führung von Archi-
tektur und „konstruktivistischer" Malerei nach
dem Kriege vollzog. Das verarmte Europa
wendete sich sachlichen Praktiken zu, die auf
Ersparnis ausgingen und Brauchbarkeit an erste
Stelle setzten. Das Luxusbedürfnis trat zurück,
und es bildete sich auch die Form selber nach
den neuen Forderungen einer Sachgemäßheit,
die unser Leben zu durchdringen begann und
von der Maschine, von ihren Funktionen im täg-
lichen Leben her den Anstoß nahm: vom Auto,
Flugzeug, Radio.
Es hat den Anschein, als ob auch das reichst-
entwickelte Kunstgewerbe nur mehr bestehen
kann, wenn es sich diese Lage vergegenwärtigt
und sich danach einrichtet. Das deutsche Kunst-
gewerbe, das den richtigen Instinkt zur rechten
Zeit bewiesen hat, wird sich unzweifelhaft auch
dieser Strömung anvertrauen...... p. f. s.