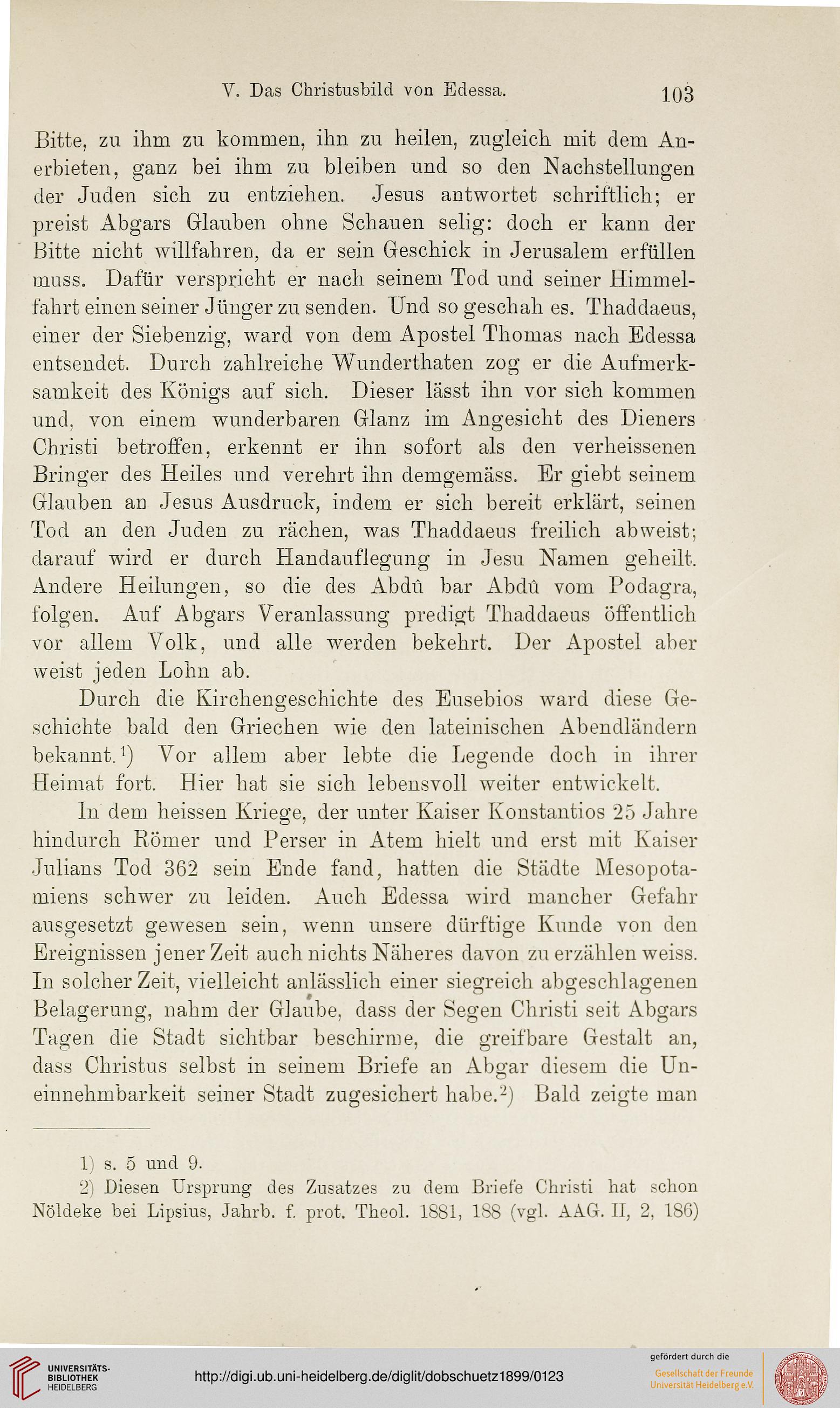V. Das Christusbild von Edessa.
103
Bitte, zu ihm zu kommen, ihn zu heilen, zugleich mit dem An-
erbieten, ganz bei ihm zu bleiben und so den Nachstellungen
der Juden sich zu entziehen. Jesus antwortet schriftlich; er
preist Abgars Glauben ohne Schauen selig: doch er kann der
Bitte nicht willfahren, da er sein Geschick in Jerusalem erfüllen
muss. Dafür verspricht er nach seinem Tod und seiner Himmel-
fahrt einen seiner Jünger zu senden. Und so geschah es. Thaddaeus,
einer der Siebenzig, ward von dem Apostel Thomas nach Edessa
entsendet. Durch zahlreiche Wunderthaten zog er die Aufmerk-
samkeit des Königs auf sich. Dieser lässt ihn vor sich kommen
und, von einem wunderbaren Glanz im Angesicht des Dieners
Christi betroffen, erkennt er ihn sofort als den verheissenen
Bringer des Heiles und verehrt ihn demgemäss. Er giebt seinem
Glauben an Jesus Ausdruck, indem er sich bereit erklärt, seinen
Tod an den Juden zu rächen, was Thaddaeus freilich abweist;
darauf wird er durch Handauflegung in Jesu Namen geheilt.
Andere Heilungen, so die des Abdu bar Abdü vom Podagra,
folgen. Auf Abgars Veranlassung predigt Thaddaeus öffentlich
vor allem Volk, und alle werden bekehrt. Der Apostel aber
weist jeden Lohn ab.
Durch die Kirchengeschichte des Eusebios ward diese Ge-
schichte bald den Griechen wie den lateinischen Abendländern
bekannt.') Vor allem aber lebte die Legende doch in ihrer
Heimat fort. Hier hat sie sich lebensvoll weiter entwickelt.
In dem heissen Kriege, der unter Kaiser Konstantios 25 Jahre
hindurch Römer und Perser in Atem hielt und erst mit Kaiser
Julians Tod 362 sein Ende fand, hatten die Städte Mesopota-
miens schwer zu leiden. Auch Edessa wird mancher Gefahr
ausgesetzt gewesen sein, wenn unsere dürftige Kunde von den
Ereignissen jener Zeit auch nichts Näheres davon zu erzählen weiss.
In solcher Zeit, vielleicht anlässlich einer siegreich abgeschlagenen
Belagerung, nahm der Glaube, dass der Segen Christi seit Abgars
Tagen die Stadt sichtbar beschirme, die greifbare Gestalt an,
dass Christus selbst in seinem Briefe an Abgar diesem die Un-
einnehmbarkeit seiner Stadt zugesichert habe.2) Bald zeigte man
1) s. δ und 9.
2) Diesen Ursprung des Zusatzes zu dem Briete Christi hat schon
Nöldeke bei Lipsius, Jahrb. f. prot. Theol. 1881, 188 (vgl. Α AG. Π, 2, 186)
103
Bitte, zu ihm zu kommen, ihn zu heilen, zugleich mit dem An-
erbieten, ganz bei ihm zu bleiben und so den Nachstellungen
der Juden sich zu entziehen. Jesus antwortet schriftlich; er
preist Abgars Glauben ohne Schauen selig: doch er kann der
Bitte nicht willfahren, da er sein Geschick in Jerusalem erfüllen
muss. Dafür verspricht er nach seinem Tod und seiner Himmel-
fahrt einen seiner Jünger zu senden. Und so geschah es. Thaddaeus,
einer der Siebenzig, ward von dem Apostel Thomas nach Edessa
entsendet. Durch zahlreiche Wunderthaten zog er die Aufmerk-
samkeit des Königs auf sich. Dieser lässt ihn vor sich kommen
und, von einem wunderbaren Glanz im Angesicht des Dieners
Christi betroffen, erkennt er ihn sofort als den verheissenen
Bringer des Heiles und verehrt ihn demgemäss. Er giebt seinem
Glauben an Jesus Ausdruck, indem er sich bereit erklärt, seinen
Tod an den Juden zu rächen, was Thaddaeus freilich abweist;
darauf wird er durch Handauflegung in Jesu Namen geheilt.
Andere Heilungen, so die des Abdu bar Abdü vom Podagra,
folgen. Auf Abgars Veranlassung predigt Thaddaeus öffentlich
vor allem Volk, und alle werden bekehrt. Der Apostel aber
weist jeden Lohn ab.
Durch die Kirchengeschichte des Eusebios ward diese Ge-
schichte bald den Griechen wie den lateinischen Abendländern
bekannt.') Vor allem aber lebte die Legende doch in ihrer
Heimat fort. Hier hat sie sich lebensvoll weiter entwickelt.
In dem heissen Kriege, der unter Kaiser Konstantios 25 Jahre
hindurch Römer und Perser in Atem hielt und erst mit Kaiser
Julians Tod 362 sein Ende fand, hatten die Städte Mesopota-
miens schwer zu leiden. Auch Edessa wird mancher Gefahr
ausgesetzt gewesen sein, wenn unsere dürftige Kunde von den
Ereignissen jener Zeit auch nichts Näheres davon zu erzählen weiss.
In solcher Zeit, vielleicht anlässlich einer siegreich abgeschlagenen
Belagerung, nahm der Glaube, dass der Segen Christi seit Abgars
Tagen die Stadt sichtbar beschirme, die greifbare Gestalt an,
dass Christus selbst in seinem Briefe an Abgar diesem die Un-
einnehmbarkeit seiner Stadt zugesichert habe.2) Bald zeigte man
1) s. δ und 9.
2) Diesen Ursprung des Zusatzes zu dem Briete Christi hat schon
Nöldeke bei Lipsius, Jahrb. f. prot. Theol. 1881, 188 (vgl. Α AG. Π, 2, 186)