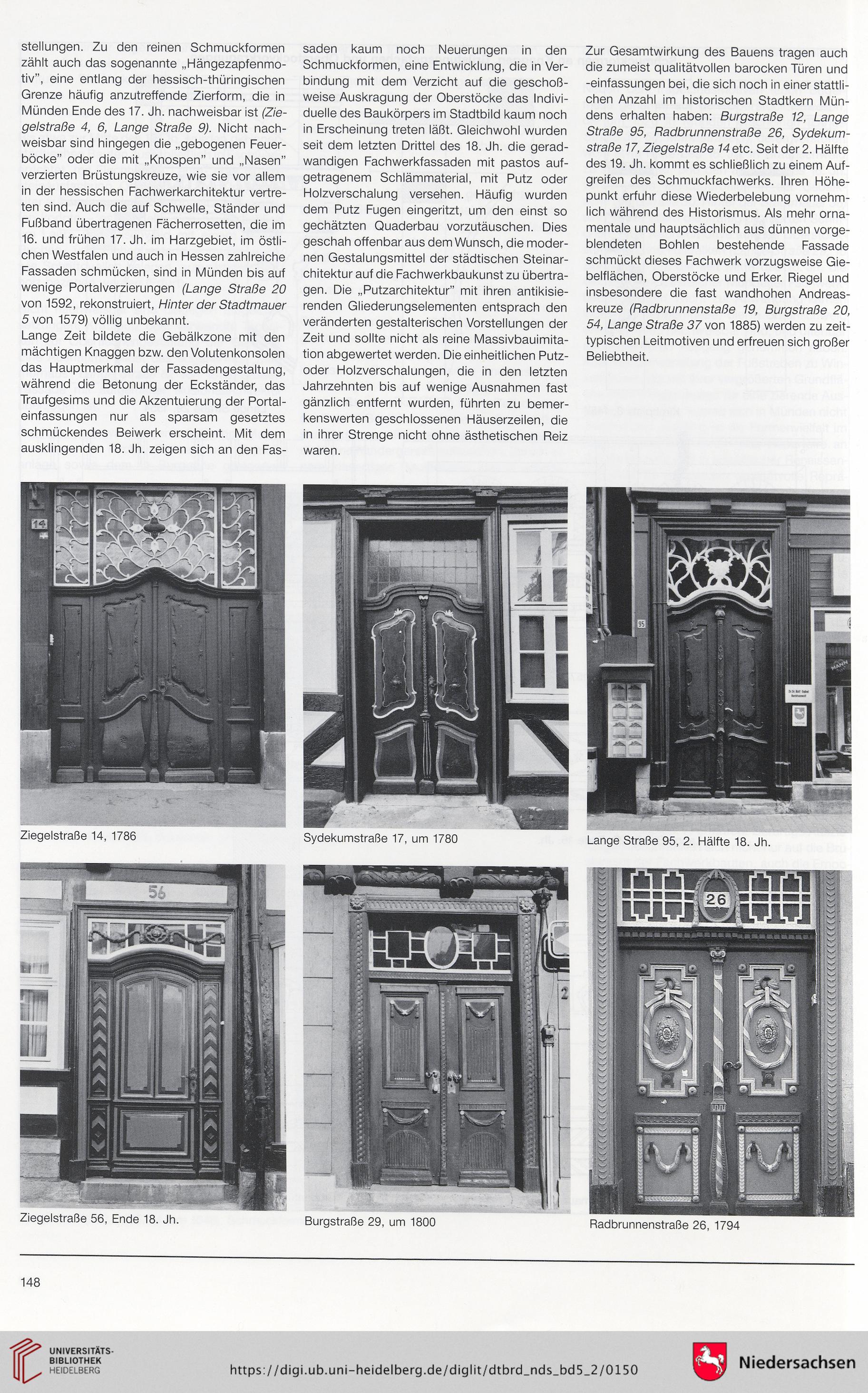Stellungen. Zu den reinen Schmuckformen
zählt auch das sogenannte „Hängezapfenmo-
tiv”, eine entlang der hessisch-thüringischen
Grenze häufig anzutreffende Zierform, die in
Münden Ende des 17. Jh. nachweisbar ist (Zie-
gelstraße 4, 6, Lange Straße 9). Nicht nach-
weisbar sind hingegen die „gebogenen Feuer-
böcke” oder die mit „Knospen” und „Nasen”
verzierten Brüstungskreuze, wie sie vor allem
in der hessischen Fachwerkarchitektur vertre-
ten sind. Auch die auf Schwelle, Ständer und
Fußband übertragenen Fächerrosetten, die im
16. und frühen 17. Jh. im Harzgebiet, im östli-
chen Westfalen und auch in Hessen zahlreiche
Fassaden schmücken, sind in Münden bis auf
wenige Portalverzierungen (Lange Straße 20
von 1592, rekonstruiert, Hinter der Stadtmauer
5 von 1579) völlig unbekannt.
Lange Zeit bildete die Gebälkzone mit den
mächtigen Knaggen bzw. den Volutenkonsolen
das Hauptmerkmal der Fassadengestaltung,
während die Betonung der Eckständer, das
Traufgesims und die Akzentuierung der Portal-
einfassungen nur als sparsam gesetztes
schmückendes Beiwerk erscheint. Mit dem
ausklingenden 18. Jh. zeigen sich an den Fas-
saden kaum noch Neuerungen in den
Schmuckformen, eine Entwicklung, die in Ver-
bindung mit dem Verzicht auf die geschoß-
weise Auskragung der Oberstöcke das Indivi-
duelle des Baukörpers im Stadtbild kaum noch
in Erscheinung treten läßt. Gleichwohl wurden
seit dem letzten Drittel des 18. Jh. die gerad-
wandigen Fachwerkfassaden mit pastös auf-
getragenem Schlämmaterial, mit Putz oder
Holzverschalung versehen. Häufig wurden
dem Putz Fugen eingeritzt, um den einst so
gechätzten Quaderbau vorzutäuschen. Dies
geschah offenbar aus dem Wunsch, die moder-
nen Gestalungsmittel der städtischen Steinar-
chitektur auf die Fachwerkbaukunst zu übertra-
gen. Die „Putzarchitektur” mit ihren antikisie-
renden Gliederungselementen entsprach den
veränderten gestalterischen Vorstellungen der
Zeit und sollte nicht als reine Massivbauimita-
tion abgewertet werden. Die einheitlichen Putz-
oder Holzverschalungen, die in den letzten
Jahrzehnten bis auf wenige Ausnahmen fast
gänzlich entfernt wurden, führten zu bemer-
kenswerten geschlossenen Häuserzeilen, die
in ihrer Strenge nicht ohne ästhetischen Reiz
waren.
Zur Gesamtwirkung des Bauens tragen auch
die zumeist qualitätvollen barocken Türen und
-einfassungen bei, die sich noch in einer stattli-
chen Anzahl im historischen Stadtkern Mün-
dens erhalten haben: Burgstraße 12, Lange
Straße 95, Radbrunnenstraße 26, Sydekum-
straße 17, Ziegelstraße 14 etc. Seit der 2. Hälfte
des 19. Jh. kommt es schließlich zu einem Auf-
greifen des Schmuckfachwerks. Ihren Höhe-
punkt erfuhr diese Wiederbelebung vornehm-
lich während des Historismus. Als mehr orna-
mentale und hauptsächlich aus dünnen vorge-
blendeten Bohlen bestehende Fassade
schmückt dieses Fachwerk vorzugsweise Gie-
belflächen, Oberstöcke und Erker. Riegel und
insbesondere die fast wandhohen Andreas-
kreuze (Radbrunnenstaße 19, Burgstraße 20,
54, Lange Straße 37 von 1885) werden zu zeit-
typischen Leitmotiven und erfreuen sich großer
Beliebtheit.
Ziegelstraße 14, 1786
Sydekumstraße 17, um 1780
Lange Straße 95, 2. Hälfte 18. Jh.
Ziegelstraße 56, Ende 18. Jh.
Burgstraße 29, um 1800
Radbrunnenstraße 26, 1794
148
zählt auch das sogenannte „Hängezapfenmo-
tiv”, eine entlang der hessisch-thüringischen
Grenze häufig anzutreffende Zierform, die in
Münden Ende des 17. Jh. nachweisbar ist (Zie-
gelstraße 4, 6, Lange Straße 9). Nicht nach-
weisbar sind hingegen die „gebogenen Feuer-
böcke” oder die mit „Knospen” und „Nasen”
verzierten Brüstungskreuze, wie sie vor allem
in der hessischen Fachwerkarchitektur vertre-
ten sind. Auch die auf Schwelle, Ständer und
Fußband übertragenen Fächerrosetten, die im
16. und frühen 17. Jh. im Harzgebiet, im östli-
chen Westfalen und auch in Hessen zahlreiche
Fassaden schmücken, sind in Münden bis auf
wenige Portalverzierungen (Lange Straße 20
von 1592, rekonstruiert, Hinter der Stadtmauer
5 von 1579) völlig unbekannt.
Lange Zeit bildete die Gebälkzone mit den
mächtigen Knaggen bzw. den Volutenkonsolen
das Hauptmerkmal der Fassadengestaltung,
während die Betonung der Eckständer, das
Traufgesims und die Akzentuierung der Portal-
einfassungen nur als sparsam gesetztes
schmückendes Beiwerk erscheint. Mit dem
ausklingenden 18. Jh. zeigen sich an den Fas-
saden kaum noch Neuerungen in den
Schmuckformen, eine Entwicklung, die in Ver-
bindung mit dem Verzicht auf die geschoß-
weise Auskragung der Oberstöcke das Indivi-
duelle des Baukörpers im Stadtbild kaum noch
in Erscheinung treten läßt. Gleichwohl wurden
seit dem letzten Drittel des 18. Jh. die gerad-
wandigen Fachwerkfassaden mit pastös auf-
getragenem Schlämmaterial, mit Putz oder
Holzverschalung versehen. Häufig wurden
dem Putz Fugen eingeritzt, um den einst so
gechätzten Quaderbau vorzutäuschen. Dies
geschah offenbar aus dem Wunsch, die moder-
nen Gestalungsmittel der städtischen Steinar-
chitektur auf die Fachwerkbaukunst zu übertra-
gen. Die „Putzarchitektur” mit ihren antikisie-
renden Gliederungselementen entsprach den
veränderten gestalterischen Vorstellungen der
Zeit und sollte nicht als reine Massivbauimita-
tion abgewertet werden. Die einheitlichen Putz-
oder Holzverschalungen, die in den letzten
Jahrzehnten bis auf wenige Ausnahmen fast
gänzlich entfernt wurden, führten zu bemer-
kenswerten geschlossenen Häuserzeilen, die
in ihrer Strenge nicht ohne ästhetischen Reiz
waren.
Zur Gesamtwirkung des Bauens tragen auch
die zumeist qualitätvollen barocken Türen und
-einfassungen bei, die sich noch in einer stattli-
chen Anzahl im historischen Stadtkern Mün-
dens erhalten haben: Burgstraße 12, Lange
Straße 95, Radbrunnenstraße 26, Sydekum-
straße 17, Ziegelstraße 14 etc. Seit der 2. Hälfte
des 19. Jh. kommt es schließlich zu einem Auf-
greifen des Schmuckfachwerks. Ihren Höhe-
punkt erfuhr diese Wiederbelebung vornehm-
lich während des Historismus. Als mehr orna-
mentale und hauptsächlich aus dünnen vorge-
blendeten Bohlen bestehende Fassade
schmückt dieses Fachwerk vorzugsweise Gie-
belflächen, Oberstöcke und Erker. Riegel und
insbesondere die fast wandhohen Andreas-
kreuze (Radbrunnenstaße 19, Burgstraße 20,
54, Lange Straße 37 von 1885) werden zu zeit-
typischen Leitmotiven und erfreuen sich großer
Beliebtheit.
Ziegelstraße 14, 1786
Sydekumstraße 17, um 1780
Lange Straße 95, 2. Hälfte 18. Jh.
Ziegelstraße 56, Ende 18. Jh.
Burgstraße 29, um 1800
Radbrunnenstraße 26, 1794
148