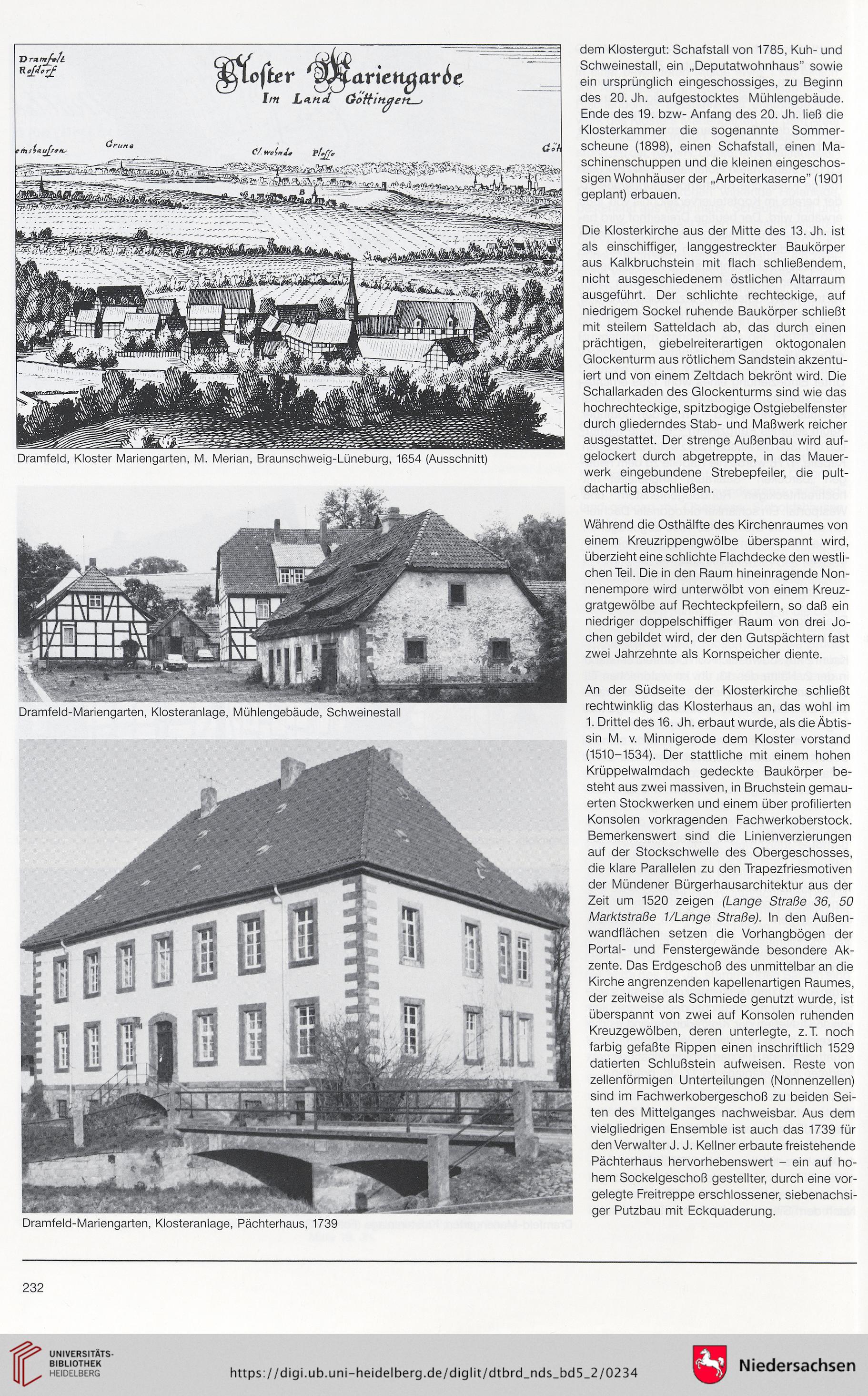Dramfeld, Kloster Mariengarten, M. Merian, Braunschweig-Lüneburg, 1654 (Ausschnitt)
Dramfeld-Mariengarten, Klosteranlage, Mühlengebäude, Schweinestall
dem Klostergut: Schafstall von 1785, Kuh- und
Schweinestall, ein „Deputatwohnhaus” sowie
ein ursprünglich eingeschossiges, zu Beginn
des 20. Jh. aufgestocktes Mühlengebäude.
Ende des 19. bzw- Anfang des 20. Jh. ließ die
Klosterkammer die sogenannte Sommer-
scheune (1898), einen Schafstall, einen Ma-
schinenschuppen und die kleinen eingeschos-
sigen Wohnhäuser der „Arbeiterkaserne” (1901
geplant) erbauen.
Die Klosterkirche aus der Mitte des 13. Jh. ist
als einschiffiger, langgestreckter Baukörper
aus Kalkbruchstein mit flach schließendem,
nicht ausgeschiedenem östlichen Altarraum
ausgeführt. Der schlichte rechteckige, auf
niedrigem Sockel ruhende Baukörper schließt
mit steilem Satteldach ab, das durch einen
prächtigen, giebelreiterartigen oktogonalen
Glockenturm aus rötlichem Sandstein akzentu-
iert und von einem Zeltdach bekrönt wird. Die
Schallarkaden des Glockenturms sind wie das
hochrechteckige, spitzbogige Ostgiebelfenster
durch gliederndes Stab- und Maßwerk reicher
ausgestattet. Der strenge Außenbau wird auf-
gelockert durch abgetreppte, in das Mauer-
werk eingebundene Strebepfeiler, die pult-
dachartig abschließen.
Während die Osthälfte des Kirchenraumes von
einem Kreuzrippengwölbe überspannt wird,
überzieht eine schlichte Flachdecke den westli-
chen Teil. Die in den Raum hineinragende Non-
nenempore wird unterwölbt von einem Kreuz-
gratgewölbe auf Rechteckpfeilern, so daß ein
niedriger doppelschiffiger Raum von drei Jo-
chen gebildet wird, der den Gutspächtern fast
zwei Jahrzehnte als Kornspeicher diente.
An der Südseite der Klosterkirche schließt
rechtwinklig das Klosterhaus an, das wohl im
1. Drittel des 16. Jh. erbaut wurde, als die Äbtis-
Dramfeld-Mariengarten, Klosteranlage, Pächterhaus, 1739
sin M. v. Minnigerode dem Kloster vorstand
(1510-1534). Der stattliche mit einem hohen
Krüppelwalmdach gedeckte Baukörper be-
steht aus zwei massiven, in Bruchstein gemau-
erten Stockwerken und einem über profilierten
Konsolen vorkragenden Fachwerkoberstock.
Bemerkenswert sind die Linienverzierungen
auf der Stockschwelle des Obergeschosses,
die klare Parallelen zu den Trapezfriesmotiven
der Mündener Bürgerhausarchitektur aus der
Zeit um 1520 zeigen (Lange Straße 36, 50
Marktstraße 1/Lange Straße). In den Außen-
wandflächen setzen die Vorhangbögen der
Portal- und Fenstergewände besondere Ak-
zente. Das Erdgeschoß des unmittelbar an die
Kirche angrenzenden kapellenartigen Raumes,
der zeitweise als Schmiede genutzt wurde, ist
überspannt von zwei auf Konsolen ruhenden
Kreuzgewölben, deren unterlegte, z.T. noch
farbig gefaßte Rippen einen inschriftlich 1529
datierten Schlußstein aufweisen. Reste von
zellenförmigen Unterteilungen (Nonnenzellen)
sind im Fachwerkobergeschoß zu beiden Sei-
ten des Mittelganges nachweisbar. Aus dem
vielgliedrigen Ensemble ist auch das 1739 für
den Verwalter J. J. Kellner erbaute freistehende
Pächterhaus hervorhebenswert - ein auf ho-
hem Sockelgeschoß gestellter, durch eine vor-
gelegte Freitreppe erschlossener, siebenachsi-
ger Putzbau mit Eckquaderung.
232
Dramfeld-Mariengarten, Klosteranlage, Mühlengebäude, Schweinestall
dem Klostergut: Schafstall von 1785, Kuh- und
Schweinestall, ein „Deputatwohnhaus” sowie
ein ursprünglich eingeschossiges, zu Beginn
des 20. Jh. aufgestocktes Mühlengebäude.
Ende des 19. bzw- Anfang des 20. Jh. ließ die
Klosterkammer die sogenannte Sommer-
scheune (1898), einen Schafstall, einen Ma-
schinenschuppen und die kleinen eingeschos-
sigen Wohnhäuser der „Arbeiterkaserne” (1901
geplant) erbauen.
Die Klosterkirche aus der Mitte des 13. Jh. ist
als einschiffiger, langgestreckter Baukörper
aus Kalkbruchstein mit flach schließendem,
nicht ausgeschiedenem östlichen Altarraum
ausgeführt. Der schlichte rechteckige, auf
niedrigem Sockel ruhende Baukörper schließt
mit steilem Satteldach ab, das durch einen
prächtigen, giebelreiterartigen oktogonalen
Glockenturm aus rötlichem Sandstein akzentu-
iert und von einem Zeltdach bekrönt wird. Die
Schallarkaden des Glockenturms sind wie das
hochrechteckige, spitzbogige Ostgiebelfenster
durch gliederndes Stab- und Maßwerk reicher
ausgestattet. Der strenge Außenbau wird auf-
gelockert durch abgetreppte, in das Mauer-
werk eingebundene Strebepfeiler, die pult-
dachartig abschließen.
Während die Osthälfte des Kirchenraumes von
einem Kreuzrippengwölbe überspannt wird,
überzieht eine schlichte Flachdecke den westli-
chen Teil. Die in den Raum hineinragende Non-
nenempore wird unterwölbt von einem Kreuz-
gratgewölbe auf Rechteckpfeilern, so daß ein
niedriger doppelschiffiger Raum von drei Jo-
chen gebildet wird, der den Gutspächtern fast
zwei Jahrzehnte als Kornspeicher diente.
An der Südseite der Klosterkirche schließt
rechtwinklig das Klosterhaus an, das wohl im
1. Drittel des 16. Jh. erbaut wurde, als die Äbtis-
Dramfeld-Mariengarten, Klosteranlage, Pächterhaus, 1739
sin M. v. Minnigerode dem Kloster vorstand
(1510-1534). Der stattliche mit einem hohen
Krüppelwalmdach gedeckte Baukörper be-
steht aus zwei massiven, in Bruchstein gemau-
erten Stockwerken und einem über profilierten
Konsolen vorkragenden Fachwerkoberstock.
Bemerkenswert sind die Linienverzierungen
auf der Stockschwelle des Obergeschosses,
die klare Parallelen zu den Trapezfriesmotiven
der Mündener Bürgerhausarchitektur aus der
Zeit um 1520 zeigen (Lange Straße 36, 50
Marktstraße 1/Lange Straße). In den Außen-
wandflächen setzen die Vorhangbögen der
Portal- und Fenstergewände besondere Ak-
zente. Das Erdgeschoß des unmittelbar an die
Kirche angrenzenden kapellenartigen Raumes,
der zeitweise als Schmiede genutzt wurde, ist
überspannt von zwei auf Konsolen ruhenden
Kreuzgewölben, deren unterlegte, z.T. noch
farbig gefaßte Rippen einen inschriftlich 1529
datierten Schlußstein aufweisen. Reste von
zellenförmigen Unterteilungen (Nonnenzellen)
sind im Fachwerkobergeschoß zu beiden Sei-
ten des Mittelganges nachweisbar. Aus dem
vielgliedrigen Ensemble ist auch das 1739 für
den Verwalter J. J. Kellner erbaute freistehende
Pächterhaus hervorhebenswert - ein auf ho-
hem Sockelgeschoß gestellter, durch eine vor-
gelegte Freitreppe erschlossener, siebenachsi-
ger Putzbau mit Eckquaderung.
232