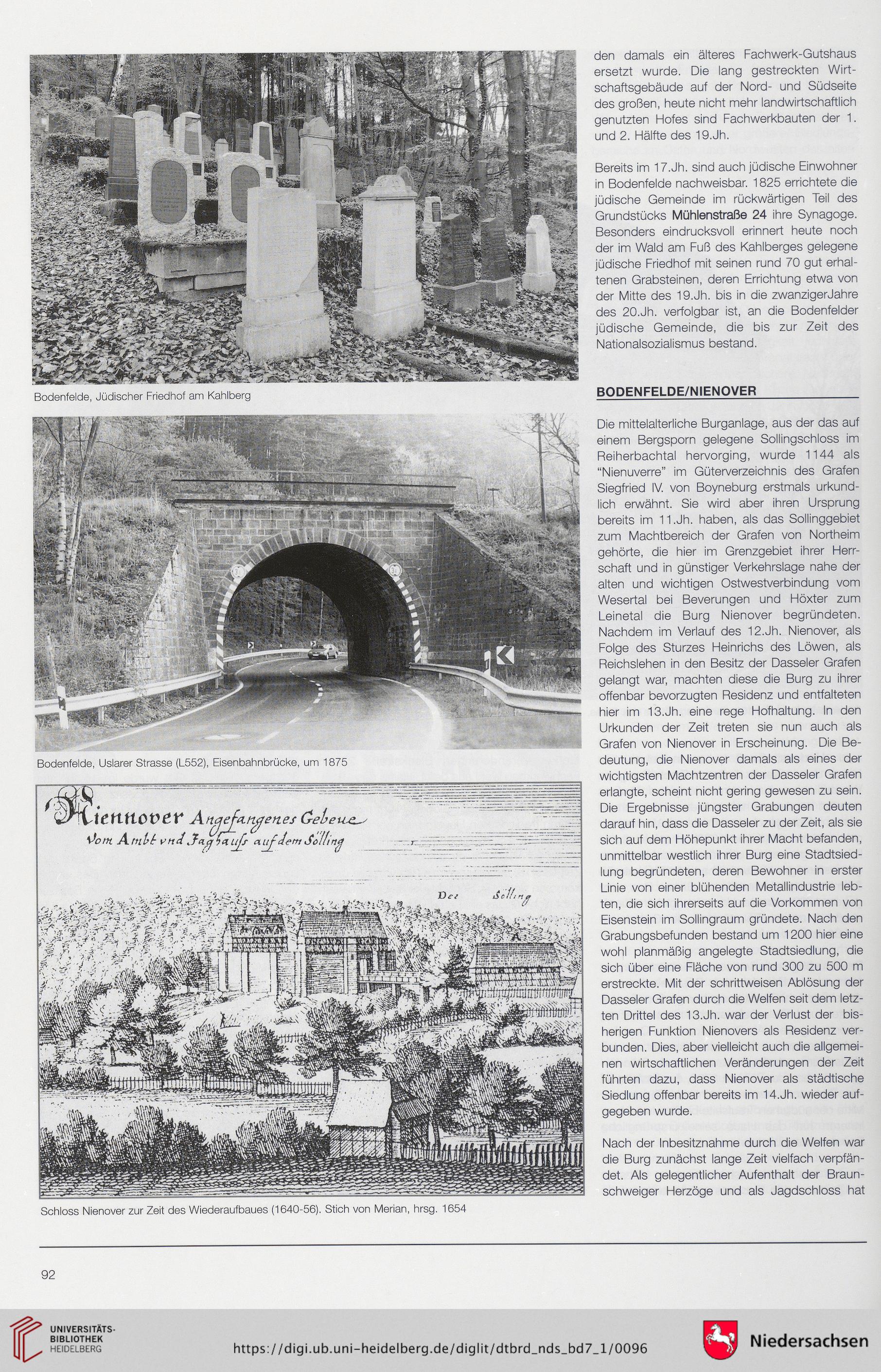Bodenfelde, Uslarer Strasse (L552), Eisenbahnbrücke, um 1875
Schloss Nienover zur Zeit des Wiederaufbaues (1640-56). Stich von Merian, hrsg. 1654
den damals ein älteres Fachwerk-Gutshaus
ersetzt wurde. Die lang gestreckten Wirt-
schaftsgebäude auf der Nord- und Südseite
des großen, heute nicht mehr landwirtschaftlich
genutzten Hofes sind Fachwerkbauten der 1.
und 2. Hälfte des 19.Jh.
Bereits im 17.Jh. sind auch jüdische Einwohner
in Bodenfelde nachweisbar. 1825 errichtete die
jüdische Gemeinde im rückwärtigen Teil des
Grundstücks Mühlenstraße 24 ihre Synagoge.
Besonders eindrucksvoll erinnert heute noch
der im Wald am Fuß des Kahlberges gelegene
jüdische Friedhof mit seinen rund 70 gut erhal-
tenen Grabsteinen, deren Errichtung etwa von
der Mitte des 19.Jh. bis in die zwanzigerJahre
des 20.Jh. verfolgbar ist, an die Bodenfelder
jüdische Gemeinde, die bis zur Zeit des
Nationalsozialismus bestand.
BODENFELDE/NIENOVER
Die mittelalterliche Burganlage, aus der das auf
einem Bergsporn gelegene Sollingschloss im
Reiherbachtal hervorging, wurde 1144 als
“Nienuverre” im Güterverzeichnis des Grafen
Siegfried IV. von Boyneburg erstmals urkund-
lich erwähnt. Sie wird aber ihren Ursprung
bereits im 11.Jh. haben, als das Sollinggebiet
zum Machtbereich der Grafen von Northeim
gehörte, die hier im Grenzgebiet ihrer Herr-
schaft und in günstiger Verkehrslage nahe der
alten und wichtigen Ostwestverbindung vom
Wesertal bei Beverungen und Höxter zum
Leinetal die Burg Nienover begründeten.
Nachdem im Verlauf des 12.Jh. Nienover, als
Folge des Sturzes Heinrichs des Löwen, als
Reichslehen in den Besitz der Dasseler Grafen
gelangt war, machten diese die Burg zu ihrer
offenbar bevorzugten Residenz und entfalteten
hier im 13.Jh. eine rege Hofhaltung. In den
Urkunden der Zeit treten sie nun auch als
Grafen von Nienover in Erscheinung. Die Be-
deutung, die Nienover damals als eines der
wichtigsten Machtzentren der Dasseler Grafen
erlangte, scheint nicht gering gewesen zu sein.
Die Ergebnisse jüngster Grabungen deuten
darauf hin, dass die Dasseler zu der Zeit, als sie
sich auf dem Höhepunkt ihrer Macht befanden,
unmittelbar westlich ihrer Burg eine Stadtsied-
lung begründeten, deren Bewohner in erster
Linie von einer blühenden Metallindustrie leb-
ten, die sich ihrerseits auf die Vorkommen von
Eisenstein im Sollingraum gründete. Nach den
Grabungsbefunden bestand um 1200 hier eine
wohl planmäßig angelegte Stadtsiedlung, die
sich über eine Fläche von rund 300 zu 500 m
erstreckte. Mit der schrittweisen Ablösung der
Dasseler Grafen durch die Welfen seit dem letz-
ten Drittel des 13.Jh. war der Verlust der bis-
herigen Funktion Nienovers als Residenz ver-
bunden. Dies, aber vielleicht auch die allgemei-
nen wirtschaftlichen Veränderungen der Zeit
führten dazu, dass Nienover als städtische
Siedlung offenbar bereits im 14.Jh. wieder auf-
gegeben wurde.
Nach der Inbesitznahme durch die Welfen war
die Burg zunächst lange Zeit vielfach verpfän-
det. Als gelegentlicher Aufenthalt der Braun-
schweiger Herzöge und als Jagdschloss hat
92
Schloss Nienover zur Zeit des Wiederaufbaues (1640-56). Stich von Merian, hrsg. 1654
den damals ein älteres Fachwerk-Gutshaus
ersetzt wurde. Die lang gestreckten Wirt-
schaftsgebäude auf der Nord- und Südseite
des großen, heute nicht mehr landwirtschaftlich
genutzten Hofes sind Fachwerkbauten der 1.
und 2. Hälfte des 19.Jh.
Bereits im 17.Jh. sind auch jüdische Einwohner
in Bodenfelde nachweisbar. 1825 errichtete die
jüdische Gemeinde im rückwärtigen Teil des
Grundstücks Mühlenstraße 24 ihre Synagoge.
Besonders eindrucksvoll erinnert heute noch
der im Wald am Fuß des Kahlberges gelegene
jüdische Friedhof mit seinen rund 70 gut erhal-
tenen Grabsteinen, deren Errichtung etwa von
der Mitte des 19.Jh. bis in die zwanzigerJahre
des 20.Jh. verfolgbar ist, an die Bodenfelder
jüdische Gemeinde, die bis zur Zeit des
Nationalsozialismus bestand.
BODENFELDE/NIENOVER
Die mittelalterliche Burganlage, aus der das auf
einem Bergsporn gelegene Sollingschloss im
Reiherbachtal hervorging, wurde 1144 als
“Nienuverre” im Güterverzeichnis des Grafen
Siegfried IV. von Boyneburg erstmals urkund-
lich erwähnt. Sie wird aber ihren Ursprung
bereits im 11.Jh. haben, als das Sollinggebiet
zum Machtbereich der Grafen von Northeim
gehörte, die hier im Grenzgebiet ihrer Herr-
schaft und in günstiger Verkehrslage nahe der
alten und wichtigen Ostwestverbindung vom
Wesertal bei Beverungen und Höxter zum
Leinetal die Burg Nienover begründeten.
Nachdem im Verlauf des 12.Jh. Nienover, als
Folge des Sturzes Heinrichs des Löwen, als
Reichslehen in den Besitz der Dasseler Grafen
gelangt war, machten diese die Burg zu ihrer
offenbar bevorzugten Residenz und entfalteten
hier im 13.Jh. eine rege Hofhaltung. In den
Urkunden der Zeit treten sie nun auch als
Grafen von Nienover in Erscheinung. Die Be-
deutung, die Nienover damals als eines der
wichtigsten Machtzentren der Dasseler Grafen
erlangte, scheint nicht gering gewesen zu sein.
Die Ergebnisse jüngster Grabungen deuten
darauf hin, dass die Dasseler zu der Zeit, als sie
sich auf dem Höhepunkt ihrer Macht befanden,
unmittelbar westlich ihrer Burg eine Stadtsied-
lung begründeten, deren Bewohner in erster
Linie von einer blühenden Metallindustrie leb-
ten, die sich ihrerseits auf die Vorkommen von
Eisenstein im Sollingraum gründete. Nach den
Grabungsbefunden bestand um 1200 hier eine
wohl planmäßig angelegte Stadtsiedlung, die
sich über eine Fläche von rund 300 zu 500 m
erstreckte. Mit der schrittweisen Ablösung der
Dasseler Grafen durch die Welfen seit dem letz-
ten Drittel des 13.Jh. war der Verlust der bis-
herigen Funktion Nienovers als Residenz ver-
bunden. Dies, aber vielleicht auch die allgemei-
nen wirtschaftlichen Veränderungen der Zeit
führten dazu, dass Nienover als städtische
Siedlung offenbar bereits im 14.Jh. wieder auf-
gegeben wurde.
Nach der Inbesitznahme durch die Welfen war
die Burg zunächst lange Zeit vielfach verpfän-
det. Als gelegentlicher Aufenthalt der Braun-
schweiger Herzöge und als Jagdschloss hat
92