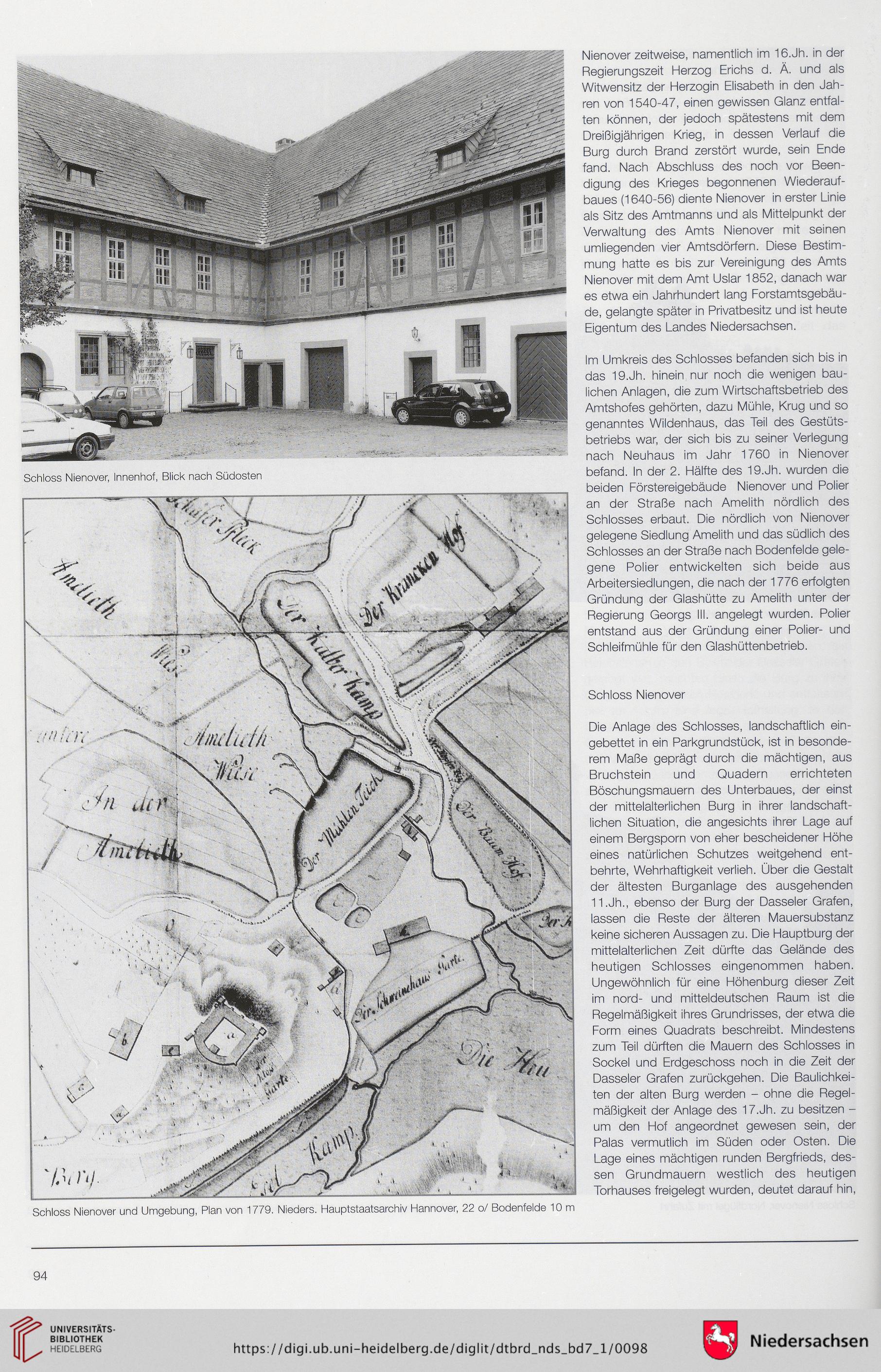Nienover zeitweise, namentlich im 16.Jh. in der
Regierungszeit Herzog Erichs d. Ä. und als
Witwensitz der Herzogin Elisabeth in den Jah-
ren von 1540-47, einen gewissen Glanz entfal-
ten können, der jedoch spätestens mit dem
Dreißigjährigen Krieg, in dessen Verlauf die
Burg durch Brand zerstört wurde, sein Ende
fand. Nach Abschluss des noch vor Been-
digung des Krieges begonnenen Wiederauf-
baues (1640-56) diente Nienover in erster Linie
als Sitz des Amtmanns und als Mittelpunkt der
Verwaltung des Amts Nienover mit seinen
umliegenden vier Amtsdörfern. Diese Bestim-
mung hatte es bis zur Vereinigung des Amts
Nienover mit dem Amt Uslar 1852, danach war
es etwa ein Jahrhundert lang Forstamtsgebäu-
de, gelangte später in Privatbesitz und ist heute
Eigentum des Landes Niedersachsen.
Im Umkreis des Schlosses befanden sich bis in
das 19.Jh. hinein nur noch die wenigen bau-
lichen Anlagen, die zum Wirtschaftsbetrieb des
Amtshofes gehörten, dazu Mühle, Krug und so
genanntes Wildenhaus, das Teil des Gestüts-
betriebs war, der sich bis zu seiner Verlegung
nach Neuhaus im Jahr 1760 in Nienover
befand. In der 2. Hälfte des 19.Jh. wurden die
beiden Förstereigebäude Nienover und Polier
an der Straße nach Amelith nördlich des
Schlosses erbaut. Die nördlich von Nienover
gelegene Siedlung Amelith und das südlich des
Schlosses an der Straße nach Bodenfelde gele-
gene Polier entwickelten sich beide aus
Arbeitersiedlungen, die nach der 1776 erfolgten
Gründung der Glashütte zu Amelith unter der
Regierung Georgs III. angelegt wurden. Polier
entstand aus der Gründung einer Polier- und
Schleifmühle für den Glashüttenbetrieb.
Schloss Nienover
Die Anlage des Schlosses, landschaftlich ein-
gebettet in ein Parkgrundstück, ist in besonde-
rem Maße geprägt durch die mächtigen, aus
Bruchstein und Quadern errichteten
Böschungsmauern des Unterbaues, der einst
der mittelalterlichen Burg in ihrer landschaft-
lichen Situation, die angesichts ihrer Lage auf
einem Bergsporn von eher bescheidener Höhe
eines natürlichen Schutzes weitgehend ent-
behrte, Wehrhaftigkeit verlieh. Über die Gestalt
der ältesten Burganlage des ausgehenden
ll.Jh., ebenso der Burg der Dasseler Grafen,
lassen die Reste der älteren Mauersubstanz
keine sicheren Aussagen zu. Die Hauptburg der
mittelalterlichen Zeit dürfte das Gelände des
heutigen Schlosses eingenommen haben.
Ungewöhnlich für eine Höhenburg dieser Zeit
im nord- und mitteldeutschen Raum ist die
Regelmäßigkeit ihres Grundrisses, der etwa die
Form eines Quadrats beschreibt. Mindestens
zum Teil dürften die Mauern des Schlosses in
Sockel und Erdgeschoss noch in die Zeit der
Dasseler Grafen zurückgehen. Die Baulichkei-
ten der alten Burg werden - ohne die Regel-
mäßigkeit der Anlage des 17.Jh. zu besitzen -
um den Hof angeordnet gewesen sein, der
Palas vermutlich im Süden oder Osten. Die
Lage eines mächtigen runden Bergfrieds, des-
sen Grundmauern westlich des heutigen
Torhauses freigelegt wurden, deutet darauf hin,
94