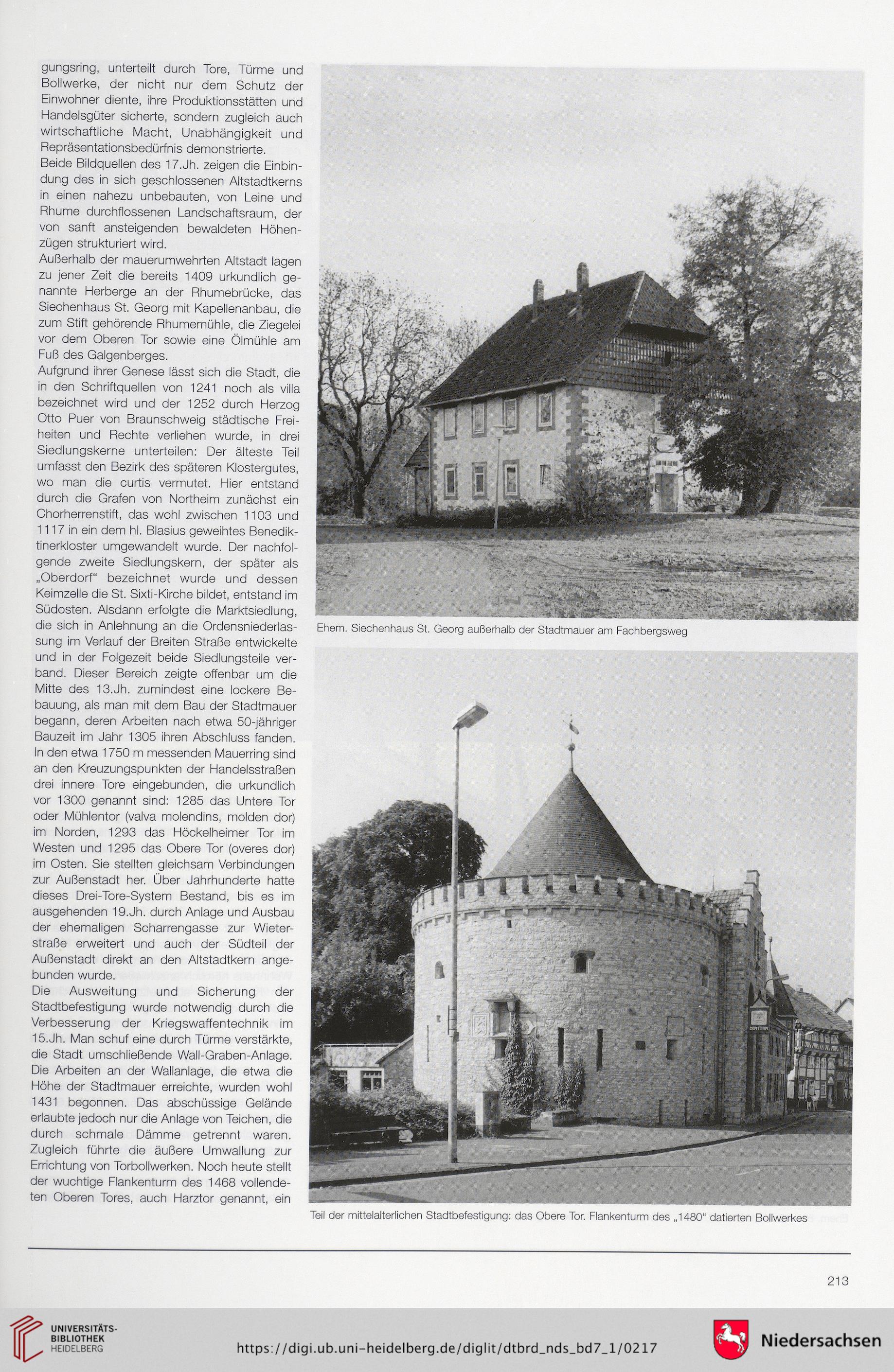gungsring, unterteilt durch Tore, Türme und
Bollwerke, der nicht nur dem Schutz der
Einwohner diente, ihre Produktionsstätten und
Handelsgüter sicherte, sondern zugleich auch
wirtschaftliche Macht, Unabhängigkeit und
Repräsentationsbedürfnis demonstrierte.
Beide Bildquellen des 17.Jh. zeigen die Einbin-
dung des in sich geschlossenen Altstadtkerns
in einen nahezu unbebauten, von Leine und
Rhume durchflossenen Landschaftsraum, der
von sanft ansteigenden bewaldeten Höhen-
zügen strukturiert wird.
Außerhalb der mauerumwehrten Altstadt lagen
zu jener Zeit die bereits 1409 urkundlich ge-
nannte Herberge an der Rhumebrücke, das
Siechenhaus St. Georg mit Kapellenanbau, die
zum Stift gehörende Rhumemühle, die Ziegelei
vor dem Oberen Tor sowie eine Ölmühle am
Fuß des Galgenberges.
Aufgrund ihrer Genese lässt sich die Stadt, die
in den Schriftquellen von 1241 noch als villa
bezeichnet wird und der 1252 durch Herzog
Otto Puer von Braunschweig städtische Frei-
heiten und Rechte verliehen wurde, in drei
Siedlungskerne unterteilen: Der älteste Teil
umfasst den Bezirk des späteren Klostergutes,
wo man die curtis vermutet. Hier entstand
durch die Grafen von Northeim zunächst ein
Chorherrenstift, das wohl zwischen 1103 und
1117 in ein dem hl. Blasius geweihtes Benedik-
tinerkloster umgewandelt wurde. Der nachfol-
gende zweite Siedlungskern, der später als
„Oberdorf“ bezeichnet wurde und dessen
Keimzelle die St. Sixti-Kirche bildet, entstand im
Südosten. Alsdann erfolgte die Marktsiedlung,
die sich in Anlehnung an die Ordensniederlas-
sung im Verlauf der Breiten Straße entwickelte
und in der Folgezeit beide Siedlungsteile ver-
band. Dieser Bereich zeigte offenbar um die
Mitte des 13.Jh. zumindest eine lockere Be-
bauung, als man mit dem Bau der Stadtmauer
begann, deren Arbeiten nach etwa 50-jähriger
Bauzeit im Jahr 1305 ihren Abschluss fanden.
In den etwa 1750 m messenden Mauerring sind
an den Kreuzungspunkten der Handelsstraßen
drei innere Tore eingebunden, die urkundlich
vor 1300 genannt sind: 1285 das Untere Tor
oder Mühlentor (valva molendins, molden dor)
im Norden, 1293 das Höckelheimer Tor im
Westen und 1295 das Obere Tor (overes dor)
im Osten. Sie stellten gleichsam Verbindungen
zur Außenstadt her. Über Jahrhunderte hatte
dieses Drei-Tore-System Bestand, bis es im
ausgehenden 19.Jh. durch Anlage und Ausbau
der ehemaligen Scharrengasse zur Wieter-
straße erweitert und auch der Südteil der
Außenstadt direkt an den Altstadtkern ange-
bunden wurde.
Die Ausweitung und Sicherung der
Stadtbefestigung wurde notwendig durch die
Verbesserung der Kriegswaffentechnik im
15.Jh. Man schuf eine durch Türme verstärkte,
die Stadt umschließende Wall-Graben-Anlage.
Die Arbeiten an der Wallanlage, die etwa die
Höhe der Stadtmauer erreichte, wurden wohl
1431 begonnen. Das abschüssige Gelände
erlaubte jedoch nur die Anlage von Teichen, die
durch schmale Dämme getrennt waren.
Zugleich führte die äußere Umwallung zur
Errichtung von Torbollwerken. Noch heute stellt
der wuchtige Flankenturm des 1468 vollende-
ten Oberen Tores, auch Harztor genannt, ein
Ehern. Siechenhaus St. Georg außerhalb der Stadtmauer am Fachbergsweg
Teil der mittelalterlichen Stadtbefestigung: das Obere Tor. Flankenturm des „1480“ datierten Bollwerkes
213
Bollwerke, der nicht nur dem Schutz der
Einwohner diente, ihre Produktionsstätten und
Handelsgüter sicherte, sondern zugleich auch
wirtschaftliche Macht, Unabhängigkeit und
Repräsentationsbedürfnis demonstrierte.
Beide Bildquellen des 17.Jh. zeigen die Einbin-
dung des in sich geschlossenen Altstadtkerns
in einen nahezu unbebauten, von Leine und
Rhume durchflossenen Landschaftsraum, der
von sanft ansteigenden bewaldeten Höhen-
zügen strukturiert wird.
Außerhalb der mauerumwehrten Altstadt lagen
zu jener Zeit die bereits 1409 urkundlich ge-
nannte Herberge an der Rhumebrücke, das
Siechenhaus St. Georg mit Kapellenanbau, die
zum Stift gehörende Rhumemühle, die Ziegelei
vor dem Oberen Tor sowie eine Ölmühle am
Fuß des Galgenberges.
Aufgrund ihrer Genese lässt sich die Stadt, die
in den Schriftquellen von 1241 noch als villa
bezeichnet wird und der 1252 durch Herzog
Otto Puer von Braunschweig städtische Frei-
heiten und Rechte verliehen wurde, in drei
Siedlungskerne unterteilen: Der älteste Teil
umfasst den Bezirk des späteren Klostergutes,
wo man die curtis vermutet. Hier entstand
durch die Grafen von Northeim zunächst ein
Chorherrenstift, das wohl zwischen 1103 und
1117 in ein dem hl. Blasius geweihtes Benedik-
tinerkloster umgewandelt wurde. Der nachfol-
gende zweite Siedlungskern, der später als
„Oberdorf“ bezeichnet wurde und dessen
Keimzelle die St. Sixti-Kirche bildet, entstand im
Südosten. Alsdann erfolgte die Marktsiedlung,
die sich in Anlehnung an die Ordensniederlas-
sung im Verlauf der Breiten Straße entwickelte
und in der Folgezeit beide Siedlungsteile ver-
band. Dieser Bereich zeigte offenbar um die
Mitte des 13.Jh. zumindest eine lockere Be-
bauung, als man mit dem Bau der Stadtmauer
begann, deren Arbeiten nach etwa 50-jähriger
Bauzeit im Jahr 1305 ihren Abschluss fanden.
In den etwa 1750 m messenden Mauerring sind
an den Kreuzungspunkten der Handelsstraßen
drei innere Tore eingebunden, die urkundlich
vor 1300 genannt sind: 1285 das Untere Tor
oder Mühlentor (valva molendins, molden dor)
im Norden, 1293 das Höckelheimer Tor im
Westen und 1295 das Obere Tor (overes dor)
im Osten. Sie stellten gleichsam Verbindungen
zur Außenstadt her. Über Jahrhunderte hatte
dieses Drei-Tore-System Bestand, bis es im
ausgehenden 19.Jh. durch Anlage und Ausbau
der ehemaligen Scharrengasse zur Wieter-
straße erweitert und auch der Südteil der
Außenstadt direkt an den Altstadtkern ange-
bunden wurde.
Die Ausweitung und Sicherung der
Stadtbefestigung wurde notwendig durch die
Verbesserung der Kriegswaffentechnik im
15.Jh. Man schuf eine durch Türme verstärkte,
die Stadt umschließende Wall-Graben-Anlage.
Die Arbeiten an der Wallanlage, die etwa die
Höhe der Stadtmauer erreichte, wurden wohl
1431 begonnen. Das abschüssige Gelände
erlaubte jedoch nur die Anlage von Teichen, die
durch schmale Dämme getrennt waren.
Zugleich führte die äußere Umwallung zur
Errichtung von Torbollwerken. Noch heute stellt
der wuchtige Flankenturm des 1468 vollende-
ten Oberen Tores, auch Harztor genannt, ein
Ehern. Siechenhaus St. Georg außerhalb der Stadtmauer am Fachbergsweg
Teil der mittelalterlichen Stadtbefestigung: das Obere Tor. Flankenturm des „1480“ datierten Bollwerkes
213