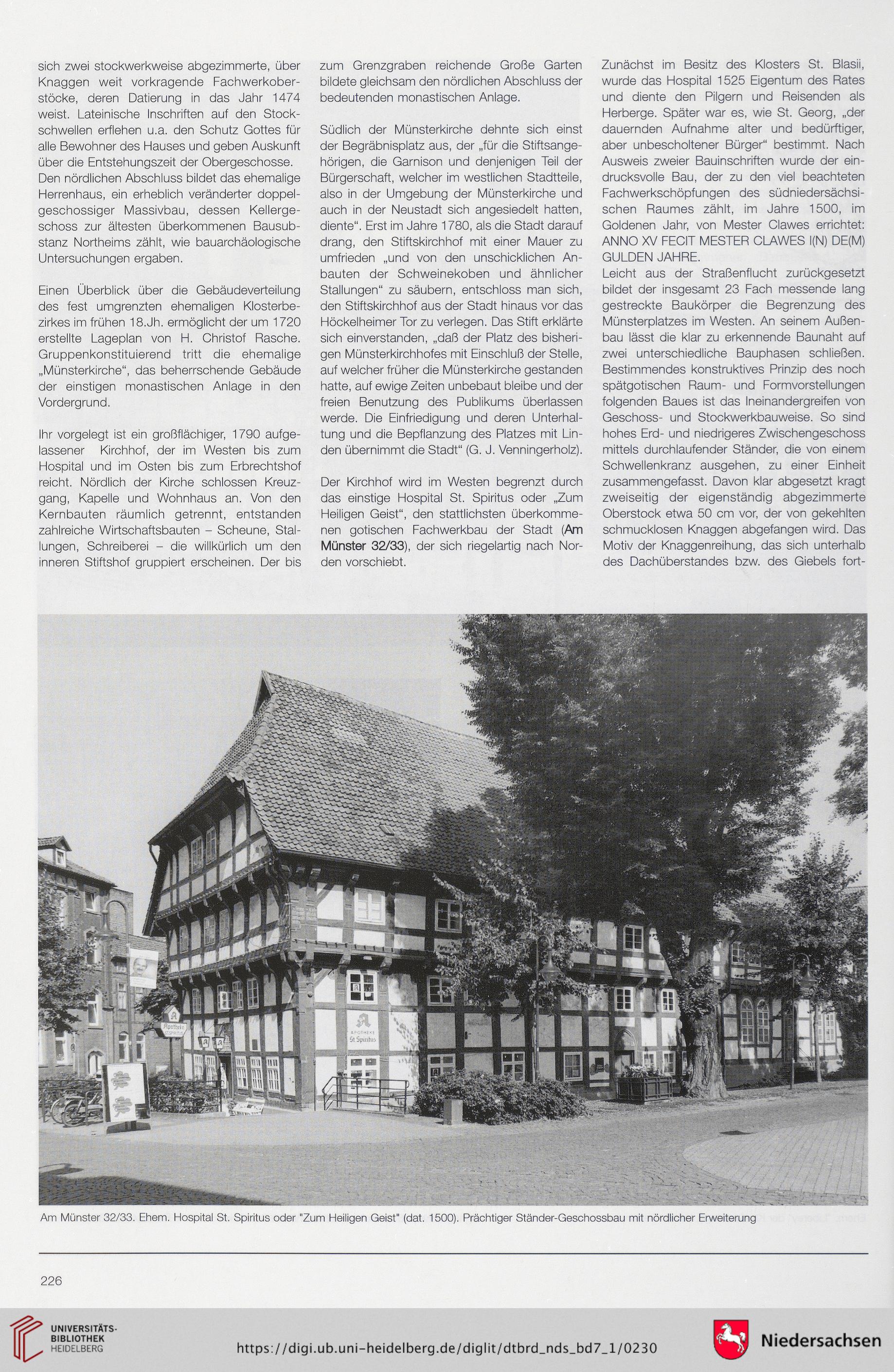sich zwei stockwerkweise abgezimmerte, über
Knaggen weit vorkragende Fachwerkober-
stöcke, deren Datierung in das Jahr 1474
weist. Lateinische Inschriften auf den Stock-
schwellen erflehen u.a. den Schutz Gottes für
alle Bewohner des Hauses und geben Auskunft
über die Entstehungszeit der Obergeschosse.
Den nördlichen Abschluss bildet das ehemalige
Herrenhaus, ein erheblich veränderter doppel-
geschossiger Massivbau, dessen Kellerge-
schoss zur ältesten überkommenen Bausub-
stanz Northeims zählt, wie bauarchäologische
Untersuchungen ergaben.
Einen Überblick über die Gebäudeverteilung
des fest umgrenzten ehemaligen Klosterbe-
zirkes im frühen 18.Jh. ermöglicht der um 1720
erstellte Lageplan von H. Christof Rasche.
Gruppenkonstituierend tritt die ehemalige
„Münsterkirche“, das beherrschende Gebäude
der einstigen monastischen Anlage in den
Vordergrund.
Ihr vorgelegt ist ein großflächiger, 1790 aufge-
lassener Kirchhof, der im Westen bis zum
Hospital und im Osten bis zum Erbrechtshof
reicht. Nördlich der Kirche schlossen Kreuz-
gang, Kapelle und Wohnhaus an. Von den
Kernbauten räumlich getrennt, entstanden
zahlreiche Wirtschaftsbauten - Scheune, Stal-
lungen, Schreiberei - die willkürlich um den
inneren Stiftshof gruppiert erscheinen. Der bis
zum Grenzgraben reichende Große Garten
bildete gleichsam den nördlichen Abschluss der
bedeutenden monastischen Anlage.
Südlich der Münsterkirche dehnte sich einst
der Begräbnisplatz aus, der „für die Stiftsange-
hörigen, die Garnison und denjenigen Teil der
Bürgerschaft, welcher im westlichen Stadtteile,
also in der Umgebung der Münsterkirche und
auch in der Neustadt sich angesiedelt hatten,
diente“. Erst im Jahre 1780, als die Stadt darauf
drang, den Stiftskirchhof mit einer Mauer zu
umfrieden „und von den unschicklichen An-
bauten der Schweinekoben und ähnlicher
Stallungen“ zu säubern, entschloss man sich,
den Stiftskirchhof aus der Stadt hinaus vor das
Höckelheimer Tor zu verlegen. Das Stift erklärte
sich einverstanden, „daß der Platz des bisheri-
gen Münsterkirchhofes mit Einschluß der Stelle,
auf welcher früher die Münsterkirche gestanden
hatte, auf ewige Zeiten unbebaut bleibe und der
freien Benutzung des Publikums überlassen
werde. Die Einfriedigung und deren Unterhal-
tung und die Bepflanzung des Platzes mit Lin-
den übernimmt die Stadt“ (G. J. Venningerholz).
Der Kirchhof wird im Westen begrenzt durch
das einstige Hospital St. Spiritus oder „Zum
Heiligen Geist“, den stattlichsten überkomme-
nen gotischen Fachwerkbau der Stadt (Am
Münster 32/33), der sich riegelartig nach Nor-
den vorschiebt.
Zunächst im Besitz des Klosters St. Blasii,
wurde das Hospital 1525 Eigentum des Rates
und diente den Pilgern und Reisenden als
Herberge. Später war es, wie St. Georg, „der
dauernden Aufnahme alter und bedürftiger,
aber unbescholtener Bürger“ bestimmt. Nach
Ausweis zweier Bauinschriften wurde der ein-
drucksvolle Bau, der zu den viel beachteten
Fachwerkschöpfungen des südniedersächsi-
schen Raumes zählt, im Jahre 1500, im
Goldenen Jahr, von Mester Clawes errichtet:
ANNO XV FECIT MESTER CtVXWES l(N) DE(M)
GULDEN JAHRE.
Leicht aus der Straßenflucht zurückgesetzt
bildet der insgesamt 23 Fach messende lang
gestreckte Baukörper die Begrenzung des
Münsterplatzes im Westen. An seinem Außen-
bau lässt die klar zu erkennende Baunaht auf
zwei unterschiedliche Bauphasen schließen.
Bestimmendes konstruktives Prinzip des noch
spätgotischen Raum- und Formvorstellungen
folgenden Baues ist das Ineinandergreifen von
Geschoss- und Stockwerkbauweise. So sind
hohes Erd- und niedrigeres Zwischengeschoss
mittels durchlaufender Ständer, die von einem
Schwellenkranz ausgehen, zu einer Einheit
zusammengefasst. Davon klar abgesetzt kragt
zweiseitig der eigenständig abgezimmerte
Oberstock etwa 50 cm vor, der von gekehlten
schmucklosen Knaggen abgefangen wird. Das
Motiv der Knaggenreihung, das sich unterhalb
des Dachüberstandes bzw. des Giebels fort-
Am Münster 32/33. Ehern. Hospital St. Spiritus oder "Zum Heiligen Geist" (dat. 1500). Prächtiger Ständer-Geschossbau mit nördlicher Erweiterung
226
Knaggen weit vorkragende Fachwerkober-
stöcke, deren Datierung in das Jahr 1474
weist. Lateinische Inschriften auf den Stock-
schwellen erflehen u.a. den Schutz Gottes für
alle Bewohner des Hauses und geben Auskunft
über die Entstehungszeit der Obergeschosse.
Den nördlichen Abschluss bildet das ehemalige
Herrenhaus, ein erheblich veränderter doppel-
geschossiger Massivbau, dessen Kellerge-
schoss zur ältesten überkommenen Bausub-
stanz Northeims zählt, wie bauarchäologische
Untersuchungen ergaben.
Einen Überblick über die Gebäudeverteilung
des fest umgrenzten ehemaligen Klosterbe-
zirkes im frühen 18.Jh. ermöglicht der um 1720
erstellte Lageplan von H. Christof Rasche.
Gruppenkonstituierend tritt die ehemalige
„Münsterkirche“, das beherrschende Gebäude
der einstigen monastischen Anlage in den
Vordergrund.
Ihr vorgelegt ist ein großflächiger, 1790 aufge-
lassener Kirchhof, der im Westen bis zum
Hospital und im Osten bis zum Erbrechtshof
reicht. Nördlich der Kirche schlossen Kreuz-
gang, Kapelle und Wohnhaus an. Von den
Kernbauten räumlich getrennt, entstanden
zahlreiche Wirtschaftsbauten - Scheune, Stal-
lungen, Schreiberei - die willkürlich um den
inneren Stiftshof gruppiert erscheinen. Der bis
zum Grenzgraben reichende Große Garten
bildete gleichsam den nördlichen Abschluss der
bedeutenden monastischen Anlage.
Südlich der Münsterkirche dehnte sich einst
der Begräbnisplatz aus, der „für die Stiftsange-
hörigen, die Garnison und denjenigen Teil der
Bürgerschaft, welcher im westlichen Stadtteile,
also in der Umgebung der Münsterkirche und
auch in der Neustadt sich angesiedelt hatten,
diente“. Erst im Jahre 1780, als die Stadt darauf
drang, den Stiftskirchhof mit einer Mauer zu
umfrieden „und von den unschicklichen An-
bauten der Schweinekoben und ähnlicher
Stallungen“ zu säubern, entschloss man sich,
den Stiftskirchhof aus der Stadt hinaus vor das
Höckelheimer Tor zu verlegen. Das Stift erklärte
sich einverstanden, „daß der Platz des bisheri-
gen Münsterkirchhofes mit Einschluß der Stelle,
auf welcher früher die Münsterkirche gestanden
hatte, auf ewige Zeiten unbebaut bleibe und der
freien Benutzung des Publikums überlassen
werde. Die Einfriedigung und deren Unterhal-
tung und die Bepflanzung des Platzes mit Lin-
den übernimmt die Stadt“ (G. J. Venningerholz).
Der Kirchhof wird im Westen begrenzt durch
das einstige Hospital St. Spiritus oder „Zum
Heiligen Geist“, den stattlichsten überkomme-
nen gotischen Fachwerkbau der Stadt (Am
Münster 32/33), der sich riegelartig nach Nor-
den vorschiebt.
Zunächst im Besitz des Klosters St. Blasii,
wurde das Hospital 1525 Eigentum des Rates
und diente den Pilgern und Reisenden als
Herberge. Später war es, wie St. Georg, „der
dauernden Aufnahme alter und bedürftiger,
aber unbescholtener Bürger“ bestimmt. Nach
Ausweis zweier Bauinschriften wurde der ein-
drucksvolle Bau, der zu den viel beachteten
Fachwerkschöpfungen des südniedersächsi-
schen Raumes zählt, im Jahre 1500, im
Goldenen Jahr, von Mester Clawes errichtet:
ANNO XV FECIT MESTER CtVXWES l(N) DE(M)
GULDEN JAHRE.
Leicht aus der Straßenflucht zurückgesetzt
bildet der insgesamt 23 Fach messende lang
gestreckte Baukörper die Begrenzung des
Münsterplatzes im Westen. An seinem Außen-
bau lässt die klar zu erkennende Baunaht auf
zwei unterschiedliche Bauphasen schließen.
Bestimmendes konstruktives Prinzip des noch
spätgotischen Raum- und Formvorstellungen
folgenden Baues ist das Ineinandergreifen von
Geschoss- und Stockwerkbauweise. So sind
hohes Erd- und niedrigeres Zwischengeschoss
mittels durchlaufender Ständer, die von einem
Schwellenkranz ausgehen, zu einer Einheit
zusammengefasst. Davon klar abgesetzt kragt
zweiseitig der eigenständig abgezimmerte
Oberstock etwa 50 cm vor, der von gekehlten
schmucklosen Knaggen abgefangen wird. Das
Motiv der Knaggenreihung, das sich unterhalb
des Dachüberstandes bzw. des Giebels fort-
Am Münster 32/33. Ehern. Hospital St. Spiritus oder "Zum Heiligen Geist" (dat. 1500). Prächtiger Ständer-Geschossbau mit nördlicher Erweiterung
226