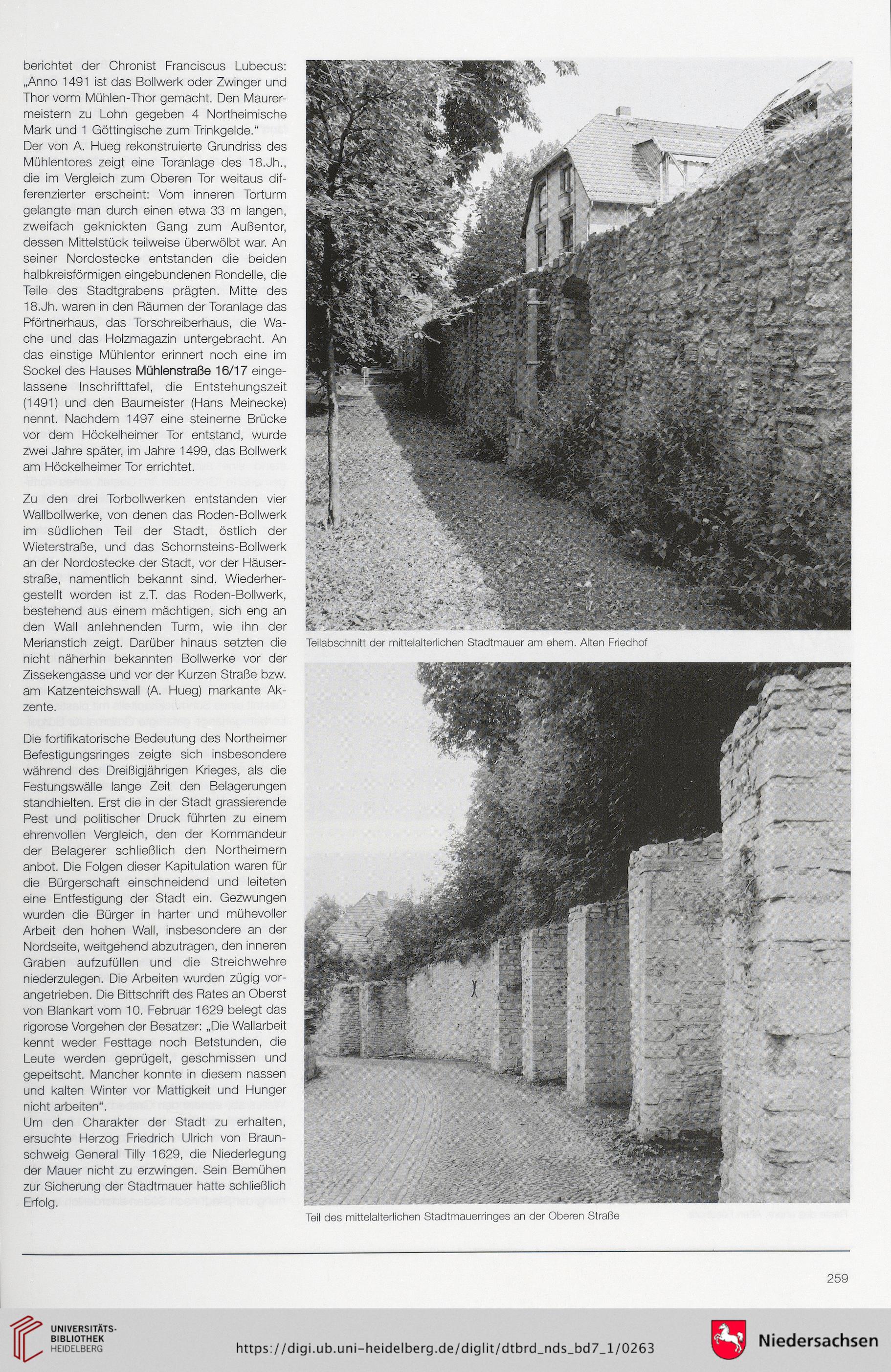berichtet der Chronist Franciscus Lubecus:
„Anno 1491 ist das Bollwerk oder Zwinger und
Thor vorm Mühlen-Thor gemacht. Den Maurer-
meistern zu Lohn gegeben 4 Northeimische
Mark und 1 Göttingische zum Trinkgelde.“
Der von A. Hueg rekonstruierte Grundriss des
Mühlentores zeigt eine Toranlage des 18.Jh.,
die im Vergleich zum Oberen Tor weitaus dif-
ferenzierter erscheint: Vom inneren Torturm
gelangte man durch einen etwa 33 m langen,
zweifach geknickten Gang zum Außentor,
dessen Mittelstück teilweise überwölbt war. An
seiner Nordostecke entstanden die beiden
halbkreisförmigen eingebundenen Rondelle, die
Teile des Stadtgrabens prägten. Mitte des
18.Jh. waren in den Räumen der Toranlage das
Pförtnerhaus, das Torschreiberhaus, die Wa-
che und das Holzmagazin untergebracht. An
das einstige Mühlentor erinnert noch eine im
Sockel des Hauses Mühlenstraße 16/17 einge-
lassene Inschrifttafel, die Entstehungszeit
(1491) und den Baumeister (Hans Meinecke)
nennt. Nachdem 1497 eine steinerne Brücke
vor dem Höckelheimer Tor entstand, wurde
zwei Jahre später, im Jahre 1499, das Bollwerk
am Höckelheimer Tor errichtet.
Zu den drei Torbollwerken entstanden vier
Wallbollwerke, von denen das Roden-Bollwerk
im südlichen Teil der Stadt, östlich der
Wieterstraße, und das Schornsteins-Bollwerk
an der Nordostecke der Stadt, vor der Häuser-
straße, namentlich bekannt sind. Wiederher-
gestellt worden ist z.T. das Roden-Bollwerk,
bestehend aus einem mächtigen, sich eng an
den Wall anlehnenden Turm, wie ihn der
Merianstich zeigt. Darüber hinaus setzten die
nicht näherhin bekannten Bollwerke vor der
Zissekengasse und vor der Kurzen Straße bzw.
am Katzenteichswall (A. Hueg) markante Ak-
zente.
Die fortifikatorische Bedeutung des Northeimer
Befestigungsringes zeigte sich insbesondere
während des Dreißigjährigen Krieges, als die
Festungswälle lange Zeit den Belagerungen
standhielten. Erst die in der Stadt grassierende
Pest und politischer Druck führten zu einem
ehrenvollen Vergleich, den der Kommandeur
der Belagerer schließlich den Northeimern
anbot. Die Folgen dieser Kapitulation waren für
die Bürgerschaft einschneidend und leiteten
eine Entfestigung der Stadt ein. Gezwungen
wurden die Bürger in harter und mühevoller
Arbeit den hohen Wall, insbesondere an der
Nordseite, weitgehend abzutragen, den inneren
Graben aufzufüllen und die Streichwehre
niederzulegen. Die Arbeiten wurden zügig vor-
angetrieben. Die Bittschrift des Rates an Oberst
von Blankart vom 10. Februar 1629 belegt das
rigorose Vorgehen der Besatzer: „Die Wallarbeit
kennt weder Festtage noch Betstunden, die
Leute werden geprügelt, geschmissen und
gepeitscht. Mancher konnte in diesem nassen
und kalten Winter vor Mattigkeit und Hunger
nicht arbeiten“.
Um den Charakter der Stadt zu erhalten,
ersuchte Herzog Friedrich Ulrich von Braun-
schweig General Tilly 1629, die Niederlegung
der Mauer nicht zu erzwingen. Sein Bemühen
zur Sicherung der Stadtmauer hatte schließlich
Erfolg.
Teilabschnitt der mittelalterlichen Stadtmauer am ehern. Alten Friedhof
Teil des mittelalterlichen Stadtmauerringes an der Oberen Straße
259
„Anno 1491 ist das Bollwerk oder Zwinger und
Thor vorm Mühlen-Thor gemacht. Den Maurer-
meistern zu Lohn gegeben 4 Northeimische
Mark und 1 Göttingische zum Trinkgelde.“
Der von A. Hueg rekonstruierte Grundriss des
Mühlentores zeigt eine Toranlage des 18.Jh.,
die im Vergleich zum Oberen Tor weitaus dif-
ferenzierter erscheint: Vom inneren Torturm
gelangte man durch einen etwa 33 m langen,
zweifach geknickten Gang zum Außentor,
dessen Mittelstück teilweise überwölbt war. An
seiner Nordostecke entstanden die beiden
halbkreisförmigen eingebundenen Rondelle, die
Teile des Stadtgrabens prägten. Mitte des
18.Jh. waren in den Räumen der Toranlage das
Pförtnerhaus, das Torschreiberhaus, die Wa-
che und das Holzmagazin untergebracht. An
das einstige Mühlentor erinnert noch eine im
Sockel des Hauses Mühlenstraße 16/17 einge-
lassene Inschrifttafel, die Entstehungszeit
(1491) und den Baumeister (Hans Meinecke)
nennt. Nachdem 1497 eine steinerne Brücke
vor dem Höckelheimer Tor entstand, wurde
zwei Jahre später, im Jahre 1499, das Bollwerk
am Höckelheimer Tor errichtet.
Zu den drei Torbollwerken entstanden vier
Wallbollwerke, von denen das Roden-Bollwerk
im südlichen Teil der Stadt, östlich der
Wieterstraße, und das Schornsteins-Bollwerk
an der Nordostecke der Stadt, vor der Häuser-
straße, namentlich bekannt sind. Wiederher-
gestellt worden ist z.T. das Roden-Bollwerk,
bestehend aus einem mächtigen, sich eng an
den Wall anlehnenden Turm, wie ihn der
Merianstich zeigt. Darüber hinaus setzten die
nicht näherhin bekannten Bollwerke vor der
Zissekengasse und vor der Kurzen Straße bzw.
am Katzenteichswall (A. Hueg) markante Ak-
zente.
Die fortifikatorische Bedeutung des Northeimer
Befestigungsringes zeigte sich insbesondere
während des Dreißigjährigen Krieges, als die
Festungswälle lange Zeit den Belagerungen
standhielten. Erst die in der Stadt grassierende
Pest und politischer Druck führten zu einem
ehrenvollen Vergleich, den der Kommandeur
der Belagerer schließlich den Northeimern
anbot. Die Folgen dieser Kapitulation waren für
die Bürgerschaft einschneidend und leiteten
eine Entfestigung der Stadt ein. Gezwungen
wurden die Bürger in harter und mühevoller
Arbeit den hohen Wall, insbesondere an der
Nordseite, weitgehend abzutragen, den inneren
Graben aufzufüllen und die Streichwehre
niederzulegen. Die Arbeiten wurden zügig vor-
angetrieben. Die Bittschrift des Rates an Oberst
von Blankart vom 10. Februar 1629 belegt das
rigorose Vorgehen der Besatzer: „Die Wallarbeit
kennt weder Festtage noch Betstunden, die
Leute werden geprügelt, geschmissen und
gepeitscht. Mancher konnte in diesem nassen
und kalten Winter vor Mattigkeit und Hunger
nicht arbeiten“.
Um den Charakter der Stadt zu erhalten,
ersuchte Herzog Friedrich Ulrich von Braun-
schweig General Tilly 1629, die Niederlegung
der Mauer nicht zu erzwingen. Sein Bemühen
zur Sicherung der Stadtmauer hatte schließlich
Erfolg.
Teilabschnitt der mittelalterlichen Stadtmauer am ehern. Alten Friedhof
Teil des mittelalterlichen Stadtmauerringes an der Oberen Straße
259