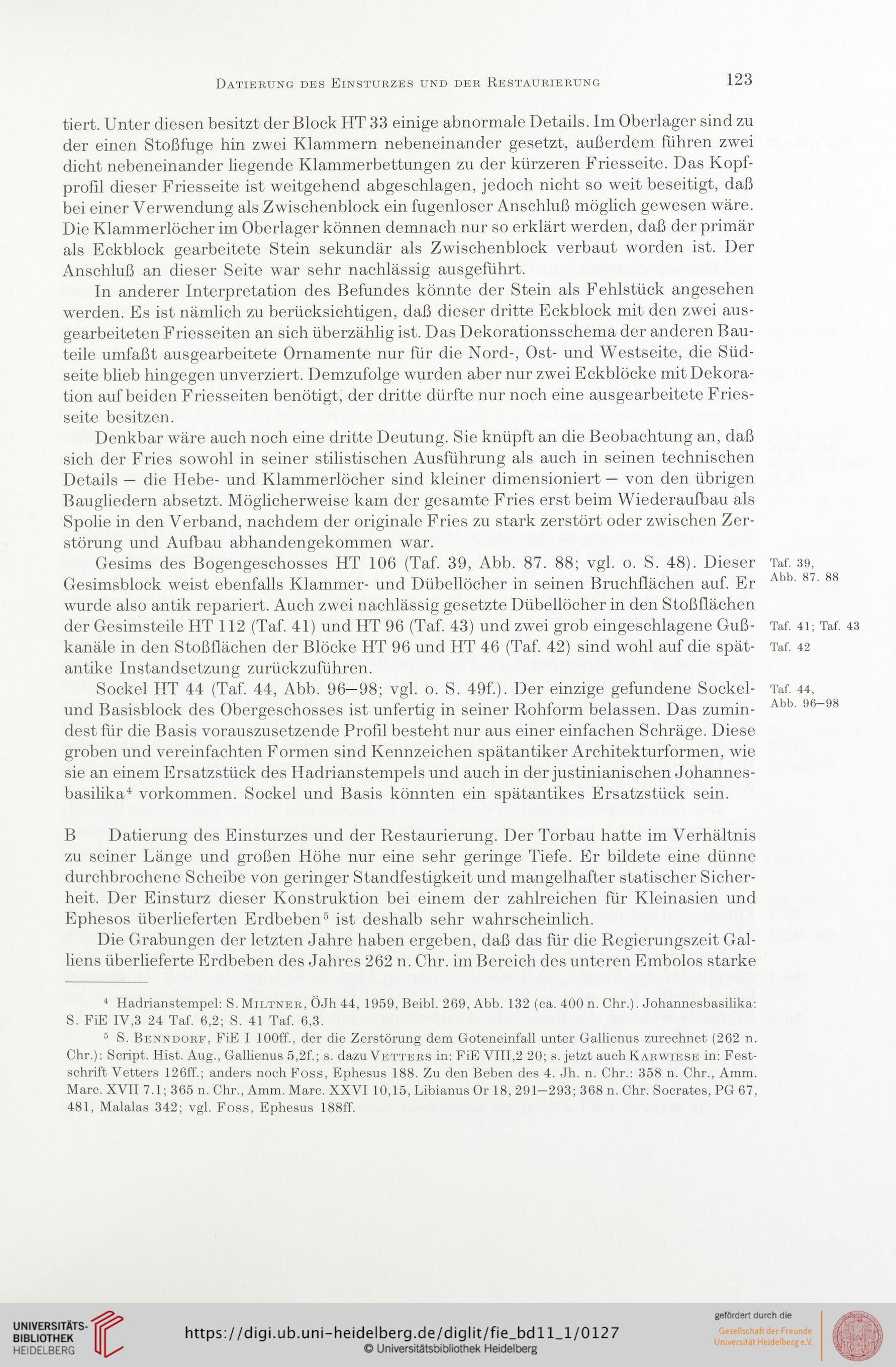Datierung des Einsturzes und der Restaurierung
123
tiert. Unter diesen besitzt der Block HT 33 einige abnormale Details. Im Oberlager sind zu
der einen Stoßfuge hin zwei Klammern nebeneinander gesetzt, außerdem führen zwei
dicht nebeneinander liegende Klammerbettungen zu der kürzeren Friesseite. Das Kopf-
profil dieser Friesseite ist weitgehend abgeschlagen, jedoch nicht so weit beseitigt, daß
bei einer Verwendung als Zwischenblock ein fugenloser Anschluß möglich gewesen wäre.
Die Klammerlöcher im Oberlager können demnach nur so erklärt werden, daß der primär
als Eckblock gearbeitete Stein sekundär als Zwischenblock verbaut worden ist. Der
Anschluß an dieser Seite war sehr nachlässig ausgeführt.
In anderer Interpretation des Befundes könnte der Stein als Fehlstück angesehen
werden. Es ist nämlich zu berücksichtigen, daß dieser dritte Eckblock mit den zwei aus-
gearbeiteten Friesseiten an sich überzählig ist. Das Dekorationsschema der anderen Bau-
teile umfaßt ausgearbeitete Ornamente nur für die Nord-, Ost- und Westseite, die Süd-
seite blieb hingegen unverziert. Demzufolge wurden aber nur zwei Eckblöcke mit Dekora-
tion auf beiden Friesseiten benötigt, der dritte dürfte nur noch eine ausgearbeitete Fries-
seite besitzen.
Denkbar wäre auch noch eine dritte Deutung. Sie knüpft an die Beobachtung an, daß
sich der Fries sowohl in seiner stilistischen Ausführung als auch in seinen technischen
Details — die Hebe- und Klammerlöcher sind kleiner dimensioniert — von den übrigen
Baugliedern absetzt. Möglicherweise kam der gesamte Fries erst beim Wiederaufbau als
Spolie in den Verband, nachdem der originale Fries zu stark zerstört oder zwischen Zer-
störung und Aufbau abhandengekommen war.
Gesims des Bogengeschosses HT 106 (Taf. 39, Abb. 87. 88; vgl. o. S. 48). Dieser Taf. 39,
Gesimsblock weist ebenfalls Klammer- und Dübellöcher in seinen Bruchflächen auf. Er Abb' 8/ 88
wurde also antik repariert. Auch zwei nachlässig gesetzte Dübellöcher in den Stoßflächen
der Gesimsteile HT 112 (Taf. 41) und HT 96 (Taf. 43) und zwei grob eingeschlagene Guß-
kanäle in den Stoßflächen der Blöcke HT 96 und HT 46 (Taf. 42) sind wohl auf die spät-
antike Instandsetzung zurückzuführen.
Sockel HT 44 (Taf. 44, Abb. 96—98; vgl. o. S. 49f.). Der einzige gefundene Sockel-
und Basisblock des Obergeschosses ist unfertig in seiner Rohform belassen. Das zumin-
dest für die Basis vorauszusetzende Profil besteht nur aus einer einfachen Schräge. Diese
groben und vereinfachten Formen sind Kennzeichen spätantiker Architekturformen, wie
sie an einem Ersatzstück des Hadrianstempels und auch in der justinianischen Johannes-
basilika4 vorkommen. Sockel und Basis könnten ein spätantikes Ersatzstück sein.
Taf. 41; Taf. 43
Taf. 42
Taf. 44,
Abb. 96-98
B Datierung des Einsturzes und der Restaurierung. Der Torbau hatte im Verhältnis
zu seiner Länge und großen Höhe nur eine sehr geringe Tiefe. Er bildete eine dünne
durchbrochene Scheibe von geringer Standfestigkeit und mangelhafter statischer Sicher-
heit. Der Einsturz dieser Konstruktion bei einem der zahlreichen für Kleinasien und
Ephesos überlieferten Erdbeben5 ist deshalb sehr wahrscheinlich.
Die Grabungen der letzten Jahre haben ergeben, daß das für die Regierungszeit Gal-
liens überlieferte Erdbeben des Jahres 262 n. Chr. im Bereich des unteren Embolos starke
4 Hadrianstempel: S. Miltner, ÖJh 44, 1959, Beibl. 269, Abb. 132 (ca. 400 n. Chr.). Johannesbasilika:
S. FiE IV,3 24 Taf. 6,2; S. 41 Taf. 6,3.
5 S. Benndorf, FiE I lOOff., der die Zerstörung dem Goteneinfall unter Gallienus zurechnet (262 n.
Chr.): Script. Hist. Aug., Gallienus 5,2f.; s. dazu Vetters in: FiE VIII,2 20; s. jetzt auch Karwiese in: Fest-
schrift Vetters 126ff.; anders noch Foss, Ephesus 188. Zu den Beben des 4. Jh. n. Chr.: 358 n. Chr., Amm.
Marc. XVII 7.1; 365 n. Chr., Amm. Marc. XXVI 10,15, Libianus Or 18, 291-293; 368 n. Chr. Socrates, PG 67,
481, Malalas 342; vgl. Foss, Ephesus 188ff.
123
tiert. Unter diesen besitzt der Block HT 33 einige abnormale Details. Im Oberlager sind zu
der einen Stoßfuge hin zwei Klammern nebeneinander gesetzt, außerdem führen zwei
dicht nebeneinander liegende Klammerbettungen zu der kürzeren Friesseite. Das Kopf-
profil dieser Friesseite ist weitgehend abgeschlagen, jedoch nicht so weit beseitigt, daß
bei einer Verwendung als Zwischenblock ein fugenloser Anschluß möglich gewesen wäre.
Die Klammerlöcher im Oberlager können demnach nur so erklärt werden, daß der primär
als Eckblock gearbeitete Stein sekundär als Zwischenblock verbaut worden ist. Der
Anschluß an dieser Seite war sehr nachlässig ausgeführt.
In anderer Interpretation des Befundes könnte der Stein als Fehlstück angesehen
werden. Es ist nämlich zu berücksichtigen, daß dieser dritte Eckblock mit den zwei aus-
gearbeiteten Friesseiten an sich überzählig ist. Das Dekorationsschema der anderen Bau-
teile umfaßt ausgearbeitete Ornamente nur für die Nord-, Ost- und Westseite, die Süd-
seite blieb hingegen unverziert. Demzufolge wurden aber nur zwei Eckblöcke mit Dekora-
tion auf beiden Friesseiten benötigt, der dritte dürfte nur noch eine ausgearbeitete Fries-
seite besitzen.
Denkbar wäre auch noch eine dritte Deutung. Sie knüpft an die Beobachtung an, daß
sich der Fries sowohl in seiner stilistischen Ausführung als auch in seinen technischen
Details — die Hebe- und Klammerlöcher sind kleiner dimensioniert — von den übrigen
Baugliedern absetzt. Möglicherweise kam der gesamte Fries erst beim Wiederaufbau als
Spolie in den Verband, nachdem der originale Fries zu stark zerstört oder zwischen Zer-
störung und Aufbau abhandengekommen war.
Gesims des Bogengeschosses HT 106 (Taf. 39, Abb. 87. 88; vgl. o. S. 48). Dieser Taf. 39,
Gesimsblock weist ebenfalls Klammer- und Dübellöcher in seinen Bruchflächen auf. Er Abb' 8/ 88
wurde also antik repariert. Auch zwei nachlässig gesetzte Dübellöcher in den Stoßflächen
der Gesimsteile HT 112 (Taf. 41) und HT 96 (Taf. 43) und zwei grob eingeschlagene Guß-
kanäle in den Stoßflächen der Blöcke HT 96 und HT 46 (Taf. 42) sind wohl auf die spät-
antike Instandsetzung zurückzuführen.
Sockel HT 44 (Taf. 44, Abb. 96—98; vgl. o. S. 49f.). Der einzige gefundene Sockel-
und Basisblock des Obergeschosses ist unfertig in seiner Rohform belassen. Das zumin-
dest für die Basis vorauszusetzende Profil besteht nur aus einer einfachen Schräge. Diese
groben und vereinfachten Formen sind Kennzeichen spätantiker Architekturformen, wie
sie an einem Ersatzstück des Hadrianstempels und auch in der justinianischen Johannes-
basilika4 vorkommen. Sockel und Basis könnten ein spätantikes Ersatzstück sein.
Taf. 41; Taf. 43
Taf. 42
Taf. 44,
Abb. 96-98
B Datierung des Einsturzes und der Restaurierung. Der Torbau hatte im Verhältnis
zu seiner Länge und großen Höhe nur eine sehr geringe Tiefe. Er bildete eine dünne
durchbrochene Scheibe von geringer Standfestigkeit und mangelhafter statischer Sicher-
heit. Der Einsturz dieser Konstruktion bei einem der zahlreichen für Kleinasien und
Ephesos überlieferten Erdbeben5 ist deshalb sehr wahrscheinlich.
Die Grabungen der letzten Jahre haben ergeben, daß das für die Regierungszeit Gal-
liens überlieferte Erdbeben des Jahres 262 n. Chr. im Bereich des unteren Embolos starke
4 Hadrianstempel: S. Miltner, ÖJh 44, 1959, Beibl. 269, Abb. 132 (ca. 400 n. Chr.). Johannesbasilika:
S. FiE IV,3 24 Taf. 6,2; S. 41 Taf. 6,3.
5 S. Benndorf, FiE I lOOff., der die Zerstörung dem Goteneinfall unter Gallienus zurechnet (262 n.
Chr.): Script. Hist. Aug., Gallienus 5,2f.; s. dazu Vetters in: FiE VIII,2 20; s. jetzt auch Karwiese in: Fest-
schrift Vetters 126ff.; anders noch Foss, Ephesus 188. Zu den Beben des 4. Jh. n. Chr.: 358 n. Chr., Amm.
Marc. XVII 7.1; 365 n. Chr., Amm. Marc. XXVI 10,15, Libianus Or 18, 291-293; 368 n. Chr. Socrates, PG 67,
481, Malalas 342; vgl. Foss, Ephesus 188ff.