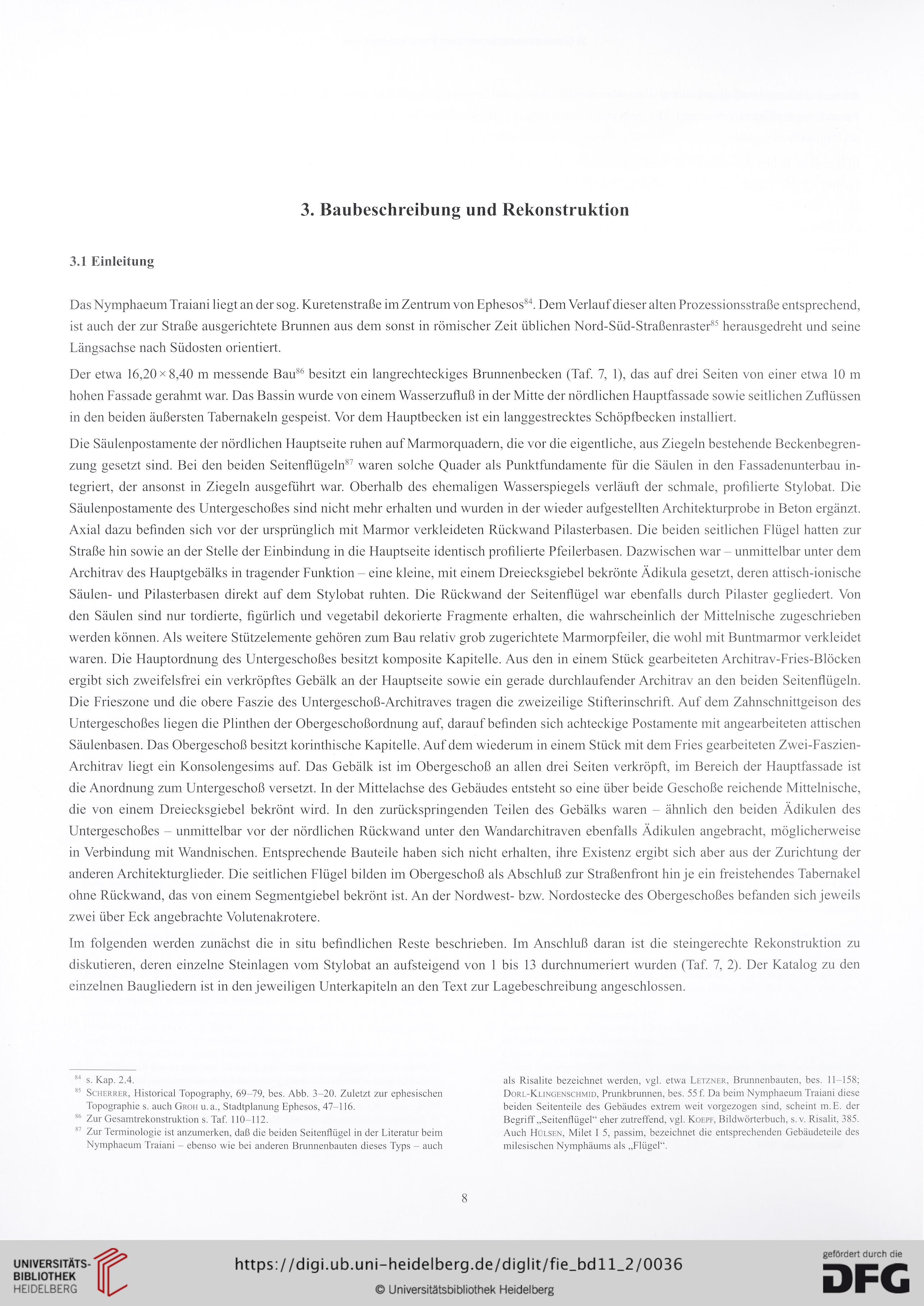3. Baubeschreibung und Rekonstruktion
3.1 Einleitung
Das Nymphaeum Traiani liegt an der sog. Kuretenstraße im Zentrum von Ephesos84. Dem Verlauf dieser alten Prozessionsstraße entsprechend,
ist auch der zur Straße ausgerichtete Brunnen aus dem sonst in römischer Zeit üblichen Nord-Süd-Straßenraster85 herausgedreht und seine
Längsachse nach Südosten orientiert.
Der etwa 16,20 x 8,40 m messende Bau86 besitzt ein langrechteckiges Brunnenbecken (Taf. 7, 1), das auf drei Seiten von einer etwa 10 m
hohen Fassade gerahmt war. Das Bassin wurde von einem Wasserzufluß in der Mitte der nördlichen Hauptfassade sowie seitlichen Zuflüssen
in den beiden äußersten Tabernakeln gespeist. Vor dem Hauptbecken ist ein langgestrecktes Schöpfbecken installiert.
Die Säulenpostamente der nördlichen Hauptseite ruhen auf Marmorquadern, die vor die eigentliche, aus Ziegeln bestehende Beckenbegren-
zung gesetzt sind. Bei den beiden Seitenflügeln87 waren solche Quader als Punktfundamente für die Säulen in den Fassadenunterbau in-
tegriert, der ansonst in Ziegeln ausgeführt war. Oberhalb des ehemaligen Wasserspiegels verläuft der schmale, profilierte Stylobat. Die
Säulenpostamente des Untergeschoßes sind nicht mehr erhalten und wurden in der wieder aufgestellten Architekturprobe in Beton ergänzt.
Axial dazu befinden sich vor der ursprünglich mit Marmor verkleideten Rückwand Pilasterbasen. Die beiden seitlichen Flügel hatten zur
Straße hin sowie an der Stelle der Einbindung in die Hauptseite identisch profilierte Pfeilerbasen. Dazwischen war - unmittelbar unter dem
Architrav des Hauptgebälks in tragender Funktion - eine kleine, mit einem Dreiecksgiebel bekrönte Ädikula gesetzt, deren attisch-ionische
Säulen- und Pilasterbasen direkt auf dem Stylobat ruhten. Die Rückwand der Seitenflügel war ebenfalls durch Pilaster gegliedert. Von
den Säulen sind nur tordierte, figürlich und vegetabil dekorierte Fragmente erhalten, die wahrscheinlich der Mittelnische zugeschrieben
werden können. Als weitere Stützelemente gehören zum Bau relativ grob zugerichtete Marmorpfeiler, die wohl mit Buntmarmor verkleidet
waren. Die Hauptordnung des Untergeschoßes besitzt komposite Kapitelle. Aus den in einem Stück gearbeiteten Architrav-Fries-Blöcken
ergibt sich zweifelsfrei ein verkröpftes Gebälk an der Hauptseite sowie ein gerade durchlaufender Architrav an den beiden Seitenflügeln.
Die Frieszone und die obere Faszie des Untergeschoß-Architraves tragen die zweizeilige Stifterinschrift. Auf dem Zahnschnittgeison des
Untergeschoßes liegen die Plinthen der Obergeschoßordnung auf, darauf befinden sich achteckige Postamente mit angearbeiteten attischen
Säulenbasen. Das Obergeschoß besitzt korinthische Kapitelle. Auf dem wiederum in einem Stück mit dem Fries gearbeiteten Zwei-Faszien-
Architrav liegt ein Konsolengesims auf. Das Gebälk ist im Obergeschoß an allen drei Seiten verkröpft, im Bereich der Hauptfassade ist
die Anordnung zum Untergeschoß versetzt. In der Mittelachse des Gebäudes entsteht so eine über beide Geschoße reichende Mittelnische,
die von einem Dreiecksgiebel bekrönt wird. In den zurückspringenden Teilen des Gebälks waren - ähnlich den beiden Ädikulen des
Untergeschoßes - unmittelbar vor der nördlichen Rückwand unter den Wandarchitraven ebenfalls Ädikulen angebracht, möglicherweise
in Verbindung mit Wandnischen. Entsprechende Bauteile haben sich nicht erhalten, ihre Existenz ergibt sich aber aus der Zurichtung der
anderen Architekturglieder. Die seitlichen Flügel bilden im Obergeschoß als Abschluß zur Straßenfront hin je ein freistehendes Tabernakel
ohne Rückwand, das von einem Segmentgiebel bekrönt ist. An der Nordwest- bzw. Nordostecke des Obergeschoßes befanden sich jeweils
zwei über Eck angebrachte Volutenakrotere.
Im folgenden werden zunächst die in situ befindlichen Reste beschrieben. Im Anschluß daran ist die steingerechte Rekonstruktion zu
diskutieren, deren einzelne Steinlagen vom Stylobat an aufsteigend von 1 bis 13 durchnumeriert wurden (Taf. 7, 2). Der Katalog zu den
einzelnen Baugliedem ist in den jeweiligen Unterkapiteln an den Text zur Lagebeschreibung angeschlossen.
84 s. Kap. 2.4.
85 Scherrer, Historical Topography, 69-79, bes. Abb. 3-20. Zuletzt zur ephesischen
Topographie s. auch Groh u. a„ Stadtplanung Ephesos, 47-116.
86 Zur Gesamtrekonstruktion s. Taf. 110-112.
87 Zur Terminologie ist anzumerken, daß die beiden Seitenflügel in der Literatur beim
Nymphaeum Traiani - ebenso wie bei anderen Brunnenbauten dieses Typs - auch
als Risalite bezeichnet werden, vgl. etwa Letzner, Brunnenbauten, bes. 11-158;
Dorl-Klingenschmid, Prunkbrunnen, bes. 55 f. Da beim Nymphaeum Traiani diese
beiden Seitenteile des Gebäudes extrem weit vorgezogen sind, scheint m.E. der
Begriff „Seitenflügel“ eher zutreffend, vgl. Koepf, Bildwörterbuch, s. v. Risalit, 385.
Auch Hülsen, Milet I 5, passim, bezeichnet die entsprechenden Gebäudeteile des
milesischen Nymphäums als „Flügel“.
8
3.1 Einleitung
Das Nymphaeum Traiani liegt an der sog. Kuretenstraße im Zentrum von Ephesos84. Dem Verlauf dieser alten Prozessionsstraße entsprechend,
ist auch der zur Straße ausgerichtete Brunnen aus dem sonst in römischer Zeit üblichen Nord-Süd-Straßenraster85 herausgedreht und seine
Längsachse nach Südosten orientiert.
Der etwa 16,20 x 8,40 m messende Bau86 besitzt ein langrechteckiges Brunnenbecken (Taf. 7, 1), das auf drei Seiten von einer etwa 10 m
hohen Fassade gerahmt war. Das Bassin wurde von einem Wasserzufluß in der Mitte der nördlichen Hauptfassade sowie seitlichen Zuflüssen
in den beiden äußersten Tabernakeln gespeist. Vor dem Hauptbecken ist ein langgestrecktes Schöpfbecken installiert.
Die Säulenpostamente der nördlichen Hauptseite ruhen auf Marmorquadern, die vor die eigentliche, aus Ziegeln bestehende Beckenbegren-
zung gesetzt sind. Bei den beiden Seitenflügeln87 waren solche Quader als Punktfundamente für die Säulen in den Fassadenunterbau in-
tegriert, der ansonst in Ziegeln ausgeführt war. Oberhalb des ehemaligen Wasserspiegels verläuft der schmale, profilierte Stylobat. Die
Säulenpostamente des Untergeschoßes sind nicht mehr erhalten und wurden in der wieder aufgestellten Architekturprobe in Beton ergänzt.
Axial dazu befinden sich vor der ursprünglich mit Marmor verkleideten Rückwand Pilasterbasen. Die beiden seitlichen Flügel hatten zur
Straße hin sowie an der Stelle der Einbindung in die Hauptseite identisch profilierte Pfeilerbasen. Dazwischen war - unmittelbar unter dem
Architrav des Hauptgebälks in tragender Funktion - eine kleine, mit einem Dreiecksgiebel bekrönte Ädikula gesetzt, deren attisch-ionische
Säulen- und Pilasterbasen direkt auf dem Stylobat ruhten. Die Rückwand der Seitenflügel war ebenfalls durch Pilaster gegliedert. Von
den Säulen sind nur tordierte, figürlich und vegetabil dekorierte Fragmente erhalten, die wahrscheinlich der Mittelnische zugeschrieben
werden können. Als weitere Stützelemente gehören zum Bau relativ grob zugerichtete Marmorpfeiler, die wohl mit Buntmarmor verkleidet
waren. Die Hauptordnung des Untergeschoßes besitzt komposite Kapitelle. Aus den in einem Stück gearbeiteten Architrav-Fries-Blöcken
ergibt sich zweifelsfrei ein verkröpftes Gebälk an der Hauptseite sowie ein gerade durchlaufender Architrav an den beiden Seitenflügeln.
Die Frieszone und die obere Faszie des Untergeschoß-Architraves tragen die zweizeilige Stifterinschrift. Auf dem Zahnschnittgeison des
Untergeschoßes liegen die Plinthen der Obergeschoßordnung auf, darauf befinden sich achteckige Postamente mit angearbeiteten attischen
Säulenbasen. Das Obergeschoß besitzt korinthische Kapitelle. Auf dem wiederum in einem Stück mit dem Fries gearbeiteten Zwei-Faszien-
Architrav liegt ein Konsolengesims auf. Das Gebälk ist im Obergeschoß an allen drei Seiten verkröpft, im Bereich der Hauptfassade ist
die Anordnung zum Untergeschoß versetzt. In der Mittelachse des Gebäudes entsteht so eine über beide Geschoße reichende Mittelnische,
die von einem Dreiecksgiebel bekrönt wird. In den zurückspringenden Teilen des Gebälks waren - ähnlich den beiden Ädikulen des
Untergeschoßes - unmittelbar vor der nördlichen Rückwand unter den Wandarchitraven ebenfalls Ädikulen angebracht, möglicherweise
in Verbindung mit Wandnischen. Entsprechende Bauteile haben sich nicht erhalten, ihre Existenz ergibt sich aber aus der Zurichtung der
anderen Architekturglieder. Die seitlichen Flügel bilden im Obergeschoß als Abschluß zur Straßenfront hin je ein freistehendes Tabernakel
ohne Rückwand, das von einem Segmentgiebel bekrönt ist. An der Nordwest- bzw. Nordostecke des Obergeschoßes befanden sich jeweils
zwei über Eck angebrachte Volutenakrotere.
Im folgenden werden zunächst die in situ befindlichen Reste beschrieben. Im Anschluß daran ist die steingerechte Rekonstruktion zu
diskutieren, deren einzelne Steinlagen vom Stylobat an aufsteigend von 1 bis 13 durchnumeriert wurden (Taf. 7, 2). Der Katalog zu den
einzelnen Baugliedem ist in den jeweiligen Unterkapiteln an den Text zur Lagebeschreibung angeschlossen.
84 s. Kap. 2.4.
85 Scherrer, Historical Topography, 69-79, bes. Abb. 3-20. Zuletzt zur ephesischen
Topographie s. auch Groh u. a„ Stadtplanung Ephesos, 47-116.
86 Zur Gesamtrekonstruktion s. Taf. 110-112.
87 Zur Terminologie ist anzumerken, daß die beiden Seitenflügel in der Literatur beim
Nymphaeum Traiani - ebenso wie bei anderen Brunnenbauten dieses Typs - auch
als Risalite bezeichnet werden, vgl. etwa Letzner, Brunnenbauten, bes. 11-158;
Dorl-Klingenschmid, Prunkbrunnen, bes. 55 f. Da beim Nymphaeum Traiani diese
beiden Seitenteile des Gebäudes extrem weit vorgezogen sind, scheint m.E. der
Begriff „Seitenflügel“ eher zutreffend, vgl. Koepf, Bildwörterbuch, s. v. Risalit, 385.
Auch Hülsen, Milet I 5, passim, bezeichnet die entsprechenden Gebäudeteile des
milesischen Nymphäums als „Flügel“.
8