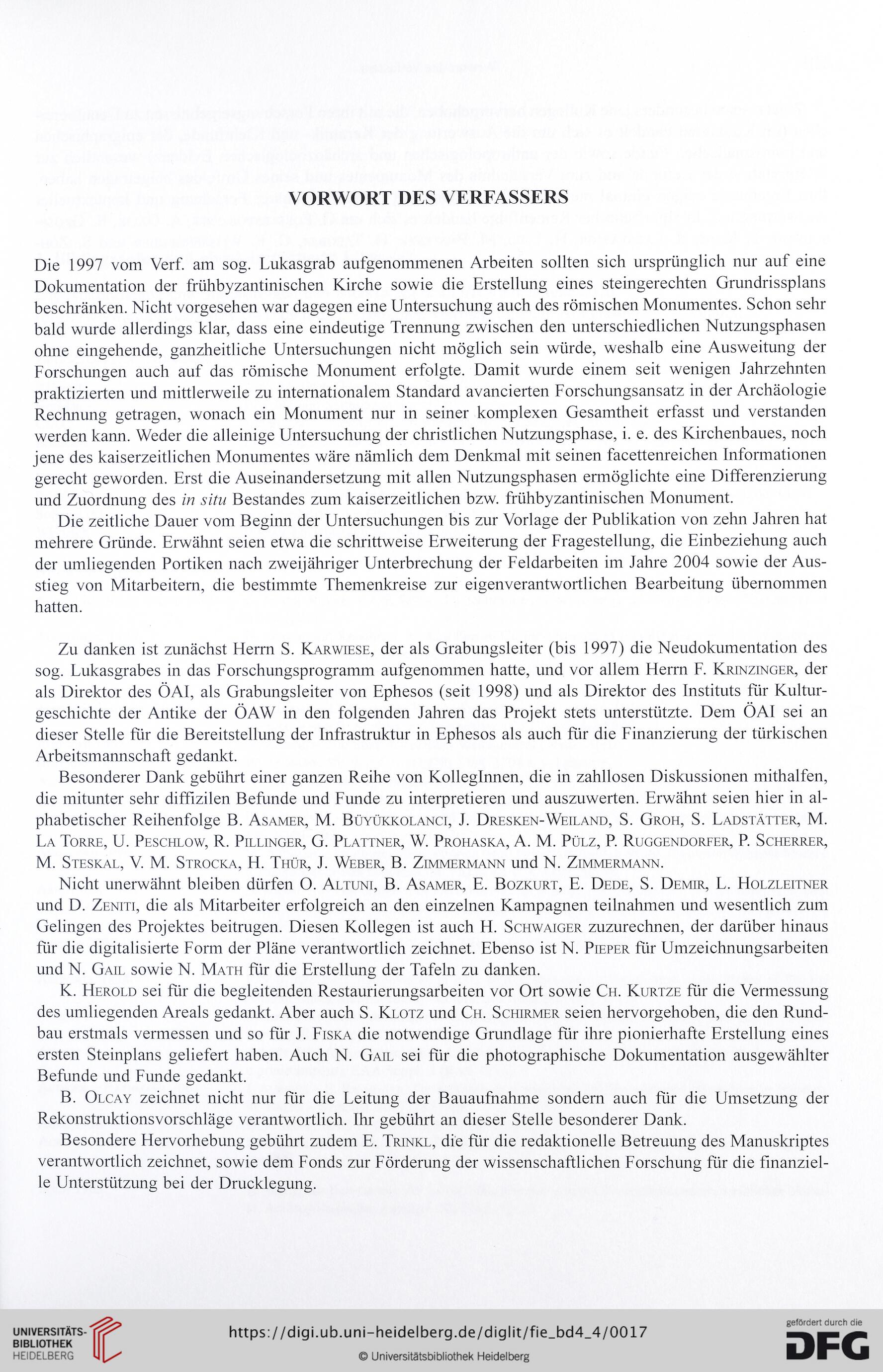VORWORT DES VERFASSERS
Die 1997 vom Verf. am sog. Lukasgrab aufgenommenen Arbeiten sollten sich ursprünglich nur auf eine
Dokumentation der frühbyzantinischen Kirche sowie die Erstellung eines steingerechten Grundrissplans
beschränken. Nicht vorgesehen war dagegen eine Untersuchung auch des römischen Monumentes. Schon sehr
bald wurde allerdings klar, dass eine eindeutige Trennung zwischen den unterschiedlichen Nutzungsphasen
ohne eingehende, ganzheitliche Untersuchungen nicht möglich sein würde, weshalb eine Ausweitung der
Forschungen auch auf das römische Monument erfolgte. Damit wurde einem seit wenigen Jahrzehnten
praktizierten und mittlerweile zu internationalem Standard avancierten Forschungsansatz in der Archäologie
Rechnung getragen, wonach ein Monument nur in seiner komplexen Gesamtheit erfasst und verstanden
werden kann. Weder die alleinige Untersuchung der christlichen Nutzungsphase, i. e. des Kirchenbaues, noch
jene des kaiserzeitlichen Monumentes wäre nämlich dem Denkmal mit seinen facettenreichen Informationen
gerecht geworden. Erst die Auseinandersetzung mit allen Nutzungsphasen ermöglichte eine Differenzierung
und Zuordnung des in situ Bestandes zum kaiserzeitlichen bzw. frühbyzantinischen Monument.
Die zeitliche Dauer vom Beginn der Untersuchungen bis zur Vorlage der Publikation von zehn Jahren hat
mehrere Gründe. Erwähnt seien etwa die schrittweise Erweiterung der Fragestellung, die Einbeziehung auch
der umliegenden Portiken nach zweijähriger Unterbrechung der Feldarbeiten im Jahre 2004 sowie der Aus-
stieg von Mitarbeitern, die bestimmte Themenkreise zur eigenverantwortlichen Bearbeitung übernommen
hatten.
Zu danken ist zunächst Herrn S. Karwiese, der als Grabungsleiter (bis 1997) die Neudokumentation des
sog. Lukasgrabes in das Forschungsprogramm aufgenommen hatte, und vor allem Herrn F. Krinzinger, der
als Direktor des ÖAI, als Grabungsleiter von Ephesos (seit 1998) und als Direktor des Instituts für Kultur-
geschichte der Antike der ÖAW in den folgenden Jahren das Projekt stets unterstützte. Dem ÖAI sei an
dieser Stelle für die Bereitstellung der Infrastruktur in Ephesos als auch für die Finanzierung der türkischen
Arbeitsmannschaft gedankt.
Besonderer Dank gebührt einer ganzen Reihe von Kolleginnen, die in zahllosen Diskussionen mithalfen,
die mitunter sehr diffizilen Befunde und Funde zu interpretieren und auszuwerten. Erwähnt seien hier in al-
phabetischer Reihenfolge B. Asamer, M. Büyükkolanci, J. Dresken-Weiland, S. Groh, S. Ladstätter, M.
La Torre, U. Peschlow, R. Pillinger, G. Plattner, W. Prohaska, A. M. Pülz, P. Ruggendorfer, P. Scherrer,
M. Steskal, V. M. Strocka, H. Thür, J. Weber, B. Zimmermann und N. Zimmermann.
Nicht unerwähnt bleiben dürfen O. Altuni, B. Asamer, E. Bozkurt, E. Dede, S. Demir, L. Holzleitner
und D. Zeniti, die als Mitarbeiter erfolgreich an den einzelnen Kampagnen teilnahmen und wesentlich zum
Gelingen des Projektes beitrugen. Diesen Kollegen ist auch H. Schwaiger zuzurechnen, der darüber hinaus
für die digitalisierte Form der Pläne verantwortlich zeichnet. Ebenso ist N. Pieper für Umzeichnungsarbeiten
und N. Gail sowie N. Math für die Erstellung der Tafeln zu danken.
K. Herold sei für die begleitenden Restaurierungsarbeiten vor Ort sowie Ch. Kurtze für die Vermessung
des umliegenden Areals gedankt. Aber auch S. Klotz und Ch. Schirmer seien hervorgehoben, die den Rund-
bau erstmals vermessen und so für J. Fiska die notwendige Grundlage für ihre pionierhafte Erstellung eines
ersten Steinplans geliefert haben. Auch N. Gail sei für die photographische Dokumentation ausgewählter
Befunde und Funde gedankt.
B. Olcay zeichnet nicht nur für die Leitung der Bauaufnahme sondern auch für die Umsetzung der
Rekonstruktionsvorschläge verantwortlich. Ihr gebührt an dieser Stelle besonderer Dank.
Besondere Hervorhebung gebührt zudem E. Trinkl, die für die redaktionelle Betreuung des Manuskriptes
verantwortlich zeichnet, sowie dem Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung für die finanziel-
le Unterstützung bei der Drucklegung.
Die 1997 vom Verf. am sog. Lukasgrab aufgenommenen Arbeiten sollten sich ursprünglich nur auf eine
Dokumentation der frühbyzantinischen Kirche sowie die Erstellung eines steingerechten Grundrissplans
beschränken. Nicht vorgesehen war dagegen eine Untersuchung auch des römischen Monumentes. Schon sehr
bald wurde allerdings klar, dass eine eindeutige Trennung zwischen den unterschiedlichen Nutzungsphasen
ohne eingehende, ganzheitliche Untersuchungen nicht möglich sein würde, weshalb eine Ausweitung der
Forschungen auch auf das römische Monument erfolgte. Damit wurde einem seit wenigen Jahrzehnten
praktizierten und mittlerweile zu internationalem Standard avancierten Forschungsansatz in der Archäologie
Rechnung getragen, wonach ein Monument nur in seiner komplexen Gesamtheit erfasst und verstanden
werden kann. Weder die alleinige Untersuchung der christlichen Nutzungsphase, i. e. des Kirchenbaues, noch
jene des kaiserzeitlichen Monumentes wäre nämlich dem Denkmal mit seinen facettenreichen Informationen
gerecht geworden. Erst die Auseinandersetzung mit allen Nutzungsphasen ermöglichte eine Differenzierung
und Zuordnung des in situ Bestandes zum kaiserzeitlichen bzw. frühbyzantinischen Monument.
Die zeitliche Dauer vom Beginn der Untersuchungen bis zur Vorlage der Publikation von zehn Jahren hat
mehrere Gründe. Erwähnt seien etwa die schrittweise Erweiterung der Fragestellung, die Einbeziehung auch
der umliegenden Portiken nach zweijähriger Unterbrechung der Feldarbeiten im Jahre 2004 sowie der Aus-
stieg von Mitarbeitern, die bestimmte Themenkreise zur eigenverantwortlichen Bearbeitung übernommen
hatten.
Zu danken ist zunächst Herrn S. Karwiese, der als Grabungsleiter (bis 1997) die Neudokumentation des
sog. Lukasgrabes in das Forschungsprogramm aufgenommen hatte, und vor allem Herrn F. Krinzinger, der
als Direktor des ÖAI, als Grabungsleiter von Ephesos (seit 1998) und als Direktor des Instituts für Kultur-
geschichte der Antike der ÖAW in den folgenden Jahren das Projekt stets unterstützte. Dem ÖAI sei an
dieser Stelle für die Bereitstellung der Infrastruktur in Ephesos als auch für die Finanzierung der türkischen
Arbeitsmannschaft gedankt.
Besonderer Dank gebührt einer ganzen Reihe von Kolleginnen, die in zahllosen Diskussionen mithalfen,
die mitunter sehr diffizilen Befunde und Funde zu interpretieren und auszuwerten. Erwähnt seien hier in al-
phabetischer Reihenfolge B. Asamer, M. Büyükkolanci, J. Dresken-Weiland, S. Groh, S. Ladstätter, M.
La Torre, U. Peschlow, R. Pillinger, G. Plattner, W. Prohaska, A. M. Pülz, P. Ruggendorfer, P. Scherrer,
M. Steskal, V. M. Strocka, H. Thür, J. Weber, B. Zimmermann und N. Zimmermann.
Nicht unerwähnt bleiben dürfen O. Altuni, B. Asamer, E. Bozkurt, E. Dede, S. Demir, L. Holzleitner
und D. Zeniti, die als Mitarbeiter erfolgreich an den einzelnen Kampagnen teilnahmen und wesentlich zum
Gelingen des Projektes beitrugen. Diesen Kollegen ist auch H. Schwaiger zuzurechnen, der darüber hinaus
für die digitalisierte Form der Pläne verantwortlich zeichnet. Ebenso ist N. Pieper für Umzeichnungsarbeiten
und N. Gail sowie N. Math für die Erstellung der Tafeln zu danken.
K. Herold sei für die begleitenden Restaurierungsarbeiten vor Ort sowie Ch. Kurtze für die Vermessung
des umliegenden Areals gedankt. Aber auch S. Klotz und Ch. Schirmer seien hervorgehoben, die den Rund-
bau erstmals vermessen und so für J. Fiska die notwendige Grundlage für ihre pionierhafte Erstellung eines
ersten Steinplans geliefert haben. Auch N. Gail sei für die photographische Dokumentation ausgewählter
Befunde und Funde gedankt.
B. Olcay zeichnet nicht nur für die Leitung der Bauaufnahme sondern auch für die Umsetzung der
Rekonstruktionsvorschläge verantwortlich. Ihr gebührt an dieser Stelle besonderer Dank.
Besondere Hervorhebung gebührt zudem E. Trinkl, die für die redaktionelle Betreuung des Manuskriptes
verantwortlich zeichnet, sowie dem Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung für die finanziel-
le Unterstützung bei der Drucklegung.