Hinweis: Dies ist eine zusätzlich gescannte Seite, um Farbkeil und Maßstab abbilden zu können.
0.5
1 cm
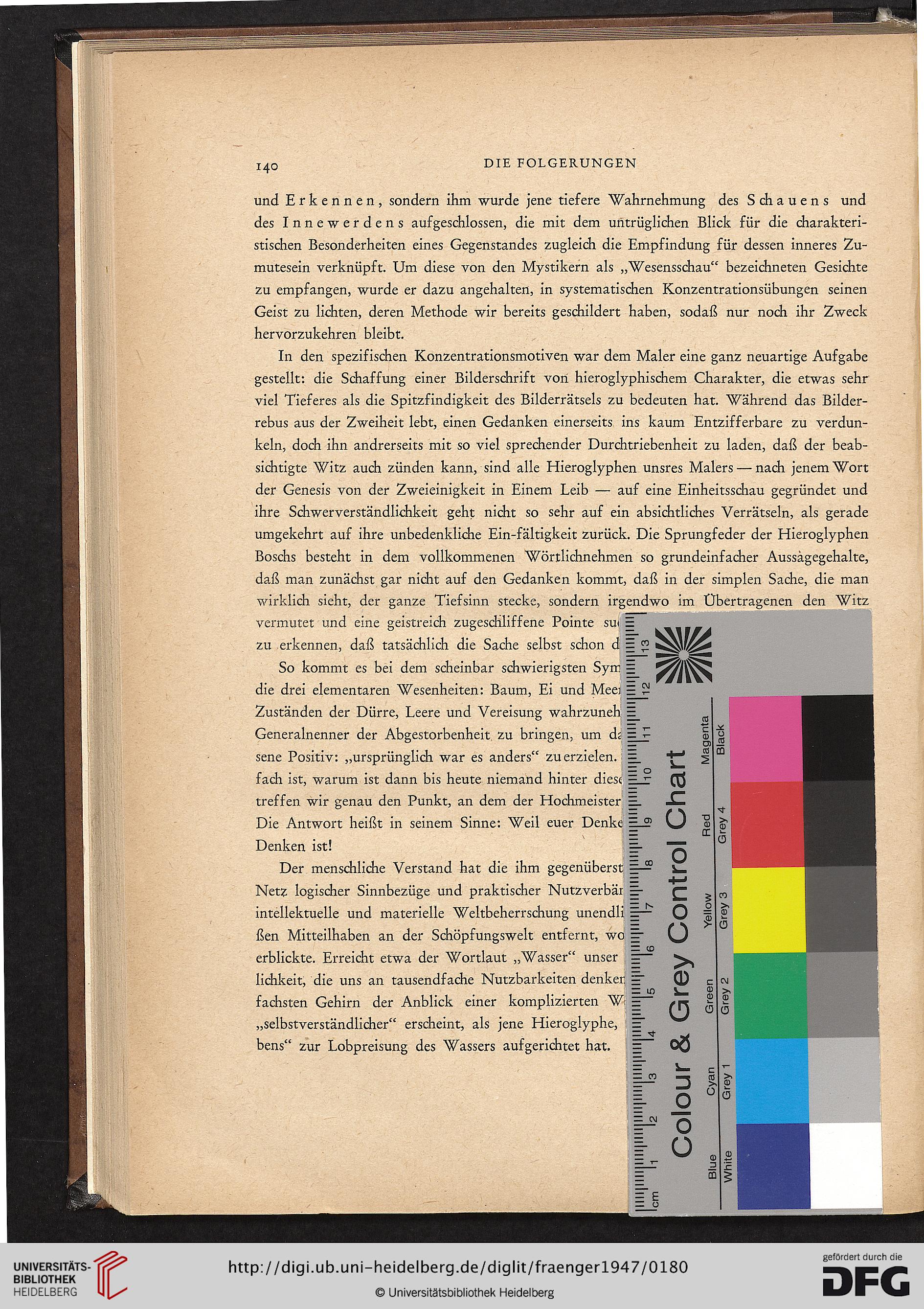
140
DIEFOLGERUNGEN
und Erkennen, sondern ihm wurde jene tiefere Wahrnehmung des S ch a u e n s und
des Innewerdens aufgeschlossen, die mit dem untrügHchen Blick für die &arakteri-
stischen Besonderheiten eines Gegenstandes zugieich die Empfindung für dessen inneres Zu-
mutesein verknüpft. Um diese von den Mystikern ais „Wesensschau" bezeichneten Gesichte
zu empfangen, wurde er dazu angehalten, in systematischen Konzentrationsübungen seinen
Geist zu iichten, deren Methode wir bereits geschiidert haben, sodaß nur noch ihr Zweck
hervorzukehren bieibt.
In den spezifischen Konzentrationsmotiven war dem Maier eine ganz neuartige Aufgabe
gestelit: die Schaffung einer Bilderschrift von hierogiyphischem Charakter, die etwas sehr
viei Tieferes ais die Spitzfindigkeit des Biiderrätseis zu bedeuten hat. Während das Biider-
rebus aus der Zweiheit lebt, einen Gedanken einerseits ins kaum Entzifferbare zu verdun-
kein, doch ihn andrerseits mit so viei sprechender DurAtriebenheit zu iaden, daß der beab-
sichtigte Witz auch zünden kann, sind aüe Hierogiyphen unsres Malers — nach jenem Wort
der Genesis von der Zweieinigkeit in Einem Leib — auf eine Einheitsschau gegründet und
ihre Schwerverständiichkeit geht nicht so sehr auf ein absichtiiches Verrätsein, ais gerade
umgekehrt auf ihre unbedenkiiche Ein-fäitigkeit zurück. Die Sprungfeder der Hierogiyphen
Boschs besteht in dem voiikommenen Wörtiichnehmen so grundeinfacher Aussägegehaite,
daß man zunächst gar niAt auf den Gedanken kommt, daß in der simpien Sache, die man
wirkiich sieht, der ganze Tiefsinn stecke, sondern irgendwo im Obertragenen den Witz
vermutet und eine geistreich zugeschiiffene Pointe su< E
zu erkennen, daß tatsächiich die Sache seibst schon d E ^
So kommt es bei dem scheinbar sAwierigsten Sym E
die drei eiementaren Wesenheiten: Baum, Ei und Meei E ^
Zuständen der Dürre, Leere und Vereisung wahrzuneh E_
Generainenner der Abgestorbenheit zu bringen, um d; E L
sene Positiv: „ursprüngiich war es anders" zuerzieien. E. ^
faA ist, warum ist dann bis heute niemand hinter diesc — ^
treffen wir genau den Punkt, an dem der Hochmeister E- -C
Die Antwort heißt in seinem Sinne: Weii euer Denke E-T O
Denken ist! E-
Der menschiiche Verstand hat die ihm gegeniiberst E-^ S—
Netz iogischer Sinnbezüge und praktischer Nutzverbär E- ^
inteiiektueiie und materieiie Weitbeherrschung unendii E-^ O
ßen Mitteiihaben an der Schöpfungsweit entfernt, wo E-
erbiickte. Erreicht etwa der Wortiaut „"Wasser" unser E**^
iichkeit, die uns an tausendfache Nutzbarkeiten denker E* (D
n Lo
fachsten Gehirn der Anbiick einer kompiizierten W E
„seibstverständiicher" erscheint, ais jene Hierogiyphe, E"^
bens" zur Lobpreisung des Wassers aufgeriAtet hat. E
E s—
^ D
^ o
9- O
- E
DIEFOLGERUNGEN
und Erkennen, sondern ihm wurde jene tiefere Wahrnehmung des S ch a u e n s und
des Innewerdens aufgeschlossen, die mit dem untrügHchen Blick für die &arakteri-
stischen Besonderheiten eines Gegenstandes zugieich die Empfindung für dessen inneres Zu-
mutesein verknüpft. Um diese von den Mystikern ais „Wesensschau" bezeichneten Gesichte
zu empfangen, wurde er dazu angehalten, in systematischen Konzentrationsübungen seinen
Geist zu iichten, deren Methode wir bereits geschiidert haben, sodaß nur noch ihr Zweck
hervorzukehren bieibt.
In den spezifischen Konzentrationsmotiven war dem Maier eine ganz neuartige Aufgabe
gestelit: die Schaffung einer Bilderschrift von hierogiyphischem Charakter, die etwas sehr
viei Tieferes ais die Spitzfindigkeit des Biiderrätseis zu bedeuten hat. Während das Biider-
rebus aus der Zweiheit lebt, einen Gedanken einerseits ins kaum Entzifferbare zu verdun-
kein, doch ihn andrerseits mit so viei sprechender DurAtriebenheit zu iaden, daß der beab-
sichtigte Witz auch zünden kann, sind aüe Hierogiyphen unsres Malers — nach jenem Wort
der Genesis von der Zweieinigkeit in Einem Leib — auf eine Einheitsschau gegründet und
ihre Schwerverständiichkeit geht nicht so sehr auf ein absichtiiches Verrätsein, ais gerade
umgekehrt auf ihre unbedenkiiche Ein-fäitigkeit zurück. Die Sprungfeder der Hierogiyphen
Boschs besteht in dem voiikommenen Wörtiichnehmen so grundeinfacher Aussägegehaite,
daß man zunächst gar niAt auf den Gedanken kommt, daß in der simpien Sache, die man
wirkiich sieht, der ganze Tiefsinn stecke, sondern irgendwo im Obertragenen den Witz
vermutet und eine geistreich zugeschiiffene Pointe su< E
zu erkennen, daß tatsächiich die Sache seibst schon d E ^
So kommt es bei dem scheinbar sAwierigsten Sym E
die drei eiementaren Wesenheiten: Baum, Ei und Meei E ^
Zuständen der Dürre, Leere und Vereisung wahrzuneh E_
Generainenner der Abgestorbenheit zu bringen, um d; E L
sene Positiv: „ursprüngiich war es anders" zuerzieien. E. ^
faA ist, warum ist dann bis heute niemand hinter diesc — ^
treffen wir genau den Punkt, an dem der Hochmeister E- -C
Die Antwort heißt in seinem Sinne: Weii euer Denke E-T O
Denken ist! E-
Der menschiiche Verstand hat die ihm gegeniiberst E-^ S—
Netz iogischer Sinnbezüge und praktischer Nutzverbär E- ^
inteiiektueiie und materieiie Weitbeherrschung unendii E-^ O
ßen Mitteiihaben an der Schöpfungsweit entfernt, wo E-
erbiickte. Erreicht etwa der Wortiaut „"Wasser" unser E**^
iichkeit, die uns an tausendfache Nutzbarkeiten denker E* (D
n Lo
fachsten Gehirn der Anbiick einer kompiizierten W E
„seibstverständiicher" erscheint, ais jene Hierogiyphe, E"^
bens" zur Lobpreisung des Wassers aufgeriAtet hat. E
E s—
^ D
^ o
9- O
- E




