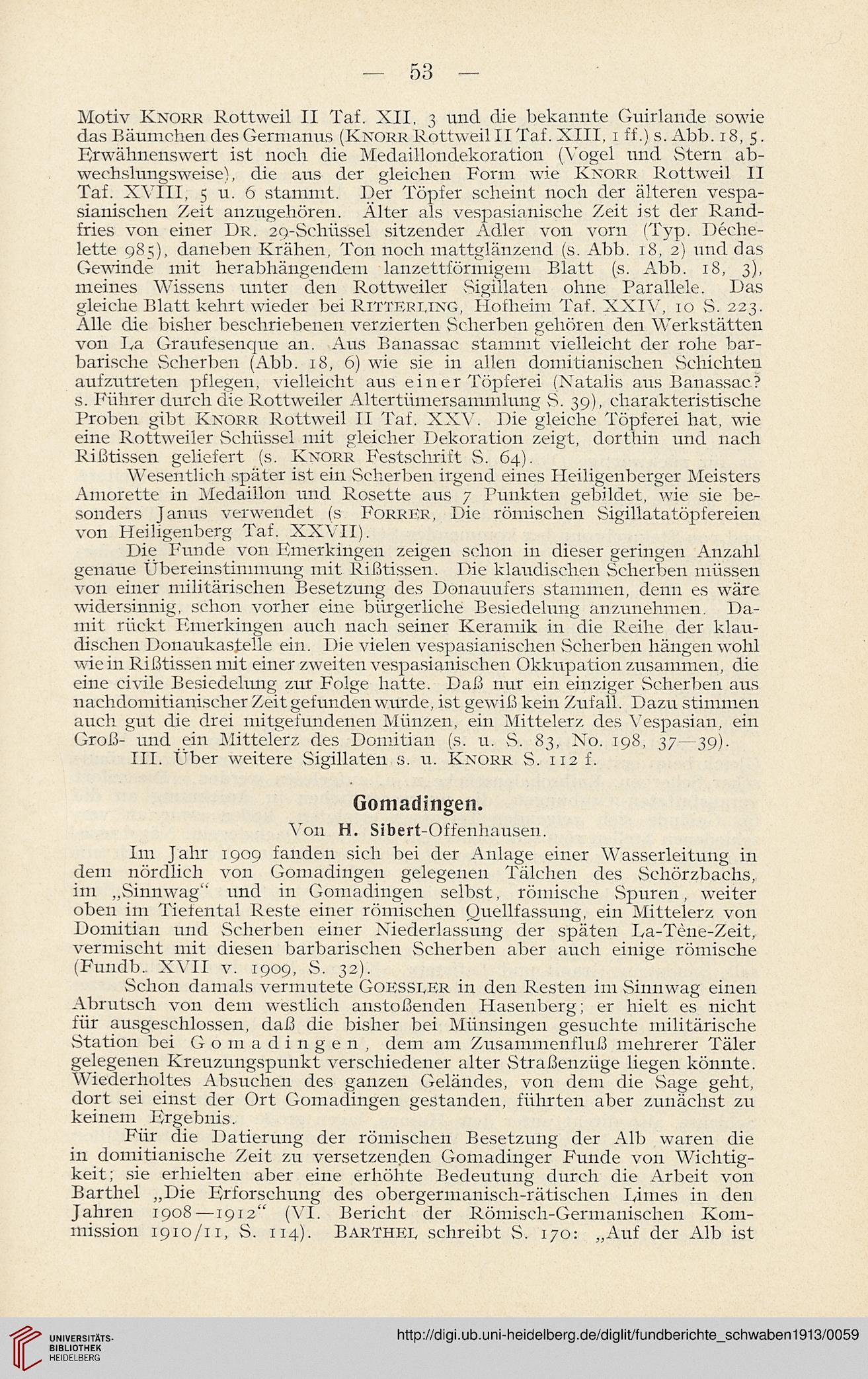53
Motiv Knorr Rottweil II Taf. XII, 3 und die bekannte Guirlande sowie
das Bäumchen des Germanus (Knorr Rottweil II Taf. XIII, 1 ff.) s. Abb. 18,5.
Erwähnenswert ist noch die Medaillondekoration (Vogel und Stern ab-
wechslungsweise), die aus der gleichen Form wie Knorr Rottweil II
Taf. XVIII, 5 u. 6 stammt. Der Töpfer scheint noch der älteren vespa-
sianischen Zeit anzugehören. Älter als vespasianische Zeit ist der Rand-
fries von einer Dr. 29-Schüssel sitzender Adler von vorn (Typ. Deche-
lette 985), daneben Krähen, Ton noch mattglänzend (s. Abb. 18, 2) und das
Gewinde mit herabhängendem lanzettförmigem Blatt (s. Abb. 18, 3),
meines Wissens unter den Rottweiler Sigillaten ohne Parallele. Das
gleiche Blatt kehrt wieder bei Ritterling, Hofheim Taf. XXIV, 10 S. 223.
Alle die bisher beschriebenen verzierten Scherben gehören den Werkstätten
von Ta Graufesenque an. Aus Banassac stammt vielleicht der rohe bar-
barische Scherben (Abb. 18, 6) wie sie in allen domi dänischen Schichten
aufzutreten pflegen, vielleicht aus ein er Töpferei (Natalis aus Banassac?
s. Führer durch die Rottweiler Altertümersammlung S. 39), charakteristische
Proben gibt Knorr Rottweil II Taf. XXV. Die gleiche Töpferei hat, wie
eine Rottweiler Schüssel mit gleicher Dekoration zeigt, dorthin und nach
Rißtissen geliefert (s. Knorr Festschrift S. 64).
Wesentlich später ist ein Scherben irgend eines Heiligenberger Meisters
Amorette in Medaillon und Rosette aus 7 Punkten gebildet, wie sie be-
sonders Janus verwendet (s Forrer, Die römischen Sigillatatöpfereien
von Heiligenberg Taf. XXVII).
Die Funde von Emerkingen zeigen schon in dieser geringen Anzahl
genaue Übereinstimmung mit Rißtissen. Die klaudischen Scherben müssen
von einer militärischen Besetzung des Donauufers stammen, denn es wäre
widersinnig, schon vorher eine bürgerliche Besiedelung anzunehmen. Da-
mit rückt Emerkingen auch nach seiner Keramik in die Reihe der klau-
dischen Donaukasfelle ein. Die vielen vespasianischen Scherben hängen wohl
wie in Rißtissen mit einer zweiten vespasianischen Okkupation zusammen, die
eine civile Besiedelung zur Folge hatte. Daß nur ein einziger Scherben aus
nachdomitianischer Zeit gefunden wurde, ist gewiß kein Zufall. Dazu stimmen
auch gut die drei mitgefundenen Münzen, ein Mittelerz des Vespasian, ein
Groß- und ein Mittelerz des Domitian (s. u. S. 83, No. 198, 37—39).
III. Über weitere Sigillaten s. u. Knorr S. ii2f.
Gomadingen.
Von H. Sibert-Offenhausen.
Im Jahr 1909 fanden sich bei der Anlage einer Wasserleitung in
dem nördlich von Gomadingen gelegenen Tälchen des Schörzbachs,
im „Sinnwag“ und in Gomadingen selbst, römische Spuren, weiter
oben im Tieiental Reste einer römischen Quellfassung, ein Mittelerz von
Domitian und Scherben einer Niederlassung der späten La-Tene-Zeit,
vermischt mit diesen barbarischen Scherben aber auch einige römische
(Fundb.. XVII v. 1909, S. 32).
Schon damals vermutete GoesslEr in den Resten im Sinnwag einen
Abrutsch von dem westlich anstoßenden Hasenberg; er hielt es nicht
für ausgeschlossen, daß die bisher bei Münsingen gesuchte militärische
Station bei Gomadingen, dem am Zusammenfluß mehrerer Täler
gelegenen Kreuzungspunkt verschiedener alter Straßenzüge liegen könnte.
Wiederholtes Absuchen des ganzen Geländes, von dem die Sage geht,
dort sei einst der Ort Gomadingen gestanden, führten aber zunächst zu
keinem Ergebnis.
Für die Datierung der römischen Besetzung der Alb waren die
in domitianische Zeit zu versetzenden Gomadinger Funde von Wichtig-
keit; sie erhielten aber eine erhöhte Bedeutung durch die Arbeit von
Barthel „Die Erforschung des obergermanisch-rätischen Limes in den
Jahren 1908—1912“ (VI. Bericht der Römisch-Germanischen Kom-
mission 1910/11, S. 114). Barthel schreibt S. 170: „Auf der Alb ist
Motiv Knorr Rottweil II Taf. XII, 3 und die bekannte Guirlande sowie
das Bäumchen des Germanus (Knorr Rottweil II Taf. XIII, 1 ff.) s. Abb. 18,5.
Erwähnenswert ist noch die Medaillondekoration (Vogel und Stern ab-
wechslungsweise), die aus der gleichen Form wie Knorr Rottweil II
Taf. XVIII, 5 u. 6 stammt. Der Töpfer scheint noch der älteren vespa-
sianischen Zeit anzugehören. Älter als vespasianische Zeit ist der Rand-
fries von einer Dr. 29-Schüssel sitzender Adler von vorn (Typ. Deche-
lette 985), daneben Krähen, Ton noch mattglänzend (s. Abb. 18, 2) und das
Gewinde mit herabhängendem lanzettförmigem Blatt (s. Abb. 18, 3),
meines Wissens unter den Rottweiler Sigillaten ohne Parallele. Das
gleiche Blatt kehrt wieder bei Ritterling, Hofheim Taf. XXIV, 10 S. 223.
Alle die bisher beschriebenen verzierten Scherben gehören den Werkstätten
von Ta Graufesenque an. Aus Banassac stammt vielleicht der rohe bar-
barische Scherben (Abb. 18, 6) wie sie in allen domi dänischen Schichten
aufzutreten pflegen, vielleicht aus ein er Töpferei (Natalis aus Banassac?
s. Führer durch die Rottweiler Altertümersammlung S. 39), charakteristische
Proben gibt Knorr Rottweil II Taf. XXV. Die gleiche Töpferei hat, wie
eine Rottweiler Schüssel mit gleicher Dekoration zeigt, dorthin und nach
Rißtissen geliefert (s. Knorr Festschrift S. 64).
Wesentlich später ist ein Scherben irgend eines Heiligenberger Meisters
Amorette in Medaillon und Rosette aus 7 Punkten gebildet, wie sie be-
sonders Janus verwendet (s Forrer, Die römischen Sigillatatöpfereien
von Heiligenberg Taf. XXVII).
Die Funde von Emerkingen zeigen schon in dieser geringen Anzahl
genaue Übereinstimmung mit Rißtissen. Die klaudischen Scherben müssen
von einer militärischen Besetzung des Donauufers stammen, denn es wäre
widersinnig, schon vorher eine bürgerliche Besiedelung anzunehmen. Da-
mit rückt Emerkingen auch nach seiner Keramik in die Reihe der klau-
dischen Donaukasfelle ein. Die vielen vespasianischen Scherben hängen wohl
wie in Rißtissen mit einer zweiten vespasianischen Okkupation zusammen, die
eine civile Besiedelung zur Folge hatte. Daß nur ein einziger Scherben aus
nachdomitianischer Zeit gefunden wurde, ist gewiß kein Zufall. Dazu stimmen
auch gut die drei mitgefundenen Münzen, ein Mittelerz des Vespasian, ein
Groß- und ein Mittelerz des Domitian (s. u. S. 83, No. 198, 37—39).
III. Über weitere Sigillaten s. u. Knorr S. ii2f.
Gomadingen.
Von H. Sibert-Offenhausen.
Im Jahr 1909 fanden sich bei der Anlage einer Wasserleitung in
dem nördlich von Gomadingen gelegenen Tälchen des Schörzbachs,
im „Sinnwag“ und in Gomadingen selbst, römische Spuren, weiter
oben im Tieiental Reste einer römischen Quellfassung, ein Mittelerz von
Domitian und Scherben einer Niederlassung der späten La-Tene-Zeit,
vermischt mit diesen barbarischen Scherben aber auch einige römische
(Fundb.. XVII v. 1909, S. 32).
Schon damals vermutete GoesslEr in den Resten im Sinnwag einen
Abrutsch von dem westlich anstoßenden Hasenberg; er hielt es nicht
für ausgeschlossen, daß die bisher bei Münsingen gesuchte militärische
Station bei Gomadingen, dem am Zusammenfluß mehrerer Täler
gelegenen Kreuzungspunkt verschiedener alter Straßenzüge liegen könnte.
Wiederholtes Absuchen des ganzen Geländes, von dem die Sage geht,
dort sei einst der Ort Gomadingen gestanden, führten aber zunächst zu
keinem Ergebnis.
Für die Datierung der römischen Besetzung der Alb waren die
in domitianische Zeit zu versetzenden Gomadinger Funde von Wichtig-
keit; sie erhielten aber eine erhöhte Bedeutung durch die Arbeit von
Barthel „Die Erforschung des obergermanisch-rätischen Limes in den
Jahren 1908—1912“ (VI. Bericht der Römisch-Germanischen Kom-
mission 1910/11, S. 114). Barthel schreibt S. 170: „Auf der Alb ist