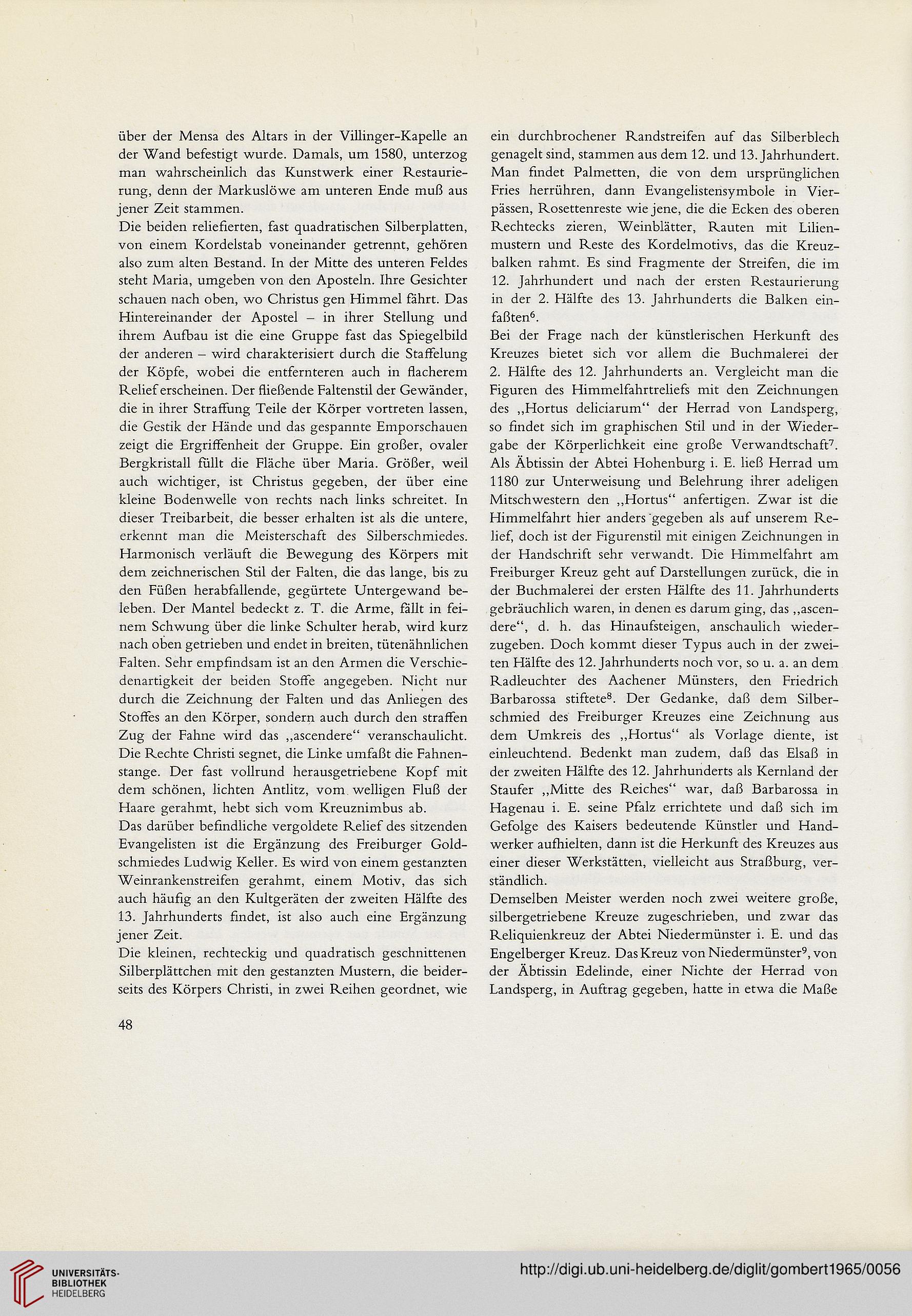über der Mensa des Altars in der Villinger-Kapelle an
der Wand befestigt wurde. Damals, um 1580, unterzog
man wahrscheinlich das Kunstwerk einer Restaurie-
rung, denn der Markuslöwe am unteren Ende muß aus
jener Zeit stammen.
Die beiden reliefierten, fast quadratischen Silberplatten,
von einem Kordelstab voneinander getrennt, gehören
also zum alten Bestand. In der Mitte des unteren Feldes
steht Maria, umgeben von den Aposteln. Ihre Gesichter
schauen nach oben, wo Christus gen Himmel fährt. Das
Hintereinander der Apostel - in ihrer Stellung und
ihrem Aufbau ist die eine Gruppe fast das Spiegelbild
der anderen - wird charakterisiert durch die Staffelung
der Köpfe, wobei die entfernteren auch in flacherem
Relief erscheinen. Der fließende Faltenstil der Gewänder,
die in ihrer Straffung Teile der Körper vortreten lassen,
die Gestik der Hände und das gespannte Emporschauen
zeigt die Ergriffenheit der Gruppe. Ein großer, ovaler
Bergkristall füllt die Fläche über Maria. Größer, weil
auch wichtiger, ist Christus gegeben, der über eine
kleine Bodenwelle von rechts nach links schreitet. In
dieser Treibarbeit, die besser erhalten ist als die untere,
erkennt man die Meisterschaft des Silberschmiedes.
Harmonisch verläuft die Bewegung des Körpers mit
dem zeichnerischen Stil der Falten, die das lange, bis zu
den Füßen herabfallende, gegürtete Untergewand be-
leben. Der Mantel bedeckt z. T. die Arme, fällt in fei-
nem Schwung über die linke Schulter herab, wird kurz
nach oben getrieben und endet in breiten, tütenähnlichen
Falten. Sehr empfindsam ist an den Armen die Verschie-
denartigkeit der beiden Stoffe angegeben. Nicht nur
durch die Zeichnung der Falten und das Anliegen des
Stoffes an den Körper, sondern auch durch den straffen
Zug der Fahne wird das „ascendere“ veranschaulicht.
Die Rechte Christi segnet, die Linke umfaßt die Fahnen-
stange. Der fast vollrund herausgetriebene Kopf mit
dem schönen, lichten Antlitz, vom welligen Fluß der
Haare gerahmt, hebt sich vom Kreuznimbus ab.
Das darüber befindliche vergoldete Relief des sitzenden
Evangelisten ist die Ergänzung des Freiburger Gold-
schmiedes Ludwig Keller. Es wird von einem gestanzten
Weinrankenstreifen gerahmt, einem Motiv, das sich
auch häufig an den Kultgeräten der zweiten Hälfte des
13. Jahrhunderts findet, ist also auch eine Ergänzung
jener Zeit.
Die kleinen, rechteckig und quadratisch geschnittenen
Silberplättchen mit den gestanzten Mustern, die beider-
seits des Körpers Christi, in zwei Reihen geordnet, wie
ein durchbrochener Randstreifen auf das Silberblech
genagelt sind, stammen aus dem 12. und 13. Jahrhundert.
Man findet Palmetten, die von dem ursprünglichen
Fries herrühren, dann Evangelistensymbole in Vier-
pässen, Rosettenreste wie jene, die die Ecken des oberen
Rechtecks zieren, Weinblätter, Rauten mit Lilien-
mustern und Reste des Kordelmotivs, das die Kreuz-
balken rahmt. Es sind Fragmente der Streifen, die im
12. Jahrhundert und nach der ersten Restaurierung
in der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts die Balken ein-
faßten6.
Bei der Frage nach der künstlerischen Herkunft des
Kreuzes bietet sich vor allem die Buchmalerei der
2. Hälfte des 12. Jahrhunderts an. Vergleicht man die
Figuren des Himmelfahrtreliefs mit den Zeichnungen
des „Hortus deliciarum“ der Herrad von Landsperg,
so findet sich im graphischen Stil und in der Wieder-
gabe der Körperlichkeit eine große Verwandtschaft7.
Als Äbtissin der Abtei Hohenburg i. E. ließ Herrad um
1180 zur Unterweisung und Belehrung ihrer adeligen
Mitschwestern den „Hortus“ anfertigen. Zwar ist die
Himmelfahrt hier anders gegeben als auf unserem Re-
lief, doch ist der Figurenstil mit einigen Zeichnungen in
der Handschrift sehr verwandt. Die Himmelfahrt am
Freiburger Kreuz geht auf Darstellungen zurück, die in
der Buchmalerei der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts
gebräuchlich waren, in denen es darum ging, das „ascen-
dere“, d. h. das Hinaufsteigen, anschaulich wieder-
zugeben. Doch kommt dieser Typus auch in der zwei-
ten Hälfte des 12. Jahrhunderts noch vor, so u. a. an dem
Radleuchter des Aachener Münsters, den Friedrich
Barbarossa stiftete8. Der Gedanke, daß dem Silber-
schmied des Freiburger Kreuzes eine Zeichnung aus
dem Umkreis des „Hortus“ als Vorlage diente, ist
einleuchtend. Bedenkt man zudem, daß das Elsaß in
der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts als Kernland der
Staufer „Mitte des Reiches“ war, daß Barbarossa in
Hagenau i. E. seine Pfalz errichtete und daß sich im
Gefolge des Kaisers bedeutende Künstler und Hand-
werker aufhielten, dann ist die Herkunft des Kreuzes aus
einer dieser Werkstätten, vielleicht aus Straßburg, ver-
ständlich.
Demselben Meister werden noch zwei weitere große,
silbergetriebene Kreuze zugeschrieben, und zwar das
Reliquienkreuz der Abtei Niedermünster i. E. und das
Engelberger Kreuz. Das Kreuz von Niedermünster9, von
der Äbtissin Edelinde, einer Nichte der Herrad von
Landsperg, in Auftrag gegeben, hatte in etwa die Maße
48
der Wand befestigt wurde. Damals, um 1580, unterzog
man wahrscheinlich das Kunstwerk einer Restaurie-
rung, denn der Markuslöwe am unteren Ende muß aus
jener Zeit stammen.
Die beiden reliefierten, fast quadratischen Silberplatten,
von einem Kordelstab voneinander getrennt, gehören
also zum alten Bestand. In der Mitte des unteren Feldes
steht Maria, umgeben von den Aposteln. Ihre Gesichter
schauen nach oben, wo Christus gen Himmel fährt. Das
Hintereinander der Apostel - in ihrer Stellung und
ihrem Aufbau ist die eine Gruppe fast das Spiegelbild
der anderen - wird charakterisiert durch die Staffelung
der Köpfe, wobei die entfernteren auch in flacherem
Relief erscheinen. Der fließende Faltenstil der Gewänder,
die in ihrer Straffung Teile der Körper vortreten lassen,
die Gestik der Hände und das gespannte Emporschauen
zeigt die Ergriffenheit der Gruppe. Ein großer, ovaler
Bergkristall füllt die Fläche über Maria. Größer, weil
auch wichtiger, ist Christus gegeben, der über eine
kleine Bodenwelle von rechts nach links schreitet. In
dieser Treibarbeit, die besser erhalten ist als die untere,
erkennt man die Meisterschaft des Silberschmiedes.
Harmonisch verläuft die Bewegung des Körpers mit
dem zeichnerischen Stil der Falten, die das lange, bis zu
den Füßen herabfallende, gegürtete Untergewand be-
leben. Der Mantel bedeckt z. T. die Arme, fällt in fei-
nem Schwung über die linke Schulter herab, wird kurz
nach oben getrieben und endet in breiten, tütenähnlichen
Falten. Sehr empfindsam ist an den Armen die Verschie-
denartigkeit der beiden Stoffe angegeben. Nicht nur
durch die Zeichnung der Falten und das Anliegen des
Stoffes an den Körper, sondern auch durch den straffen
Zug der Fahne wird das „ascendere“ veranschaulicht.
Die Rechte Christi segnet, die Linke umfaßt die Fahnen-
stange. Der fast vollrund herausgetriebene Kopf mit
dem schönen, lichten Antlitz, vom welligen Fluß der
Haare gerahmt, hebt sich vom Kreuznimbus ab.
Das darüber befindliche vergoldete Relief des sitzenden
Evangelisten ist die Ergänzung des Freiburger Gold-
schmiedes Ludwig Keller. Es wird von einem gestanzten
Weinrankenstreifen gerahmt, einem Motiv, das sich
auch häufig an den Kultgeräten der zweiten Hälfte des
13. Jahrhunderts findet, ist also auch eine Ergänzung
jener Zeit.
Die kleinen, rechteckig und quadratisch geschnittenen
Silberplättchen mit den gestanzten Mustern, die beider-
seits des Körpers Christi, in zwei Reihen geordnet, wie
ein durchbrochener Randstreifen auf das Silberblech
genagelt sind, stammen aus dem 12. und 13. Jahrhundert.
Man findet Palmetten, die von dem ursprünglichen
Fries herrühren, dann Evangelistensymbole in Vier-
pässen, Rosettenreste wie jene, die die Ecken des oberen
Rechtecks zieren, Weinblätter, Rauten mit Lilien-
mustern und Reste des Kordelmotivs, das die Kreuz-
balken rahmt. Es sind Fragmente der Streifen, die im
12. Jahrhundert und nach der ersten Restaurierung
in der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts die Balken ein-
faßten6.
Bei der Frage nach der künstlerischen Herkunft des
Kreuzes bietet sich vor allem die Buchmalerei der
2. Hälfte des 12. Jahrhunderts an. Vergleicht man die
Figuren des Himmelfahrtreliefs mit den Zeichnungen
des „Hortus deliciarum“ der Herrad von Landsperg,
so findet sich im graphischen Stil und in der Wieder-
gabe der Körperlichkeit eine große Verwandtschaft7.
Als Äbtissin der Abtei Hohenburg i. E. ließ Herrad um
1180 zur Unterweisung und Belehrung ihrer adeligen
Mitschwestern den „Hortus“ anfertigen. Zwar ist die
Himmelfahrt hier anders gegeben als auf unserem Re-
lief, doch ist der Figurenstil mit einigen Zeichnungen in
der Handschrift sehr verwandt. Die Himmelfahrt am
Freiburger Kreuz geht auf Darstellungen zurück, die in
der Buchmalerei der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts
gebräuchlich waren, in denen es darum ging, das „ascen-
dere“, d. h. das Hinaufsteigen, anschaulich wieder-
zugeben. Doch kommt dieser Typus auch in der zwei-
ten Hälfte des 12. Jahrhunderts noch vor, so u. a. an dem
Radleuchter des Aachener Münsters, den Friedrich
Barbarossa stiftete8. Der Gedanke, daß dem Silber-
schmied des Freiburger Kreuzes eine Zeichnung aus
dem Umkreis des „Hortus“ als Vorlage diente, ist
einleuchtend. Bedenkt man zudem, daß das Elsaß in
der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts als Kernland der
Staufer „Mitte des Reiches“ war, daß Barbarossa in
Hagenau i. E. seine Pfalz errichtete und daß sich im
Gefolge des Kaisers bedeutende Künstler und Hand-
werker aufhielten, dann ist die Herkunft des Kreuzes aus
einer dieser Werkstätten, vielleicht aus Straßburg, ver-
ständlich.
Demselben Meister werden noch zwei weitere große,
silbergetriebene Kreuze zugeschrieben, und zwar das
Reliquienkreuz der Abtei Niedermünster i. E. und das
Engelberger Kreuz. Das Kreuz von Niedermünster9, von
der Äbtissin Edelinde, einer Nichte der Herrad von
Landsperg, in Auftrag gegeben, hatte in etwa die Maße
48