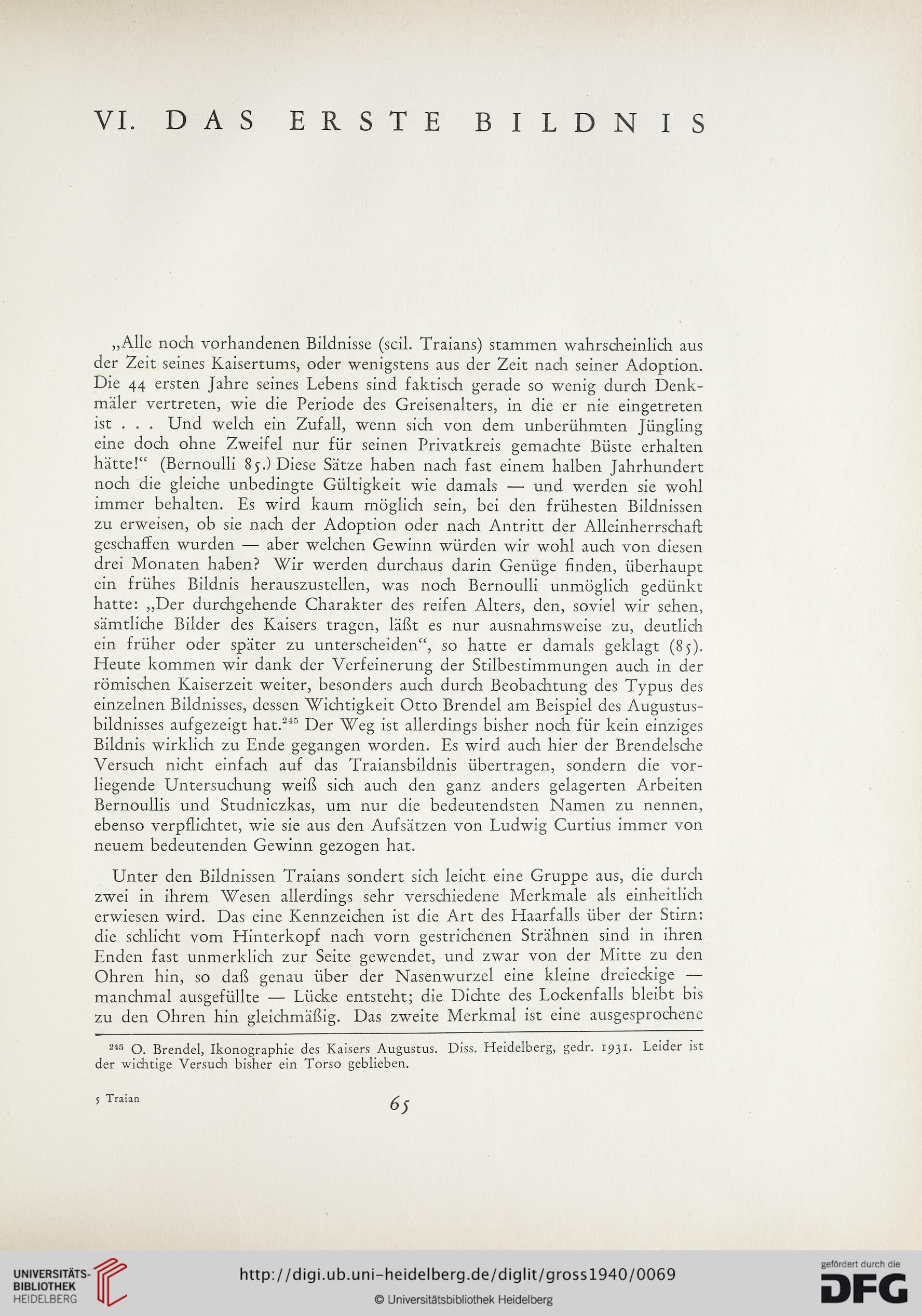VI.
DAS
ERSTE BILDNIS
„Alle noch vorhandenen Bildnisse (seil. Traians) stammen wahrscheinlich aus
der Zeit seines Kaisertums, oder wenigstens aus der Zeit nach seiner Adoption.
Die 44 ersten Jahre seines Lebens sind faktisch gerade so wenig durch Denk-
mäler vertreten, wie die Periode des Greisenalters, in die er nie eingetreten
ist . . . Und welch ein Zufall, wenn sich von dem unberühmten Jüngling
eine doch ohne Zweifel nur für seinen Privatkreis gemachte Büste erhalten
hätte!“ (Bernoulli 85.) Diese Sätze haben nach fast einem halben Jahrhundert
noch die gleiche unbedingte Gültigkeit wie damals — und werden sie wohl
immer behalten. Es wird kaum möglich sein, bei den frühesten Bildnissen
zu erweisen, ob sie nach der Adoption oder nach Antritt der Alleinherrschaft
geschaffen wurden — aber welchen Gewinn würden wir wohl auch von diesen
drei Monaten haben? Wir werden durchaus darin Genüge finden, überhaupt
ein frühes Bildnis herauszustellen, was noch Bernoulli unmöglich gedünkt
hatte: „Der durchgehende Charakter des reifen Alters, den, soviel wir sehen,
sämtliche Bilder des Kaisers tragen, läßt es nur ausnahmsweise zu, deutlich
ein früher oder später zu unterscheiden“, so hatte er damals geklagt (85).
Heute kommen wir dank der Verfeinerung der Stilbestimmungen auch in der
römischen Kaiserzeit weiter, besonders auch durch Beobachtung des Typus des
einzelnen Bildnisses, dessen Wichtigkeit Otto Brendel am Beispiel des Augustus-
bildnisses auf gezeigt hat.245 Der Weg ist allerdings bisher noch für kein einziges
Bildnis wirklich zu Ende gegangen worden. Es wird auch hier der Brendelsche
Versuch nicht einfach auf das Traiansbildnis übertragen, sondern die vor-
liegende Untersuchung weiß sich auch den ganz anders gelagerten Arbeiten
Bernoullis und Studniczkas, um nur die bedeutendsten Namen zu nennen,
ebenso verpflichtet, wie sie aus den Aufsätzen von Ludwig Curtius immer von
neuem bedeutenden Gewinn gezogen hat.
Unter den Bildnissen Traians sondert sich leicht eine Gruppe aus, die durch
zwei in ihrem Wesen allerdings sehr verschiedene Merkmale als einheitlich
erwiesen wird. Das eine Kennzeichen ist die Art des Haarfalls über der Stirn:
die schlicht vom Hinterkopf nach vorn gestrichenen Strähnen sind in ihren
Enden fast unmerklich zur Seite gewendet, und zwar von der Mitte zu den
Ohren hin, so daß genau über der Nasenwurzel eine kleine dreieckige —
manchmal ausgefüllte — Lücke entsteht; die Dichte des Lockenfalls bleibt bis
zu den Ohren hin gleichmäßig. Das zweite Merkmal ist eine ausgesprochene
245 O. Brendel, Ikonographie des Kaisers Augustus. Diss. Heidelberg, gedr. 193Leider ist
der wichtige Versuch bisher ein Torso geblieben.
6;
5 Traian
DAS
ERSTE BILDNIS
„Alle noch vorhandenen Bildnisse (seil. Traians) stammen wahrscheinlich aus
der Zeit seines Kaisertums, oder wenigstens aus der Zeit nach seiner Adoption.
Die 44 ersten Jahre seines Lebens sind faktisch gerade so wenig durch Denk-
mäler vertreten, wie die Periode des Greisenalters, in die er nie eingetreten
ist . . . Und welch ein Zufall, wenn sich von dem unberühmten Jüngling
eine doch ohne Zweifel nur für seinen Privatkreis gemachte Büste erhalten
hätte!“ (Bernoulli 85.) Diese Sätze haben nach fast einem halben Jahrhundert
noch die gleiche unbedingte Gültigkeit wie damals — und werden sie wohl
immer behalten. Es wird kaum möglich sein, bei den frühesten Bildnissen
zu erweisen, ob sie nach der Adoption oder nach Antritt der Alleinherrschaft
geschaffen wurden — aber welchen Gewinn würden wir wohl auch von diesen
drei Monaten haben? Wir werden durchaus darin Genüge finden, überhaupt
ein frühes Bildnis herauszustellen, was noch Bernoulli unmöglich gedünkt
hatte: „Der durchgehende Charakter des reifen Alters, den, soviel wir sehen,
sämtliche Bilder des Kaisers tragen, läßt es nur ausnahmsweise zu, deutlich
ein früher oder später zu unterscheiden“, so hatte er damals geklagt (85).
Heute kommen wir dank der Verfeinerung der Stilbestimmungen auch in der
römischen Kaiserzeit weiter, besonders auch durch Beobachtung des Typus des
einzelnen Bildnisses, dessen Wichtigkeit Otto Brendel am Beispiel des Augustus-
bildnisses auf gezeigt hat.245 Der Weg ist allerdings bisher noch für kein einziges
Bildnis wirklich zu Ende gegangen worden. Es wird auch hier der Brendelsche
Versuch nicht einfach auf das Traiansbildnis übertragen, sondern die vor-
liegende Untersuchung weiß sich auch den ganz anders gelagerten Arbeiten
Bernoullis und Studniczkas, um nur die bedeutendsten Namen zu nennen,
ebenso verpflichtet, wie sie aus den Aufsätzen von Ludwig Curtius immer von
neuem bedeutenden Gewinn gezogen hat.
Unter den Bildnissen Traians sondert sich leicht eine Gruppe aus, die durch
zwei in ihrem Wesen allerdings sehr verschiedene Merkmale als einheitlich
erwiesen wird. Das eine Kennzeichen ist die Art des Haarfalls über der Stirn:
die schlicht vom Hinterkopf nach vorn gestrichenen Strähnen sind in ihren
Enden fast unmerklich zur Seite gewendet, und zwar von der Mitte zu den
Ohren hin, so daß genau über der Nasenwurzel eine kleine dreieckige —
manchmal ausgefüllte — Lücke entsteht; die Dichte des Lockenfalls bleibt bis
zu den Ohren hin gleichmäßig. Das zweite Merkmal ist eine ausgesprochene
245 O. Brendel, Ikonographie des Kaisers Augustus. Diss. Heidelberg, gedr. 193Leider ist
der wichtige Versuch bisher ein Torso geblieben.
6;
5 Traian